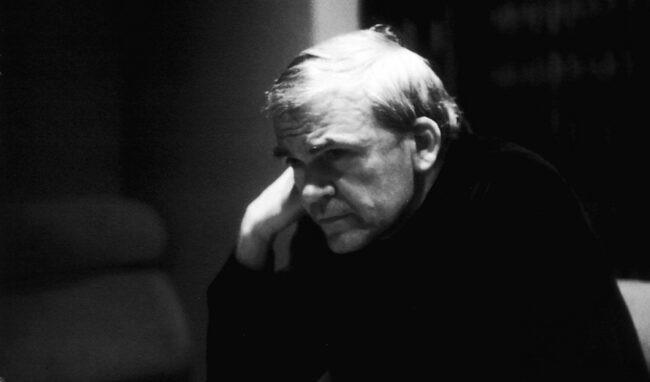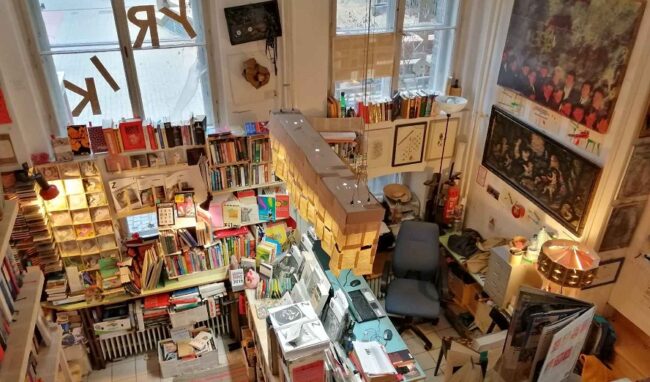Der Tonerl und der Tod
Auch skug begeht den 200. Geburtstag des großen oberösterreichischen Komponisten Anton Bruckner, vulgo Tonerl. Drei aktuelle Bücher von Linzer Autoren bieten einen direkten Umweg zur Erkundung dieses phänomenalen Musikers. Den Auftakt macht »Bruckner stirbt nicht« von Christian Schacherreiter.
25.04.2024