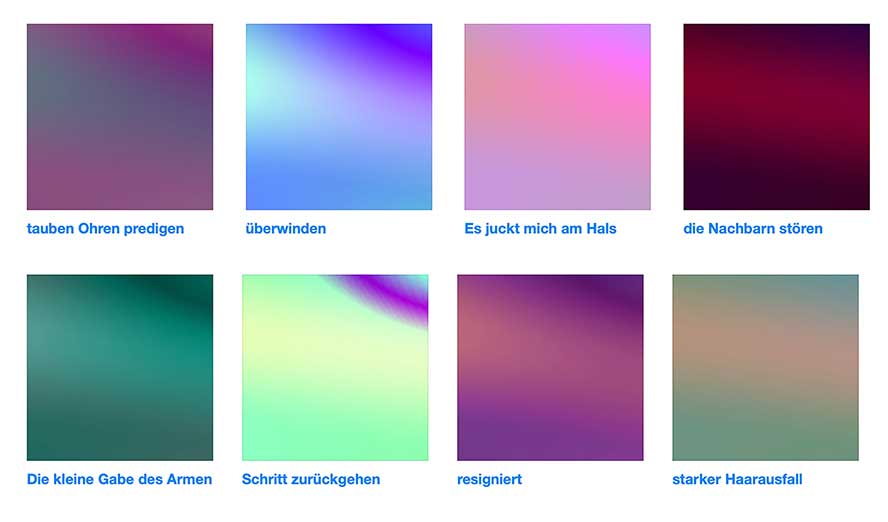Einst symbiotisch vereint, dann verloren entzweit und doch macht sich nach einiger Zeit wieder Versöhnung breit. Jeder hat seinen Preis, und Wunden währen niemals ewig! Jede Band, die etwas von sich hält, trennt sich zumindest einmal im Laufe ihrer Karriere, um dann nach Jahren der unbefriedigenden Solo-Ausflüge und Drogenentzüge mit viel Pomp und Tamtam zurückzukehren – und alle (einschließlich sich selbst) zu enttäuschen. Die Historie der Popgeschichte ist reich und reicher an vergossenen Tränen über aufgelöste Träume und verlorene Geschichten. Doch wer einmal die Gitarrenhälse kreuzt, der tut es wieder. Aus diesem Grund blicken wir in diesem Monat für zwei Reunions nach England und in die USA. Und auf dem Weg nehmen wir auch gleich die experimentell-obskuren Kassettenveröffentlichungen des Monats mit.
Revolutionary Army of the Infant Jesus – »Mirror« (Cruel Nature Records)
Revolutionary Army of the Infant Jesus ist ein experimentelles Musiker*innen-Kollektiv, das 1985 in Liverpool gegründet wurde. Ende der 1980er-Jahre wurden zwei Alben veröffentlicht, dann war für längere Zeit Schluss. Wirklich aufgelöst hat sich die Gruppierung zwar nie, ernsthaft an neuem Material wurde allerdings auch nicht gearbeitet. Bis vor einigen Jahren. Denn 2015 erschien aus heiterem Himmel ein neues Album. »Beauty Will Save The World« hieß es da übertrieben optimistisch, wenn auch in direkter Anlehnung an Dostojewskis »Idioten«. Dabei war die Musik der Gruppe schon immer eine Mischung aus düster-psychedelischem Folk, sakraler Kirchenmusik und Industrial-Sounds, sodass sie selbst aus heutiger Sicht locker Vergleichen mit Bands wie Current 93, Death in June oder Dead Can Dance standhält. Ihr zweites Album »Mirror« wird jetzt nach über 28 Jahren von Cruel Nature Records neu aufgelegt und zeigt sich eklektisch zwischen Spaghetti-Western-Soundtrack und pastoralem Tribal-Singsang mit politisch wie literarisch weit gestreuten Einflüssen. So unterschwellig der Katholizismus sich auch durch das Album ziehen mag, Oratorium ist »Mirror« dann doch keines. Gottseidank, möchte man meinen!
Setter – »Transversal (Special Edition)« (Hylé Tapes)
Bereits im Jänner veröffentlichte das französische Duo Setter eine erste EP unter dem Namen »Transversal«. Vier Stücke waren es damals, die in ihrer atmosphärischen Tiefe und der rauschenden Durchdringlichkeit teilweise an eine Mischung aus Gruppen wie Labradford, Bohren und der Club of Gore und Einzeltätern wie Biosphere und Christian Fennesz erinnerten. Schwebende, gleichsam anrüchig anmutende Momente, eingefasst in träge dahinströmende Drones, die, an manchen Stellen mit flirrender Percussion erweitert, in einem stetig wuselnden Auf und Ab die Dynamik der Wellenbewegung mimten. »A Small Part of What I Received« stellte dabei gar Bezüge her, die an das asketische Gerüst eines Wolfgang Voigt erinnerten: ein monotones Gestampfe, greifbar irgendwo in der Ferne. Aber eben doch nur fast, denn der Schleier hängt knietief im undurchsichtigen Morast aus Tape Loops und Field Recordings. Das nunmehrige mit sechs unveröffentlichten Stücken erweiterte Album ist durchaus rhythmisch ausgelegt, scheint aber in den seltensten Fällen einer festgeschriebenen Konvention zu folgen. Die neue, zweite Seite ist vergleichsweise lieblich und verspielt, vielleicht auch, weil sie den nebulösen Schleier zeitweise gänzlich abstreift und dadurch weniger bedrohlich wirkt. »Edofurin« mutet dahingehend sogar überschwänglich offen und organisch an. Die Synthesizer klingen fest und kraftvoll und werden häufiger mit verwaschenen Percussion-Elementen unterlegt, die dann, eingezogen wie eine zweite Ebene, alles willkürlich auseinanderdividieren. Ziemlich schön!
Ulrich Rois – »Everything Is Merging« (Feathered Coyote Records)
»Everything is Merging« – alles verschmilzt zu einem einzigen, undurchdringlichen Ganzen, das sich in kreiselnden Drehbewegungen nach oben schraubt, um ein entschleunigtes Gegengewicht zu all dem digitalen Rauschen zu festigen. Das zweite Soloalbum von Ulrich Rois (vorgestellt im Rahmen von Salon skug) ist ein Manifest in sechs Teilen, das die Grenzen in Raum und Zeit zumindest für die Dauer der ineinander übergehenden Stücke aufzuheben weiß. Ein sich anbahnender Ausbruch psychedelisch ausgebuffter Drones mit kreischenden Rückkopplungen und übersteuerten Percussion-Elementen, die im fuzzenden Wah-Wah der Gitarren-Loops eingebettet sind. »Unexpected Occurences« klingt beispielsweise wie ein neopsychedelischer Rave – von außen wummernd und mit Tunnelblick nach vorne weg. Dem voraus geht wiederum ein Cover von Kendra Smiths »Valley Of The Morning Sun«, das den poppigen Groove des Originals in ein acht Minuten langes Vexierbild seiner selbst verwandelt. Rois kaschiert nichts und baut behutsam auf. Das dauert mitunter gut und gerne etwas länger, ist aber ohnehin der Tradition von Krautrock, Drone und Psychedelia geschuldet. »Everything Is Merging« ist wie gleißende Wüstensonne in staubtrockenen Gefilden: unbarmherzig, aber mit dem richtigen Begleitwerkzeug erfrischend wie nie!
glassEYElashes – »Jellyfish« (HAVNrecords)
Keyboard, Schlagzeug und Gitarre, bedient von drei Frauen aus Kanada, viel mehr scheint es nicht zu brauchen, um eines der interessantesten Popalben des Monats zusammenzubasteln. Natürlich ist das alles viel zu kurz gegriffen, denn gesungen wird mitunter auch. Aber im Kern stimmt es schon. Die Musik, mit ihrer hell-schlürfenden Chanson-Begleitung und dem holprigen Schlagzeug, ist ein Sammelsurium aus verschiedensten Versatzstücken der zeitgenössischen Popmusik. Eine bunte Collage, kammermusikalisch pervertiert, stilistisch auf der eigentümlichen Seite der Gemütsskala veranlagt. Und gerade diese Assemblage macht »Jellyfish« so eigenartig interessant. Dass zumindest eine der drei Bandmitgliederinnen – Sarah Good, Annie Shaw und Becky Katz – eine klassische Gesangsausbildung vorweisen kann, versteht sich nach dem ersten Song »Iowa« und sollte selbst überkritische Ohren spätestens nach der kontrapunktisch durchkomponierten Ballade »Bee in the Sore« überzeugen. Traditionelle Songstrukturen prallen auf Ebenen des ausschweifenden Lärms und lassen ein virtuoses, manchmal verstörendes, aber immer überraschendes Album entstehen, das eine helle Freude am Klang und den Worten ausströmt.
Mondo Lava – »Ogre Heights« (Hausu Mountain Records)
Leon Roc und Jame Kretchum sind beide Anfang 30, betreiben mit Mondo Lava ein Bandprojekt und verarbeiten mit diesem Album vielleicht einen Teil ihrer gemeinsamen Jugend. Zumindest drängt sich dieser Eindruck auf, wenn man sich Stücke wie »Air Walk«, »Dreams« oder »Hippodrome« anhört. Treibend und doch zurückhaltend verschwommen schlurfen da so irrlichternde Gestalten wie Donkey Kong und Super Mario durch die imaginären Spielewelten der Vergangenheit. Kratzige Casio-Klänge, leiernde Bässe und verspielt-funkelnde Lo-Fi-Rhythmen sorgen auf diese Weise für ein paar knallbunt reflektierende Flashbacks. Ein Pastiche der Tropicália-Musik aus den 1970er-Jahren – herrlich dämlich, aber wunderbar zum Hören und Träumen und die ideale Begleitmusik für heiße Sommertage im Schatten fiktiver Palmen. Irgendwie erinnert auf »Ogre Heights« sowieso alles an die idealisierte Ästhetik vergangener Zeiten und einer längst vergessenen, wenn auch wundersam präsenten Popkultur mit Videokassetten, so groß wie Ziegelsteine. Bevor jetzt allerdings jemand auf die Idee kommen sollte, daraus so etwas wie die 238. Reinkarnation von Vaporwave zu interpretieren: Nein, das hat damit rein gar zu tun – zumindest nicht im eigentlich Sinn der Musik, denn die entwickelt sich hier vollkommen unabhängig immer weiter in teils unerwartete Richtungen afro-brasilianischer Drum-Patterns und fröhlich spiraligen Piano-Soli. Muss man gehört haben.
unifactor Tape Batch #7: Mukqs – »Slug Net«; Marcia Custer – »Stacey’s Spacey«; Headlights – »The Radio Plays« (unifactor tapes)
Mit gleich drei Tapes überbrückt das Label unifactor diesen Sommer. Eines davon stammt von Maxwell Allison, Mitbegründer von Hausu Mountain Records und seit einigen Jahren mit seinem Projekt Mukqs für musikalische Zerstörungen der ärgeren Gangart zuständig. Auch mit dem neu erschienenen Album »Slug Net« wird Freund*innen des melodischen Ausgleichs und der Harmonie eher weniger Gefallen getan, entspricht es doch in etwa dem Versuch, eine klangliche Mutation unter klinischen Laborbedingungen mit Hilfe manisch-maximaler Überlastung des Hörvermögens zu erzeugen. Alles Mögliche hackt unentwegt und unerbittlich auf einen ein, wobei man nicht einmal sicher sagen kann, was es denn schließlich ist, was da an der selbstauferlegten Folter mitwirkt. Zerschnipselte Hardcore-Metal-Stücke, maßlos überdrehte Elektro-Elemente und die wenig betörende Kombination dessen sind nur unvollständige Definitionen einer waschechten Tortur. Allison wirkt dabei stellenweise wie ein Dieb, der sich in rüpelhafter Manier an allem bedient, was ihm an schrägen Sounds unter die Finger kommt.
Völlig anders und doch im Geiste verbunden sind die Stücke mit dem, was Marcia Custer auf der zweiten Veröffentlichung so von sich gibt. Ihre Vocoder-Stimme und der billige Casio-Synthesizer bieten eine ziemlich abgegraste Spielwiese für psychotische Abgründe – wahlweise mit entfremdeten Geräuschen aus dem Kinderfernsehen oder der Erwachsenenwerbung. Buy the ticket, take the ride! »Spacey’s Stacey« liegt irgendwo zwischen endloser Nachtschleife auf KiKA und dem neuesten sensorischen Overload von Video-Künstler Ryan Trecartin.
Aller guten Dinge sind drei und dreimal so entspannend ist alles, was man auf den 23 Stücken des Albums »The Radio Plays« von dem Duo Headlights zu hören bekommt. Derek Gedalecia und Aurora Josephson durchlaufen über die Gesamtdauer einer Stunde ein mondänes Radioprogramm, spielen synthetische Cover-Versionen von Kraftwerk, Velvet Underground und Christian Wolff, zitieren Dada-Mitbegründer Tristan Tzara und vertonen darüber hinaus ein weites Repertoire an Gedichten von Sylvia Plath, Antonin Artaud und Walt Whitman. Ziemlich straff, aber nach dem zuvor gehörten eine wahre Wohltat.
Turkish Delight – »Howcha Magowcha« (I Heart Noise)
Die späten 1990er waren rückblickend nicht gerade rar an selbsternannten Rockbands mit schräg gestimmten Gitarren, unerschrockener DIY-Attitüde und maximaler Unangepasstheit bei minimaler Halbwertszeit. Die aus Boston stammende Band Turkish Delight nahm sich dahingehend nicht wirklich aus. Sie veröffentlichte kurz vor Ende des ablaufenden Jahrtausends zwei kommerziell eher unbeachtete Alben und verschwand wie viele andere Gruppen in einer unüberschaubaren Fülle an überdurchschnittlich mittelmäßiger Gitarrenmusik. An ihrer Musik dürfte es trotz ausbleibendem Erfolg im Mainstream aber eher nicht gelegen sein. Trotzdem verlief irgendwie erst einmal alles Weitere im Sand. Über 20 Jahre später feiert die Gruppe jetzt jedenfalls bei gleicher Besetzung ihre späte Wiedervereinigung und legt dazu das 1998 veröffentlichte Album »Howcha Magowcha« neu auf. Das Konzert ist vorerst eine einmalige Gelegenheit und findet »zu Hause«, also weit weg in Boston statt. Die Musik bleibt hingegen noch länger erhalten, lebt sie doch auf den neu bespielten Kassetten weiter und hat trotz der langen Pause bis heute nichts an ihrer Bissigkeit verloren. Irgendwo zwischen frühen Sonic Youth und dem späten Math-Rock von Polvo wechseln sich hier unkonventionelle Akkordabfolgen mit eingängigen Riffs ab, die so auch aus der Feder der Melvins hätten stammen können. Experimenteller Indie aus den 1990ern, schön schrammelig und gut!
Claus Poulsen – »Make a jazz noise here« (Insula Records)
Claus Poulsen stammt aus Kopenhagen und gilt in der dortigen Noise- und Experimental-Szene als umtriebiger Alleskönner. Als solcher praktiziert er seit jeher die Kunst des freien Improvisierens, wobei es ihm mitunter um die künstlerische Herausforderung geht, wenn Klänge herkömmlicher Instrumente mit vermeintlichen Nicht-Instrumenten verbunden werden. Solche Nicht-Instrumente sind für Poulsen vor allem Dinge des alltäglichen und (für manche mitunter) weniger alltäglichen Lebens. Naturgemäß möchte sich der Däne auf derlei starre Zuschreibungen aber nicht festlegen müssen. Für das auf Insula Records erschienene Album »Make a jazz noise here« verwendet er deshalb die neueste Errungenschaft aus der hauseigenen Werkstatt: ein ausrangiertes Schlagzeugbecken, das mit einem umfunktionierten Bassbogen malträtiert wird. Schnelle Bewegungen erzeugen helles Kreischen, das ein Saxophon vermuten lässt, wo keines ist. Langsameres Streichen lässt hingegen grunzende Bassgeräusche ertönen. Insgesamt entsteht auf diese Weise über 16 Stücke so etwas Ähnliches wie Musik. Interessant wird es jedenfalls immer dann, wenn er mittels unterschiedlichen Effektbeisteuerungen das klangliche Spektrum dieser undefinierbaren Töne auslotet. Was im ersten Moment noch ein trockenes Scheibenwischerquietschen war, ist im nächsten ein verhalltes Schiffsdröhnen. Spannend und für exzentrische Klanghalunken ein ziemlich geiles Fest!
»Grundrauschen« im Radio
»Grundrauschen« ist nicht nur der Name dieser Kolumne, sondern auch ein Gefühl, das sich in und mit Musik beschreiben lässt. Auf Radio Orange 94.0 wird jeden dritten Dienstag im Monat ab 21:00 Uhr genau diesem Gefühl nachgespürt – mit interessanten KünstlerInnen und experimenteller Musik, die sich dem Mainstream weitläufig entzieht. Je größer die Verstärkung, umso deutlicher das Grundrauschen.