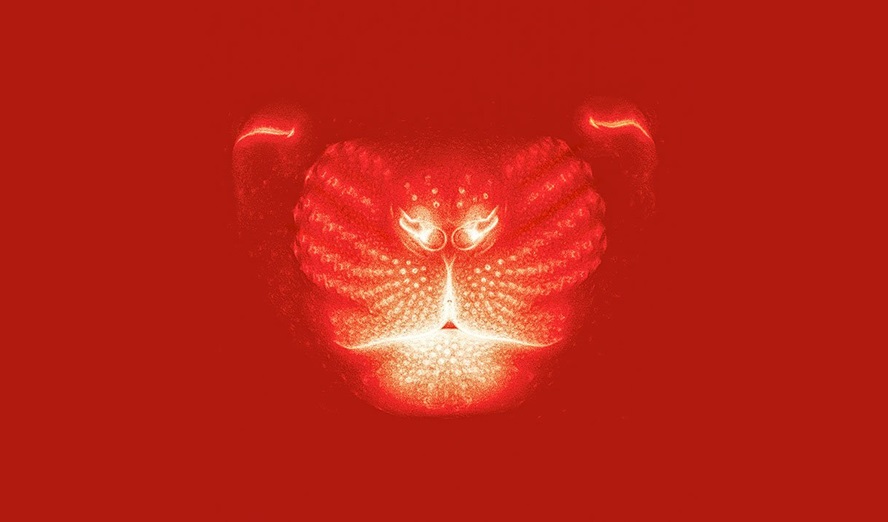Von 20. Oktober bis 1. November versammelte sich das filmaffine Publikum wieder im Gartenbaukino, Stadtkino im Künstlerhaus, Metro Kinokulturhaus, Österreichischen Filmmuseum und Urania Kino, um bei der Viennale 2022 dem internationalen Film zu huldigen. Neben ausführlichen Rezensionen von »Vera« »Werner Herzog – Radical Dreamer« und »Elfriede Jelinek – die Sprache von der Leine lassen« stellen unsere Autor*innen hier einige weitere Highlights vor – ein Rückblick, der zugleich als Vorschau aufs kommende Filmjahr gelten soll.
»Mutter« (Carolin Schmitz, DE 2022)
Anke Engelke ist »Mutter« im gleichnamigen Film von Carolin Schmitz. Die Regisseurin hat im Vorfeld verschiedene Frauen im Alter von 35 bis 70 Jahren zum Interview geladen und zu ihren unterschiedlichen Mutterrollen befragt: ob Künstlerin oder Lehrerin, Unternehmerin oder Hausfrau, Alleinerzieherin oder Großfamilienvorstand. Die daraus resultierenden Statements gibt Engelke im Rahmen eines alltäglichen »Bühnenbildes« wieder – in der Badewanne oder im Bett, beim Autofahren oder beim Einkaufen. Es ist beeindruckend, wie sie durch die Modulation ihrer Stimme, das Nachahmen sprachlicher Eigenheiten – eine Dialektfärbung hier, ein nervöses Lachen dort – die höchst diversen Charaktere formt und ihre vielschichtigen Lebens- und manchmal auch Leidensgeschichten erzählt. Ein spannendes Konzept, eine herausragende schauspielerische Leistung und ein Paradebeispiel für den gelungenen Einsatz von »Viennale barrierefrei«, denn auch ohne die visuelle Ebene zeichnet der Film dank Audiodeskription für Blinde und Sehbeeinträchtigte ein differenziertes Bild seiner Protagonistin/nen.
– Mio Michaela Obernosterer
»R.M.N.« (Cristian Mungiu, FR, RO, SE 2022)
In einer transsylvanischen Kleinstadt braut sich etwas zusammen. Und das nicht erst mit der Rückkehr des so verlorenen wie gewaltbereiten Mathias (Marin Grigore), nachdem das Angestelltenverhältnis bei einer deutschen Fleischerei böse endet. Und auch nicht erst mit dem Anheuern von Billigarbeitskräften aus Sri Lanka, die die Geschäftsführerin des lokalen Bäckereibetriebs Csilla (Judith State) umsetzt. Regisseur Cristian Mungiu konfrontiert uns mit einer komplexen ästhetischen Verdichtung von aktuellen Tendenzen an der Peripherie Europas: Es geht um EU-Gelder, die katholische Kirche, Rassismus, ein prekär-multilinguales Nebeneinander, männliche Gewalt und weibliche Emanzipation unter den Vorzeichen neoliberaler Zerrüttungen und Sachzwänge. Aber »R.M.N.« – und das ist die große Leistung dieses Films – zerrinnt weder in einem Sozial-Kaleidoskop, noch verengt er sich zum Spannungsplot; vielmehr wird eine Resonanz zwischen beidem durchwegs aufrechterhalten. Zuweilen spitzt sich das geradezu brillant zu; etwa wenn die Dynamik einer Dorfversammlung – ihr Auf- und Abkochen zwischen Rassismus, Spott und bitterem Humor – minutenlang ohne Schnitt gezeigt wird. Einer der schönsten Kniffe des Films: Mathias wird sich nie zum Träger der Handlung aufschwingen können; er repräsentiert vielmehr jene auf Ehre getrimmte, aber überflüssig gemachte Männlichkeit, die die Bewohner*innen ausschließlich auf die Arbeitsmigranten projizieren. Diesen und weitere Widersprüche fängt die glasklare Bilddramaturgie von Tudor Panduru geradezu perfekt ein: Ohne Verklärung, aber immer wieder voll Geheimnis und Abgründigkeit.
– Simon Stockinger
»Rewind & Play« (Alain Gomis, DE, FR 2022)
1969, kurz vor seinem letzten Konzert einer Europatour, gab Thelonious Monk ein Interview fürs französische Fernsehen. Wenn man denn das, was in den 65 Minuten von »Rewind & Play« von Alain Gomis passiert, so nennen will. Im Grunde ist es eine reine Katastrophe, und das Ergebnis kaum auszuhalten, wären da nicht die unendlich schönen Zwischenspiele Monks, die das rücksichtslose, unsensible Verhalten des Interviewers und den höllentiefen Cringe kurz vergessen lassen. Der Interviewer, laut eigenen Angaben bereits mehrfach mit Monk zusammengetroffen, hat ein fixes Programm und weiß auch schon die Antworten, die am Ende sein Porträt zieren sollen. Die Kamera ist immer sehr nah an Monks Gesicht, unangenehm nah. Man sieht Monk, wie er ein Ei pellt. Man sieht ihn schwitzen. Er ist irritiert, überfordert. Überfordert ist aber vor allem der Interviewer. Verständnislos, rücksichtslos sein Verhalten, das wie das eines unfähigen Vaters zu seinem Kind pervertiert. Sobald die Antworten auf die Fragen nicht passen, werden sie herausgeschnitten. »Warum haben Sie Ihr Piano in die Küche gestellt, Herr Monk«? »Weil die Küche das größte Zimmer war.« Es hätte viel Spannendes zu hören gegeben, wenn man denn hinhören wollte. Doch die Wahrheit passte nicht in die Realität des weißen Jazz-Liebhabers. Als Monk über ausbleibende Zahlungen nach seinen Konzerten berichtet, wird dies wegen einem zu negativen Ton glatt wieder gestrichen. Dass das irgendwie mit dem Piano in der Küche in Zusammenhang stehen könnte, wird ignorant ausgeblendet. Ein unangenehmes Zeitdokument, das durch die Musik Monks zumindest auszuhalten ist.
– Lutz Vössing
»Vanskabte Land« (Hlynur Pálmason, DK, FR, IS, SE 2022)
Ausgehend von sieben Fotos, die ein dänischer Priester im 19. Jahrhundert in Island aufgenommen hat, spinnt Filmemacher Hlynur Pálmason in »VanskabteLand« die Geschichte um den jungen Gottesmann Lucas, der sich in den wilden Norden aufmacht, um ein paar Schäfchen ins Trockene zu bringen. Doch sein anfänglicher Idealismus und Entdeckergeist werden schon bald gebremst von der harschen Realität der nordischen Wildnis, in der zarte Pflänzchen allzu oft den Tieren – manchmal in menschlicher Gestalt – zum Opfer fallen. Pálmason erzählt sein Zweieinhalb-Stunden-Epos im an die anfänglich erwähnten Fotos angelehnten 1,33:1-Format mit abgerundeten Kanten und damit gleichsam aus Lucas’ fotografischer Perspektive. Die Bilder sind dabei stellenweise statisch, aber immer von überwältigender Schönheit und Ausdruckskraft oder »terribly beautiful: terrible and beautiful«, wie die Protagonist*innen die sie umgebende Landschaft beschreiben. Hinter der Filmkamera stand im Übrigen Maria von Hausswolff, die sich das Gespür für düstere Schönheit mit ihrer musikalischen Schwester Anna teilt. Und allein das ist die Reise ins »Vanskabte Land« wert.
– Mio Michaela Obernosterer
»Incroyable mais vrai« (Quentin Dupieux, FR 2022)
»Incroyable mais vrai«, der neue Film von Quentin Dupieux, dem Weirdness-Spezialisten aus Frankreich, begleitet die sympathischen Eheleute Alain (Alain Chabat) und Marie (Léa Drucker) durch ein Zeitreise-Szenario. Es beginnt mit einem Hauskauf. Der Immobilienmakler weist schon bei der Besichtigung auf das Rabbit Hole im Keller hin: Wer diese Liegenschaft kauft, kann Zeitsprünge nach ganz bestimmten Regeln machen. Nach dem Kauf treffen Alain und Marie ihren alten Freund Gérard (Benoît Magimel) – der zudem Alains Chef ist – zum Abendessen. Auch Gérard hat von einer ungewöhnlichen Veränderung in seinem Leben zu berichten: Er hat sich in Japan einen Roboterpenis montieren lassen, der via Handy-App gesteuert werden kann. Das sei schließlich die Zukunft. Was diese beiden seltsamen Geschichten verbindet, ist ein Kampf gegen das Altern (und vielleicht auch gegen die Fadesse der französischen Vorstadt). Denn das unverhoffte Keller-Tool im Haus des Ehepaares kann, bei richtigem Einsatz, ganz ohne technische Eingriffe zur Verjüngung führen. Dupieux führt uns mit freundlicher Musik und hellen Bildern durch diese surreale und sehr witzige Geschichte, in der freilich das Wunder stets von der Alltagslogik der verwalteten Welt bedroht wird. Dabei überträgt er den Inhalt der Story auch auf die Erzählweise, indem er formal mit der Darstellung von Zeitlichkeit spielt. Am irrsten daran: Etliche Höhepunkte des Films werden in einer langen, von schläfriger Xylophon-Musik begleiteten Zeitraffer-Montage zusammengefasst. Das muss man sich erstmal trauen.
– Simon Stockinger
»Zorn« I, II, III (Mathieu Amalric, FR 2016, 2018, 2022)
Man muss sich John Zorn als einen glücklichen, aber auch beängstigend hyperaktiven Menschen vorstellen. Alles ist crazy, was er macht, das betont er immer wieder, lachend, wie ein nie erwachsen gewordenes, nerdiges Kind. Alles, was er tut, tut er mit Begeisterung und maximalem Fokus und totaler Aufmerksamkeit. Und das seit Jahren und unermüdlich. In der dreiteiligen Dokumentation (»Zorn I (2010–2016)«, »Zorn II (2016–2018)«, »Zorn III (2018–2022)«) von Mathieu Amalric, der den Musiker seit 12 Jahren begleitet, spiegelt sich dessen Arbeitsweise wieder: Jeder von Zorns zehn Fingern scheint ein eigenes Projekt zu verfolgen, ist er nicht selbst als Musiker am Instrument involviert, sitzt er daneben und leitet Aufnahmen oder Live-Konzerte. Die Kamera springt ohne Erklärungen von Ort zu Ort, immer mit Zorn im Mittelpunkt, der in der Musik jedoch vor allem als Vermittler eine Agentenrolle spielt. Sein Job ist es, neben dem Komponieren tausender Werke, Menschen zusammenzubringen. Sein Genius geht nicht in die Tiefe, und das ist nicht falsch zu verstehen, sondern liegt in dem Schaffen von äußerst fruchtbaren Biotopen, in denen seine Ideen reifen und über sich selbst hinauswachsen. Amalric zeigt einen unermüdlichen Arbeiter, dessen Musik herzerwärmend, begeisternd, fesselnd und voller Emotionen ist und in ihrer Radikalität ihresgleichen sucht.
– Lutz Vössing