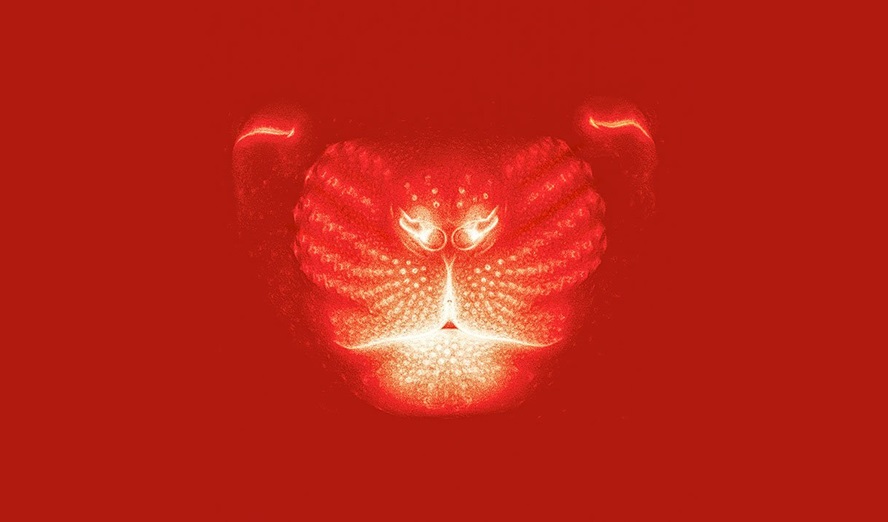Das Drehbuch als Ausformung einer dramatischen Erzählung bildet die Grundlage jedes Filmwerks. Sie ist das wesentliche Werkzeug für alle am Entstehen und finalen Durchführen eines Films Beteiligten. Die Wurzeln des dramatischen Schreibens erkennt Peter Payer deshalb in Aristoteles‘ »Poetik« und findet daran beeindruckend, »dass nahezu alles, womit wir in der performativen Kunst und Unterhaltung zu tun haben, er schon strukturiert hat und zwar ziemlich schlüssig…«
Kurze geschichtliche Rückblende ins Jahr 1923. Der Erste Weltkrieg ist vorbei, und der auf Rauchrequisiten spezialisierte Wiener Drechslermeister Adolf Lichtblau sucht eine neue Bleibe. Diese findet er in einem zierlichen Haus der frühen Biedermeierzeit in der Hermanngasse. Ein faszinierendes Ensemble mit Garten und Springbrunnen in einem florierenden Handwerksbezirk (Kürschnern, Seidenfabrikanten, u. v. m.). Auch kulturell ist dieses Grätzl spannend, da sich ein Zentrum für Filmproduktionsstätten, Filmschaffende und Cafés rund um die Neubaugasse entwickelt. Zurück im Jahr 2023 beeindruckt immer noch die Skulptur von einem Turban tragenden und Calabashpfeife rauchenden Mann an der Fassade des Hauseingangs. »Der Hintertrakt des Hauses«, lässt Payer uns wissen, »soll einer der ersten Stahlbetonbaute Wiens sein. Den hat ein Verwandter von Adolf Lichtblau – Ernst Lichtblau – gebaut und die Fassade des Biedermeiertrakts gestaltet.« Hier versteckt hat Peter Payer seine Wohnung. Aufzeichnungen eines Gesprächs mit einem zeitgenössischen, passionierten Raucher:
skug: Du hast im Schreib-Kurs »Von der Idee zum Drehbuch« davon gesprochen, dass es für dich eigentlich nur drei »richtige« Berufe gibt: Arzt, Lehrer und Bauer. Warum hast du dich dann gegen Ende deines Medizinstudiums für das Filmemachen als Beruf entschieden?
Peter Payer: Arzt, Bauer und Lehrer sind für mich nach wie vor die einzigen drei richtigen Berufe. Und natürlich auch die Derivate davon, neben studierten Mediziner*innen zähle ich auch die ganzen Pflegeberufe dazu, beim Bauer alle Arten von Nahrungsmittelproduzent*innen und Produkte produzierenden Menschen. Und beim Lehrer zählen auch alle guten Geschichtenerzähler*innen für mich dazu. Als Filmemacher sehe ich mich aber nicht als Didaktiker, das fände ich fad.
Ich hatte als Jugendlicher lange Zeit nicht am Schirm, dass man künstlerisch-kreative Tätigkeiten als Beruf ausüben kann. In meinem Umfeld gab es das nicht. Da ich während meines Medizinstudiums arbeiten musste, bin ich irgendwann als Volunteer – damals wurden die schlecht, aber doch bezahlt – bei einem post-studentischen Filmprojekt gelandet.
Auch das Produzieren von geistiger Nahrung ist wichtig. Ich denke da an die Geschichte im Kinderbuch »Frederick«. Die Maus Frederick hat im Gegensatz zu den anderen keine Nahrung gesammelt, sondern ist in der Sonne gesessen und hat gesagt, sie sammle Sonnenstrahlen. Als sie dann im Winter keine Nahrung mehr hatten, sind sie durch seine Geschichten über den Winter gerettet worden. Der Geist kann über den körperlichen Hunger hinweghelfen…
Absolut, er kann es zumindest erleichtern.
Wie kam es dann zur definitiven Entscheidung, dein Medizinstudium aufzugeben?
Gute Frage, das waren kleine Stufen. Ich stand vor der schwierigen Entscheidung, meine Leidenschaft zum Arztberuf – in meiner Familie gab es keine Ärzt*innen – schweren Herzens aufzugeben. Aber es gibt schon Phasen im Kulturschaffen, wo man sich dann denkt, als Arzt hätte ich dieses Problem jetzt nicht…
Ich bin in einem Studienabschnitt ausgestiegen, in dem das fast niemand mehr gemacht hat. Nach dem letzten großen Brocken der Pathologie. Ich habe die Entscheidung von folgender Frage abhängig gemacht: Habe ich das Gefühl, ich kann innerhalb der nächsten zwei Jahre eigene, frei gestaltete Projekte durchführen, von denen ich auch leben kann? Dann werde ich dabeibleiben. Damals war der ORF ein Versuchsfeld für junge Filmemacher*innen, zum Beispiel im Rahmen der »Kunststücke«. Und dann wurde ich auch da und dort für Werbespots angefragt.
Die Werbespots haben deine 1990er Jahre geprägt. »Untersuchung an Mädeln« mit der Musik von Werner Pircher war dann 1999 dein erster Debütfilm fürs Kino?
Ich habe davor viele gestaltete Dokumentarfilme und Features im Kulturbereich gemacht. Mit dem Autor Wolfgang Beyer habe ich eine Sendung – die hieß, glaube ich, »Vatersprache Mutterland« – über österreichische Literatur nach 1945 gemacht. Wolfgang Beyer hat Buch und Konzept geschrieben, ich habe den Film gedreht. Im Zuge dieses Dokumentarprojektes habe ich diesen Roman von Albert Dach gelesen. So bin ich auf die Idee gekommen, dieses Thema als Spielfilm einem Produzenten vorzulegen. Und zwei Jahre später habe ich zu drehen begonnen. So easy war es nie wieder.

Lag es auch daran, dass es ein Debütfilm war?
Debüts waren und sind in Österreich nicht so schwer zu realisieren. Es muss einfach jemand an deine handwerklichen Qualitäten glauben. Das grundsätzliche Problem ist heute wie damals: Film ist das teuerste künstlerische Ausdrucksmittel. Man benötigt einen gewissen Stab an Leuten. In ganz Mitteleuropa gibt es ein förderorientiertes System, denn inhaltsorientierte Filme können fast nie selbst finanziert werden. Freifinanziert sind nur stark publikumsorientierte Filme von gut vernetzten Produzent*innen mit Blockbuster-Ambitionen. Bei Förderungen handelt es sich um Steuergeld, mit dem man respektvoll umgehen muss.
Durch die technische Weiterentwicklung des filmischen Equipments hat sich für dich beim Machen nichts wesentlich verändert?
Man hat geglaubt, dass es weniger aufwendig sei, mit digitalem Equipment zu produzieren. Und wenn ich an den Workflow denke: Ein bisschen hat es auch an Magie verloren. Im Film richtest du Licht auf Geschichten. Licht kommt durch die Linse, auf dem Bildträger landet eine Handlung. Aber was passiert, wenn das Material nicht mehr im klassischen Sinne belichtet wird?
Am Set wird nun die Kamera oft laufen gelassen, weil es nicht mehr die große Kostenrelevanz hat. Früher war das ein No-Go, es kam sofort das Kommando »Cut!«, um Filmmaterial zu sparen. Aber das Erzählen hat sich nicht so stark verändert, einfach weil ein paar erzählerische Grundlagen unverrückbar sind.
Es muss ja kein Entweder-Oder sein, man kann auch im gesunden Zwischenraum von Digitalem und Analogem arbeiten?
Ich bewege mich komplett in dieser Zwischenwelt. Ich gehe an jedes Projekt heran, als wäre es analog. Ich lasse die Kamera nicht einfach so laufen, nur weil sie vor Ort ist. Eine Szene wird ein paar Mal geprobt und gedreht. Ich kann aber die Dreh-Zeit anders nützen. Der Zugriff auf das Material ist einfacher, ich kann mehrere Varianten ausprobieren. Richtig analog sind bei meinen Filmen rein handwerklich betrachtet mittlerweile weder Ton noch Bildaufnahme oder Postproduktion.

Kommen wir zu »Ravioli«, deinem Filmprojekt mit Alfred Dorfer aus dem Jahr 2003. Er weist ein paar Besonderheiten auf.
»Ravioli« war in mehreren Hinsichten ein kleiner Meilenstein für mich. Ich wurde von Freddy (Anm.: Alfred Dorfer) gefragt, ob ich mir einen Text von ihm durchlesen mag: ein schwarzhumoristischer Monolog einer Figur, die sich gerade in einer Scheiter-Phase befindet und Gedanken über das Jenseits wälzt.
Freddy empfand die Art der Fernseh-Dokumentationen von Kabarett-Auftritten Anfang der 2000er-Jahre als langweilig und anachronistisch: Ein Fernsehpublikum sieht einem Theaterpublikum zu, wie es jemandem auf der Bühne zusieht. Mit seiner Stunde Sendeplatz konnte er im Grund machen, was er wollte. So schnell konnte ich gar nicht schauen. Auf einmal war ich in einem Drehbuch-Entwicklungsprozess.
Freddy wollte ein unabhängiges Konstrukt. Wir hatten die Summe X vom Fernsehen zur Verfügung, die er verdoppelte. Ich habe eine Gruppe an mir vertrauten Mitstreiter*innen gesucht und selbst produziert. Die Summe wurde durch die Drehtage dividiert, denn wir wollten auch niemanden finanziell ausbeuten. In einer idealen Welt würde ich immer so arbeiten: Man hat eine Vision, kennt die Bedingungen und richtet sich danach. So kann man freier vorgehen als bei so manchem viel teureren Film. Es war ein Glücksmoment, das zu erkennen. Die Limitation des Budgets zwingt einem zum Nachdenken: Wie löse ich die Erzählung mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen?
War der Film nicht ursprünglich fürs Fernsehen gedacht?
Die Fernsehversion wurde nicht konfektioniert. Die erste Version dieser Schwarzen Tragikomödie mit einer Länge unter 60 Minuten fand der ORF zwar super, aber sie sagten uns: »Wir werden den Film nicht vor Mitternacht spielen können«. Wir haben dann gesagt: »Na gut, dann bringen wir ihn ins Kino.« Und so haben wir ein paar Szenen zusätzlich zum bestehenden Film gedreht, denn der Verleih Filmladen hat an das Kino-Projekt geglaubt. Und der Film »Ravioli« war in den Kinos auch bezüglich der Publikumszahlen erfolgreich.
Auf der DVD von »Ravioli« (Der österreichische Film – Edition Der Standard #90) fand ich ein Interview mit dir und Alfred Dorfer – ihr beide in einem kargen, pastellgrünen Badezimmer…
Das war in einem Studiobau von der Verfilmung eines Buches von Christine Nöstlinger. Ich fand das passend. Dieser Film »Villa Henriette« war quasi mein einziger Kinoauftrag. Die Geschichte von Christine Nöstlinger geht so: Eine Familie lebt in einem schönen alten Haus. Die Großmutter ist eine verrückte Erfinderin und bedroht durch ihre visionären Ideen ihre finanziell abgesicherte Existenz. Die Enkelin ist die Einzige, die sie versteht.
Das Mädchen kann in der Geschichte mit dem Haus reden. Dramaturgisch interessant fand ich es, dem Haus wirklich eine Stimme zu geben, die nur das zwölfjährige Mädchen hören kann. Doch wer könnte die Stimme von dem Haus sprechen? Ich bin auf Nina Hagen gekommen und habe sie einfach kontaktiert.
Ein mögliches Setting wäre einfach ein altes, verträumtes Haus am Stadtrand mit Apfelbaum gewesen… In der Regiearbeit ging ich aber von der Frage aus: Wie könnte ein Zukunftsorientierter – der Vater der Erfinder-Großmutter – in den 1930er-Jahren für seine Familie ein Haus geplant haben? Wir haben uns an die italienische, futuristische Architektur der Moderne angelehnt und in diesem Stil ein rundes Haus mit Turm gebaut. »Villa Henriette« ist also zu 70 Prozent ein Studiofilm. Das war eine ästhetische Bürde, die ich uns auferlegt hatte.
Und wir haben natürlich auch einen Platz für das Haus gebraucht. Die Modeschule Hetzendorf war sehr kooperativ, da dieses Haus im Schulpark für ein paar Monate im Sommer stehen durfte.
Chronologisch gesehen folgt auf den Familienfilm »Villa Henrietta« die Tragödie »Freigesprochen«. Welche zentrale Frage, welche Prämisse hatte dich da schon länger beschäftigt?
Mich hat das Thema Schuld interessiert. Ob das daran lag, dass ich in einem Land mit starker katholischer Sozialisierung aufgewachsen bin? War es eine Phase mit Abfolgen von schlechtem Gewissen? Ich wollte aber keine didaktische Abhandlung über das Thema Schuld – mit einer routinierten Begründung wie zum Beispiel bei amerikanischen College-Amokläufen, die durch den Konsum von Videospielen oder Heavy-Metal-Musik entschuldet werden. Man will oft nicht wahrnehmen, dass Menschen etwas »einfach nur so« machen.
Ich kam beim Thema Schuld nicht weiter. Erst als ich im Burgtheater das Stück »Der jüngste Tag« von Ödön von Horvarth gesehen hatte, fand ich meinen Filmstoff. Die Synopsis: Ein Bahnwärter wird beim Stellen von Signalen von einem jungen Mädchen abgelenkt. Dadurch entgleist ein Zug und unzählige Menschen sterben bei dem Unfall.
Dann ging es an die dramaturgische Arbeit, wobei Ödön von Horvarth ein Großmeister der Dramaturgie ist. Ich stellte mir die Fragen: Wie transportiere ich diese Theater-Geschichte ins Heute einer filmischen Adaption, ohne die Strukturen zu sehr zu zerstören? Ist es anachronistisch, einen Fahrdienstleiter diesen Fehler begehen zu lassen – 80 Jahre nachdem Horvarth das Stück geschrieben hat? In Gesprächen mit Fahrdienstleitern sterben jedes Jahr allein in Österreich immer noch mindestens zwanzig Menschen an Bahnübergängen – ohne die Suizidfälle mitzurechnen.

Die Erzähltechniken beim Filmemachen, aber natürlich auch im Theater, basieren auf Prinzipien, die schon Aristoteles beschrieben hat. Erfahrungswerte und gewisses Erfahrungswissen wird ein filmemachender Mensch auch in Zukunft nicht an die gehypte AI übertragen können, oder?
Ich finde das Kompositum »Künstliche Intelligenz«, die Kombination der beiden Wörter, extrem unsauber. Es wird sich leider nicht mehr löschen lassen. Es gibt ja auch den sozialpsychologischen Begriff der »emotionalen Intelligenz«, der total wertvoll ist.
Über gewisse Entwicklungen bin ich dankbar, auch wenn sie mir zu langsam gehen. Dadurch, dass mittlerweile schon sieben oder acht Generationen mit Film und Informationen und Emotionen in Form von bewegten Bildern aufgewachsen und sozialisiert wurden, haben sich unsere Sehgewohnheiten und die emotionale Wahrnehmung so verändert, dass wir manche Sachen nicht mehr komplett auserzählen müssen. Ich nehme ein Beispiel aus einem Bereich Romantic Comedy. Beim Auftritt der beiden Protagonist*innen weiß ich schon: Am Ende werden sie sich kriegen. 90 Minuten lang werden sie in irgendeiner Form ihre Differenzen ausleben. Es ist nicht mehr leicht möglich, solche Geschichten ganz langsam aufzubauen, denn dann schreibt der erste Kritiker schon etwas im Sinne von »Erwartbare Handlung, wenig Überraschung…«
Aber ich finde es durchaus erfrischend, dass wir nun – gerade im künstlerisch orientierten Bereich – manche Sachen einfach voraussetzen können. Film ist als Massenmedium im Vergleich zu anderen Kunst-Medien noch nicht so alt. Denken wir an die Massenpaniken der allerersten Filmvorführungen: die Menschen sind aus dem Kino gelaufen, als der fahrende Zug »auf die Leinwand zugekommen ist«. Die Menschen hatten einfach die in dieser Art der Wahrnehmung vorausgesetzte Abstraktionsfähigkeit noch nicht. Und damit publikumsorientierte Filme heutzutage breiter verstanden werden, müssen immer noch die klassischen Erzähl-Mechanismen bedient werden.
Diverse soziale Medien sind Bewegtbild-Plattformen, die (Selbst-)Inszenierungen aller Art disseminieren. Auf der Suche nach Intimität zerstören wir sie aber auch wieder. Wir leuchten bis ins letzte Eck unsere Sehnsüchte selbst aus. Exklusivität und auch die Magie und das Geheimnisvolle gehen dabei verloren. Im Film und auch auf Theaterbühnen finde ich es inspirierend, wenn gute Schauspieler*innen wie moderne Schamane*innen mit einer gewissen, unerklärlichen Ausstrahlung faszinieren.
Ich höre immer wieder von internationalen Kolleg*innen: Du musst das Publikum innerhalb der ersten zwei Minuten in Bann ziehen, sonst sind sie quasi aufmerksamkeitstechnisch »weg«. Und ja, ich muss mich mit diesen Tendenzen auseinandersetzen, wenn ich Kinofilme produzieren will. Aber auch das Sich-Zeit-Lassen muss möglich sein, ich glaube an das Beste mehrerer Ebenen. Im Film geht es auch immer darum, Fragen zu stellen. Dadurch wird einem interessierten Publikum nicht fad. Ein Film entsteht immer vier Mal: beim Schreiben, beim Produzieren, beim Schneiden und bei der Projektion. Die entscheidende vierte Phase eines Films ist die der Interaktion zwischen Leinwand-Projektion und Publikum. Und diese Entstehungsebene kann ich nicht mehr steuern. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass Filme aus allen Bereichen ein großes Publikum erreichen, damit immer wieder neue Elemente des Erzählens erfahren werden können. Das wäre für mich eine ideale Symbiose einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die durch Kurzvideos in Social Media konditioniert wird, mit einem tiefergehenden Erzählen anhand von interessanten Fragestellungen.
Im Buch »Der Publikumsvertrag« weist der deutsche Filmproduzent Roland Zag auf die Bedeutung der emotionalen Resonanz für Zuschauer*innen hin. Wie können denn Zuseher*innen Empathie für filmische Figuren entwickeln?
Zuseher*innen haben ja nicht die Pflicht, dass er*sie dramaturgische Begriffe beim Filmschauen anwendet. Aber sie werden mit Figuren mitgehen, deren Aktionen sie nachvollziehen können oder sie neugierig machen. Sympathie ist vordergründig gar nicht wichtig – es geht vor allem um empathisches Verstehenwollen. Warum schaue ich mir mit einer gewissen Neugier und Anspannung einem Film an? Dieser Frage geht der Publikumsvertrag auf den Grund.

Du hast als erfahrener Filmemacher ein feines Sensorium bzw. Analyse-Werkzeug zur Beurteilung von »zwingenden« Filmen, also von Filmen, die du als gelungen ansiehst. Wie siehst du die Kür von »besten« Filmen, diese Ranking-Systeme und simple Beurteilungskategorien?
Dieses Bemessen von Dingen und diese Ranking-Systeme haben wir Menschen anscheinend in uns drinnen. Ich finde aber Filmkritiker*innen, die mit »Daumen rauf« oder »runter« oder bloß mit Sternen bewerten total öde. Wenn ihnen nicht gelingt, einen Film so zu beschreiben, dass ich auf dieser Basis meine eigenen Entscheidungen treffen kann; wenn ihnen das mit kulturhistorischem Wissen und Schreibhandwerk nicht gelingt, dann finde ich, habe diese Kritiker*innen ihren Beruf verfehlt. Aber leider kommt fast kein (soziales) Medium mehr ohne diese besch… Ranking-Systeme aus.
Wir sind nun schon »Am Ende des Tages«, zumindest chronologisch betrachtet, was deine Kinofilme betrifft. Mir fällt auf, dass mit Ausnahme von diesem Film, immer wieder tote Menschen in Form von Geistern wiedererscheinen. Ist dir das bewusst?
Aber auch die Rolle der Manuela (Anm.: in »Am Ende des Tages«) könnte man als eine solche bezeichnen. Nicholas Ofczarek verkörpert eine Figur, die in einer Phase der Konfrontation seinem Gegenüber in Verkleidung als seine jüngere, getötete Schwester erscheint.
Aber ehrlich gesagt, ich stehe gar nicht so auf Geistererscheinungen in Filmen. Es passiert mir einfach beim Drehbuch-Schreiben. Das zieht sich durch meine Werke durch, ich kann es nicht leugnen. Aber ich finde es interessanter, wenn wir nicht nur das Hier-und-Jetzt, übertragen in eine kompakte Zeiteinheit, miterleben – sondern auch das Vor- und Nachleben von (Haupt-)Figuren. Und warum wir das oft als skurril oder komisch wahrnehmen? Das ist vermutlich ein psychischer Schutzmechanismus.
Von der Psyche der Filmeschauenden zur Physis der Filmemachenden: Beim Drehbuch-Schreiben kommen für dich Bauch & Herz und Hand & Hirn in unterschiedlichen Phasen zum Einsatz. Kannst du das etwas erläutern?
Was will ich erzählen? Das ist eine emotionale Fragestellung. Eine Idee, die Konzeption einer zentralen Frage und Prämisse, steht bei mir am Anfang der Filmentwicklung. In dieser Phase kommen vor allem Bauch und Herz zum Einsatz. Dann kommt die Knochenarbeit von Hirn und Hand beim Treatment, den Outlines und dem finalen Drehbuch. Ich schreibe nie für bestimmte Personen und Schauspieler*innen oder ausgehend von nur einer Szene, die ich schon davor im Kopf habe.
Man könnte die Schaulust des Menschen auch pathologisieren, wie zum Beispiel Otto Fenchel, ein österreichischer Psychoanalytiker der zweiten Generation mit der sogenannten Scopophilie. Wie erklärst du dir die (ästhetische) Befriedigung beim Betrachten von Objekten und Personen?
Unabhängig von der Filmwahrnehmung als Macher oder als Konsument empfinde ich das Schauen als eine – durchaus anstrengende – hochaktive Tätigkeit. Daraus haben sich auch verschieden Zugänge entwickelt. Die Grün- und Blautöne in meinen Filmen werden manchmal als kalt empfunden. Aber wer gibt diese soziokulturelle Deutung als emotionale Kälte vor?
Man kann graue oder blaue Tönungen genauso gut als eine Idee der Tiefe empfinden.
Genau. Als kalt empfinde ich zum Beispiel Neon-Töne.
»Glück gehabt« war 2019 deine letzte Produktion fürs Kino. Woran arbeitest du gerade?
Ein Spin-Off von »MA 2412« mit den Protagonisten Weber und Breitfuss. Die Vorbereitungen laufen intensiv, gedreht wird im Juni. (Anm. Das Interview fand im April statt.) Es geht ganz gut voran. Für das Kino plane ich einen Horror-Film mit der zentralen Frage: Wie weit kann Elternliebe gehen? Das Drehbuch, gemeinsam geschrieben mit Antonio Fian, ist mehr oder weniger fertig. Dann arbeite ich noch an einem Familiendrama. In Wirklichkeit ist fast jede Geschichte ein Familiendrama. Denn eine Komödie ist ja auch ein Drama, im Sinne einer dramatischen Handlung, nur eben mit einem anderen Ende als eine Tragödie. Übrigens zum Thema dramaturgische Verstrickungen und Knoten: »to plot« ist ja eigentlich ein Zeitwort. Man müsste mal eine*n Anglizist*in fragen, ob es »plot« als Hauptwort schon vor 1850 – vor der Produktion von Filmen gab.