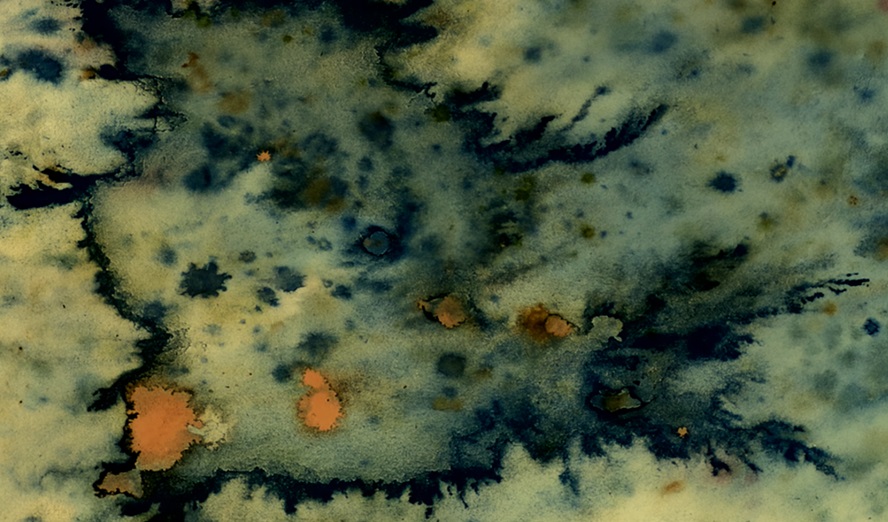Wenn aus der akuten Gegenwart Wochen und Monate werden, denkt es sich schwer in die weitere Ferne. Eindrücke und Ahnungen begleiten uns aber alle. Immerhin betrifft uns diese Pandemie selbst dann, wenn sie uns nicht betrifft. Die Spätfolgen sind ungewiss. skug hat mit sechs Personen (sämtliche Namen wurden von der Redaktion geändert) gesprochen und sie gefragt, wie sie ihr neues, altes Leben wahrnehmen, wie sie Beruf und Alltag meistern und mit welchen Gefühlen sie in die Zukunft blicken.
Aus dem Heimurlaub in die Traufe
»Langsam wird’s schal.« Die 27-jährige Romina G. aus Linz blickt kurz nach unten. Im März sei das Ganze noch neu und aufregend gewesen. »Wir gehen in Quarantäne. Das war fast abenteuerlich. Ich wohne in einer WG. Da ist so etwas wie ein neuer Gemeinschaftsgeist entstanden, als würden wir Urlaub daheim machen.« Die Sozialarbeiterin hatte gerade ihren Job gekündigt. Lange habe sie mit sich gerungen, aber sich zuletzt nicht mehr wohl gefühlt. Die neu gewonnene Zeit habe sie für sich genützt. »Im März war ja so etwas wie eine allgemeine Übereinkunft: Wir fahren jetzt runter.« Davon konnte Romina G. profitieren. »Dass ich da privilegiert bin, weiß ich«, sagt sie. Jetzt, Ende November, sei die Lage schon anders. »Jeder bei uns hat viel zu tun, der Arbeitsalltag ist da, aber am Abend kommst du nirgends hin und niemand kommt zu dir. Dann isst man halt und sieht fern. Man ist jetzt viel isolierter. Die Motivation, okay, wir machen was gemeinsam, ist nicht mehr da.« Beim ersten Lockdown habe sie das Beste draus gemacht. Damals habe sie gedacht, das gehe auch wieder vorbei. Dann aber sei der zweite Lockdown gekommen. An dieser Stelle wird die Linzerin zögerlicher: »Im Hinterkopf ist immer der Gedanke, wahrscheinlich kommt noch ein dritter. Klar heißt es, es werden Impfungen gemacht, aber irgendwie bin ich da weniger zuversichtlich.« Neben ihrem Beruf macht Romina G. eine Ausbildung zur Psychotherapeutin. Ihre Seminare mussten Corona-bedingt vertagt werden. »Da frage ich mich: Verschoben? Bis wann?« Mit der Bundesregierung ist sie nachsichtig. »Wir haben sowas ja echt noch nie gehabt und wahrscheinlich hanteln sich alle gerade von Woche zu Woche.« Allerdings, das müsse sie zugeben, verfolge sie die Nachrichten kaum noch und das sei wirklich neu für sie. Normalerweise gehöre sie zu jenen, die sich gerne informieren. »Wenn ich jetzt Zeitung lese – oft scrolle ich nur noch durch die Headlines – dann denke ich mir: Was gibt es sonst noch, außer Corona?«
Von Psychologinnen an der Kassa
Irene W., Filialleiterin eines kleinen Supermarktes im Bezirk Amstetten, spürt deutlicheren Unmut: »Die Kundinnen und Kunden sind verärgert.« Speziell unter den Eltern sei das Stresslevel mittlerweile sehr hoch. Beim ersten Lockdown sei noch mehr Angst dagewesen. Freilich habe sie nach wie vor Kund*innen, die bewusst größer einkaufen, um Wege zu vermeiden. Typische Vorratslebensmittel wie Germ, Nudeln oder Klopapier seien weiterhin gefragt. »Die Leute wissen ja nicht, ob es noch schlimmer wird«, meint sie. Für die Menschen, die zu ihr kommen, ist die Nahversorgerin eine liebgewonnene Gesprächspartnerin geworden. »Kunden wollen vermehrt reden mit dir. Man merkt das schon und beschäftigt die halt ein bisschen. Wir sind schon ein bisschen auch Psychologen an der Kassa. Die Oma trifft ihr Enkerl nicht mehr, nur mehr telefonieren, und dann spricht sie halt mit dir.« Gerade für die älteren Menschen sei das alles sehr hart. »Die Leute vom betreuten Wohnen um die Ecke, die kommen jetzt fast zwei Mal am Tag und dabei kriegen die Essen auf Rädern. So typische Lebensmittel bräuchten die gar nicht.« Auch Menschen mit Kindern kämen oft täglich. »Die nehmen das als Spaziergang, um mal rauszukommen.« Von Seiten der Bundesregierung hätte Irene W. sich mehr Unterstützung erhofft. Umsatzeinbußen bekomme sie kaum zu spüren, dennoch würde sie ihren Angestellten gerne Prämien ausbezahlen. Sie und ihre Mitarbeiterinnen hätten zwar keine Angst, oft frage sie sich aber schon: »Was ist, wenn mir jemand krank wird? Dann kann ich mein Geschäft nicht mehr führen.« Die Niederösterreicherin ist neben ihrer Verkaufstätigkeit in der Regionalpolitik aktiv. Die dort entstandene Mentalität gefällt ihr nicht. »Wer ist die bessere Gemeinde, wer hat die niedrigeren Zahlen? So geht das.« Irene W. schüttelt den Kopf. Im öffentlichen Diskurs hätte sie gerne mehr Fachmeinungen aus der Wissenschaft gehört. »Dieses tägliche Sich-Zeigen der Bundesregierung und immer wieder ihre Statements. Da hätte ich mir Virologen oder Biologen gewünscht.« Auf die Frage, wie es im Frühjahr weitergeht und ob sie an eine Impfung glaubt, reagiert sie entschlossen: »Organisatorisch kriegen wir das sicher nicht hin.« Auch wisse sie nicht, ob sie unter den Ersten sein werde, die sich impfen lassen. »Ich bin jetzt keine typische Impfgegnerin, aber ich bin schon … ja, skeptisch. Wenn man schaut, wie lange Impfstoffe sonst getestet werden und jetzt so schnell … Ich weiß nicht.« Über eines ist sie dennoch froh: »Mich werden sie zum Glück nie zusperren. Ich bin Lebensmittelhändlerin und Postpartnerin. Das wird immer gebraucht werden.«
Der ganz normale Alltag
Bei ihm sei nicht viel anders als sonst, sagt Thomas G., Kfz-Techniker im oberösterreichischen Steyr. Die Arbeit laufe normal weiter und durch seine beiden Söhne im Alter von 3 und 5 Jahren wäre er auch ohne Corona nicht viel unterwegs. Seine Hobbys, vor allem das Hand- und Heimwerken, betreibt er im eigenen Haus. Sein älterer Sohn musste während des zweiten Lockdowns in Quarantäne, weil sich seine Kindergartenbetreuerin mit dem Virus infiziert hatte. »Da muss man sich dann schon was überlegen.« Sowohl Thomas G. als auch seine Frau sind voll berufstätig. Für die eine Woche habe er sich freigenommen, das sei nicht das große Problem gewesen. Wenn sowas aber länger andauert, dann müsste der gelernte Mechaniker auf seinen Pflegeurlaub zurückgreifen. An seinem Arbeitsplatz sei die Stimmung gut. Man mache Witze über die Pandemie. Nur, dass man sich nicht mehr die Hand geben darf, sei nach wie vor einschneidend. »Für manche Kollegen war das wirklich schwierig«, sagt Thomas G. Ansonst habe er den Eindruck, dass sich die meisten mit den Maßnahmen arrangiert hätten. »Bei uns in der Firma wird die Krankheit heute ernster genommen als im März«, meint er. Selbst müsse er Corona nicht haben, wenn es sich vermeiden lässt. »Man hört ja immer, dass die Verläufe ganz unterschiedlich sind.« Trotzdem mache er sich um seine Gesundheit wenig Sorgen. In die Zukunft blickt er mit gemischten Gefühlen: »Alle reden von einer Wirtschaftskrise. Da habe ich schon richtige Horrorszenarien gehört.« Nachrichten verfolgt auch er kaum noch. »Die Zahlen sehe ich mir schon an, so ist es nicht … Aber sonst … Das verunsichert einen nur.«
Sehnsucht nach dem alten Leben
Anders gestaltet sich der Alltag für Lara H. Die Wienerin pflegt den Großteil ihrer sozialen Kontakte außerhalb der eigenen vier Wände. Ihr Leben, ihre Hobbys vor der Pandemie fehlen ihr. Darüber hinaus hat sie mit existenziellen Sorgen zu kämpfen. Die 26-Jährige ist arbeitslos. Wie schwer die Jobsuche im Moment ist, weiß sie aus eigener Erfahrung. »Da denkt man natürlich nach.« Als Transfrau sollte sie regelmäßig zur endokrinologischen Untersuchung, aber die Termine werden verschoben. Erschwerend kommt hinzu, dass sie an einem Gehirntumor leidet. Der Tumor sei zwar gutartig und sie nehme regelmäßig Medikamente, richtig wohl fühle sie sich ohne ärztliche Kontrollen aber nicht. Auf Nachrichten zum Thema Covid reagiere sie mittlerweile abgestumpft. Da habe sich bei ihr, wie bei anderen, ein gewisser Gewöhnungseffekt eingestellt. Obwohl Lara H. der Bundesregierung kein gutes Zeugnis ausstellt, blicke sie optimistisch ins Frühjahr. Dass das mit der Impfung klappt, glaubt sie auf jeden Fall.
»Ich kann das noch eine Zeit aushalten«
Auch Antonia B., Ärztin auf der Unfallchirurgie in Graz, blickt sehnsüchtig Richtung Jänner. Dass es bald eine Impfung geben wird, freut sie. Ihr Arbeitsalltag sei durch die Pandemie natürlich ein anderer geworden. »Niemand weiß, ob er oder sie am nächsten Tag 8 Stunden oder doch 12 oder 24 Stunden arbeiten wird«, sagt sie. Die Ungewissheit, ob wieder jemand erkrankt ist unter den Kolleg*innen, belaste die Belegschaft. Man wisse nie genau, ob Dienste neu besetzt werden müssen oder nicht. Im persönlichen Umgang mit dem Virus ist bei der Chirurgin dagegen Routine eingekehrt. »Im März war Katastrophenstimmung. Ich war jedem böse, der die Lockdown-Bestimmungen auch nur ein bisschen ausgereizt hat. Da war ein Supermarktbesuch schon fast eine Reise zum Mars.« Mittlerweile sehe sie die Sache realistischer. »Rein infektiologisch hätte mir auch schon im März klar sein können, dass dich nicht alles, was an dir vorbeihuscht, anstecken kann.« Damals habe sie noch regelmäßig Nachrichten konsumiert. Heute ist es nur noch ein kurzes Zahlenchecken. Außer was die Impfung betrifft, da verfolge sie die Entwicklungen mit Freude. Im ersten Lockdown sei es vor allem der physische Kontakt zu ihren Freund*innen gewesen, der Antonia B. gefehlt habe. Obwohl sie die Zeit zu Hause mit ihrem Partner verbrachte, habe sie sich damals häufig einsam gefühlt. Seit dem zweiten Lockdown habe sich das aber verändert: »Diesmal vermisse ich die körperliche Nähe zu anderen nicht so wesentlich, da man sich im Sommer ohnehin zaghaft verhalten hat. Irgendwie sind wir da reingewachsen, kommt mir vor.« Wann alles wieder »normal« sein wird, weiß sie nicht. »Was heißt schon normal?«, fragt sie, »intermittierend Lockdown mit den verschiedensten Beschränkungen? Ich wünsche es mir nicht, aber ich weiß, ich kann das noch eine Zeit aushalten. Und wenn man erst in fünf Jahren wieder in alle Länder verreisen kann, so what?! Die Welt braucht das momentan auch.«
Die Rollen der Krise
Felix B. ist Literaturwissenschaftler an der Universität Salzburg. Am Arbeitsplatz nimmt er Katerstimmung wahr. »Langsam setzt sich die Gewissheit durch, dass uns da einige Dinge bleiben werden.« Konkret denkt der 43-Jährige an die Online-Lehre. »Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die pendeln. Da wird es bestimmt eine Lobby geben, die sagt, okay, warum können wir nicht weiter Lehrveranstaltungen von zu Hause machen?« Das klassische Universitätssetting, den vollbesetzten Seminarraum, sieht er derzeit nicht. »Ich glaube, dass es Elemente des Social Distancing gibt, die wir schwer wieder rauskriegen.« Die digitale Lehre betrachtet er aber auch positiv: »Grundsätzlich funktionieren die Lehrveranstaltungen überraschend gut.« Manches möchte er sich für die Zukunft mitnehmen: »Die offene Plenumsdiskussion funktioniert hier selten. Man muss die Leute anders hereinholen.« In der Vergangenheit habe er mehrmals beobachtet, wie durch den sozialen Druck im Plenum eine Art frühe Selektion unter den Studierenden einsetzt. Relativ früh zeichne sich so ab, wer an Gesprächen teilnimmt und wer sich auch in Zukunft weiter interessiert. Die Online-Lehre habe ihm gezeigt, dass man darauf aber aktiv Einfluss nehmen könne. Privat sorgt sich der Familienvater vor allem um die Zukunft seiner Kinder. »Wir steuern ja auf eine große Wirtschaftskrise zu. Da frage ich mich, wie die das zu schultern haben werden.« Gerade die breitere Bildung sieht er in Bedrängnis. »Im Grunde«, überlegt Felix B., sei die aktuelle Krise »ja das Worst-Case-Szenario eines Neoliberalen, weil der Staat sowieso alles stützt, aber danach kann es gut sein, dass die großen Austeritätspakete kommen.« Der Bildungsbereich sei davon meist besonders betroffen. Beruflich und privat gelte man mittlerweile rasch als Spielverderber, wenn man die Corona-Regelungen befolge. »Die Gesellschaft begibt sich ja nicht geschlossen plötzlich in einen anderen Modus.« Täglich müsse man neue Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die jeder für sich trifft, und Entscheidungen, die jeder anders trifft. »Freilich, die Regeln sind grundsätzlich imaginär, nicht jede Regel macht in jeder Situation Sinn, aber man hält sich dran, weil es nichts Besseres gibt.« Corona sei auch eine Bühne. Immer wieder trifft der Universitätsprofessor Kolleg*innen, die einen eher laxen Umgang mit den Vorschriften an den Tag legen. »Da habe ich den Eindruck, das passiert nicht, sondern das ist eine gewollte Positionierung.« Felix B. denkt an seinen Arbeitsalltag. So mancher schlüpfe da gerne in die Rolle des Provokateurs und das sei »wahnsinnig mühsam«. In der medialen Öffentlichkeit sind ihm in Österreich zu viele Politiker und zu wenige Virologen am Werk. »Aber«, gibt er zu bedenken: »Corona ist eben auch dort eine Bühne.«