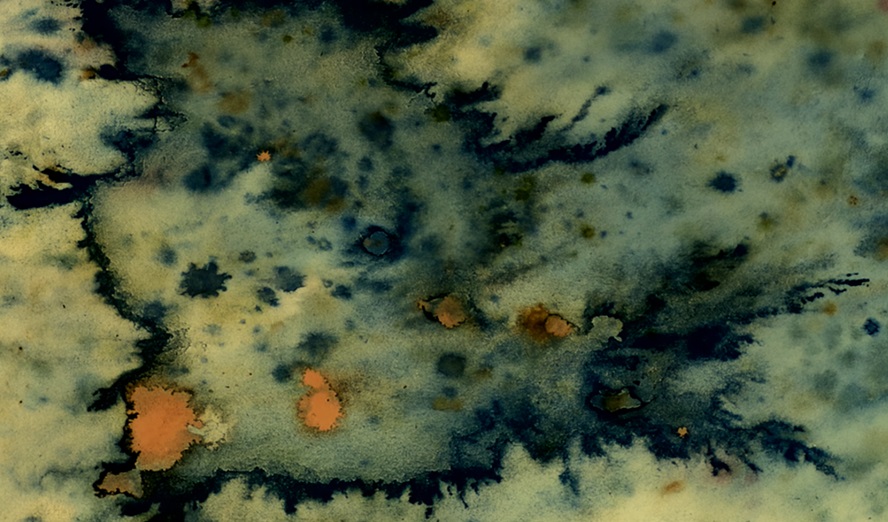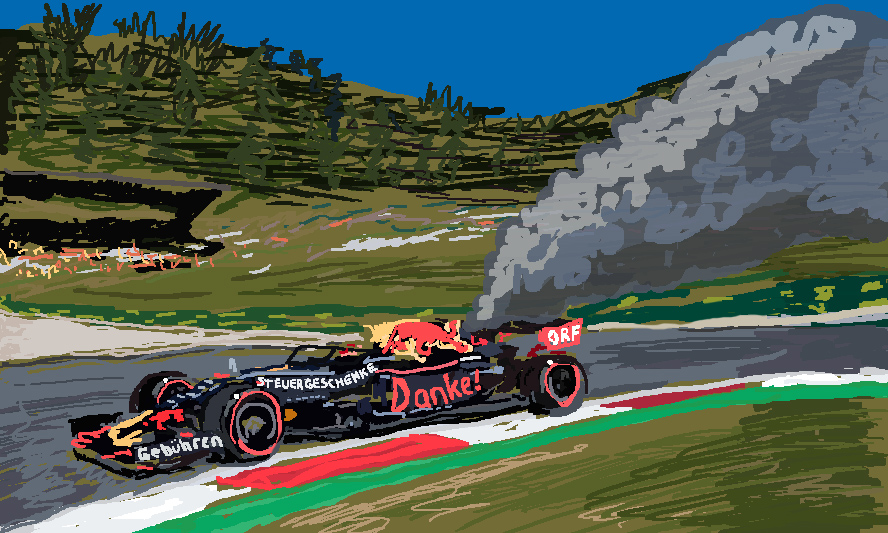Das Jahr 2023 zeichnete sich durch ein ambivalentes Verhältnis zur Gewalt aus. Schwelende, auflodernde und nicht ausbrennen wollende kriegerische Konflikte bestimmen bis heute die internationale Medien- und Politiklandschaft. Wir waren mit Angriffen auf friedliche Klimaproteste konfrontiert, wohingegen das öffentliche Interesse an der verschärften mörderischen Migrationspolitik im Mittelmeerraum nahezu erloschen schien. Auf der Suche nach einer inklusiven und gerechten Gesellschaft fanden wir mehr und mehr Möglichkeiten, um Gewalt und Diskriminierung zu beschreiben und dafür zu sensibilisieren. Dies bringt im gleichen Atemzug nicht wenige zur Weißglut, die sich ihr verletzendes Verhalten nicht eingestehen können oder wollen. Jeder gute und wichtige Schritt, den wir im Umgang mit Gewalt unternehmen, wird von zwei Rückschritten an anderer Stelle begleitet. Und nicht selten versagen uns dabei die Worte.
Das Fehlen der richtigen Worte im Angesicht vielgestaltiger Gewalt ist nicht nur eine wichtige Motivation für Kulturschaffende innerhalb von Theater, Musik, Film und Literatur. Es stellt auch eine Herausforderung für die Personen dar, welche sich wissenschaftlich mit dem Phänomen beschäftigen. Ihr stellen sich neun junge Philosoph*innen aus Wien am 11. und 12. Jänner 2024 im NIG der Universität Wien auf der Konferenz »Den Finger in die Wunde legen – Kritische Phänomenologien der Gewalt«. Initiiert hat das Michael Staudigl, Dozent am Wiener Institut für Philosophie und Koryphäe der philosophischen Gewaltforschung. Doch die Idee stammt von Studierenden. Im Gespräch berichtet Staudigl, dass jene den Wunsch geäußert hätten, ihre Überlegungen breiter zu diskutieren. Staudigl unterstützte das. Denn: »Philosophie passiert nicht nur im Seminarraum – sondern überall, wo Diskurs stattfindet.«
Nicht bloß für Akademiker*innen
Für Staudigl bedeutet das zunächst, auch Perspektiven von Nicht-Philosoph*innen miteinzubeziehen. Diese könnten akademische Debatten bereichern. Wir alle müssen uns mit Gewalt auseinandersetzen, allein schon, weil wir über Medien mit ihr zu tun haben. Staudigl argumentiert: »Auch wenn man Gewalt leugnet oder ignoriert, irgendwie ist man damit in Berührung. Doch die Auseinandersetzung mit Gewalt ist bei akademischen Philosoph*innen wenig kultiviert. Menschen aus prekären Existenzformen haben oft andere Sensibilitäten dafür, was Gewalt ausmacht. Deshalb«, führt er aus, »braucht es einen breiten Zugang – und der kann nicht nur von der akademischen Philosophie ausgehen.«
Doch warum sollte man über Gewalt philosophieren? Genügt es nicht, festzustellen, wie schrecklich sie ist? Staudigl sieht hier einen Fallstrick. »Medien berichten über Gewalt oft alarmistisch. Andererseits ist man indifferent.« Verdammung und Normalisierung von Gewalt beschreibt er wie zwei Seiten derselben Münze. Hier liege die Chance einer Philosophie der Gewalt: »Gewalt ist durch und durch ambivalent. Diese Ambivalenzen muss man wahrnehmen lernen – um sie nicht dort, wo die Dinge eskalieren, einseitig zu skandalisieren oder zu instrumentalisieren. Uns geht es darum, zu sehen: Gewalt ist Teil der sozialen Welt, Teil politischer Vorstellungsräume und Teil unserer ›social imaginaries‹.«
Verflechtungen sichtbar machen
Um sich in diesem Blick zu üben, greifen Staudigl und seine Studierenden auf die Phänomenologie zurück. Es handelt sich um eine philosophische Schule, die Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist. »Phänomenologie ist der Versuch, zu überlegen, wie die Erfahrungen, die wir machen, Gestalt gewinnen. Wie wir bleibende Wahrnehmungen, bleibende Erfahrungszusammenhänge schaffen.« Anders als sozialwissenschaftliche Gewaltforschung versucht Phänomenologie also nicht, Gewalterfahrungen statistisch zu erfassen und objektiv beschreiben. Sie begibt sich nicht auf eine Jagd nach Ursachen, um dann »Lösungen« für dieses »Problem« zu verfügen. Sie fragt vielmehr, wie solche Erfahrungen überhaupt zustande kommen. Dabei »geht sie davon aus, dass wir dafür nichts naturalisieren dürfen.«
Dies unterscheidet die Phänomenologie von der Neurowissenschaft. Sie legt keine Gewaltopfer unter einen CRT-Scanner und erhebt deren Daten. »Vielmehr müssen wir uns fragen, wie es uns gelingt, solche Erfahrungen zu machen«, führt Staudigl aus. So könne sie Folgendes zeigen: »Die Art, wie ich meine Weltbilder interpretiere, ist immer schon von grundlegenden Verstrickungen abhängig. Sie sind mir auf den Leib geschrieben, in das ›kulturelle Unbewusste‹ eingesenkt. Die Phänomenologie kann das ans Tageslicht bringen. Sie macht Verflechtungen sichtbar – darin liegt ein kritischer Impuls.«
Kritische Blicke, thematische Vielfalt
Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann dies am 11. und 12. Jänner 2024 im Neuen Institutsgebäude der Universität Wien tun. Die Konferenz ist für alle Interessierten offen und kostenfrei zugänglich. Den Studierenden stehen mit Claudia Brunner, Pascal Delhom und Gerald Posselt drei renommierte Gewaltforscher*innen zur Seite. Dazu haben die Organisator*innen ein buntes Programm zusammengestellt. Im Fokus stehen die politischen und gesellschaftlichen Aspekte von Gewalt. Neben Farb-Rassismus und Kolonialismus, weiteren extremen Gewalterfahrungen und Folgen wie politischer Radikalisierung kommen dabei auch subtilere Aspekte zu Wort, wie das verstörende Lächeln der Täter oder psychologische Folgen von ungreifbarer Gewalt, wie bspw. der Depression. Auch »tradierte« philosophische Ansätze sollen nicht zu kurz kommen. Fragen des normativen Anspruchs und der Rechtfertigung der Gewalt sind ebenso Thema wie die schwierige Unterscheidung und die Verhältnismäßigkeit von körperlicher, sprachlicher und struktureller Gewalt.
Ein neuer Ansatz? Michael Staudigl ist jedenfalls von seinen Studierenden überzeugt: »Das soll nicht einfach für die Schublade sein. Wir müssen das einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.«

Anm. der Redaktion: Georg Harfensteller ist studentischer Ko-Organisator der Graduiertenkonferenz. Dieser Text ist in Zusammenarbeit mit ihm entstanden.
Link: https://phaenomenologie.univie.ac.at/forschung/graduiertenkonferenz-den-finger-in-die-wunde-legen/