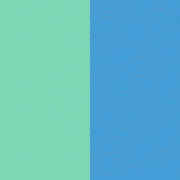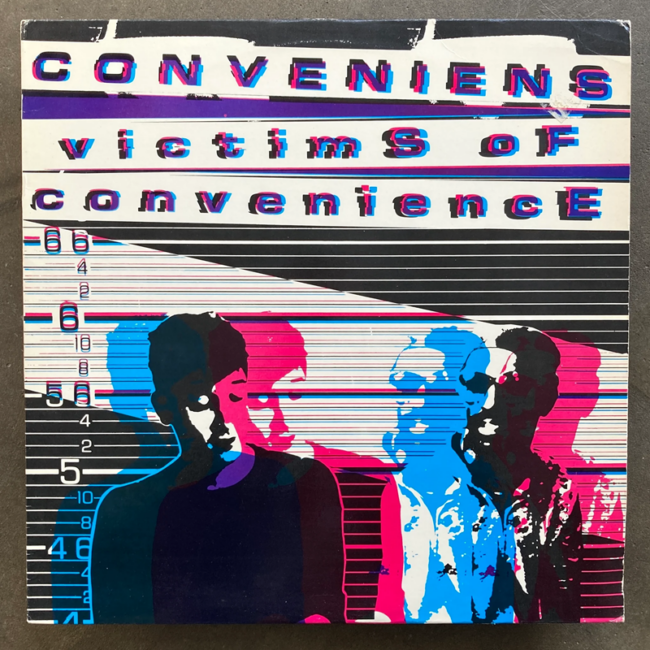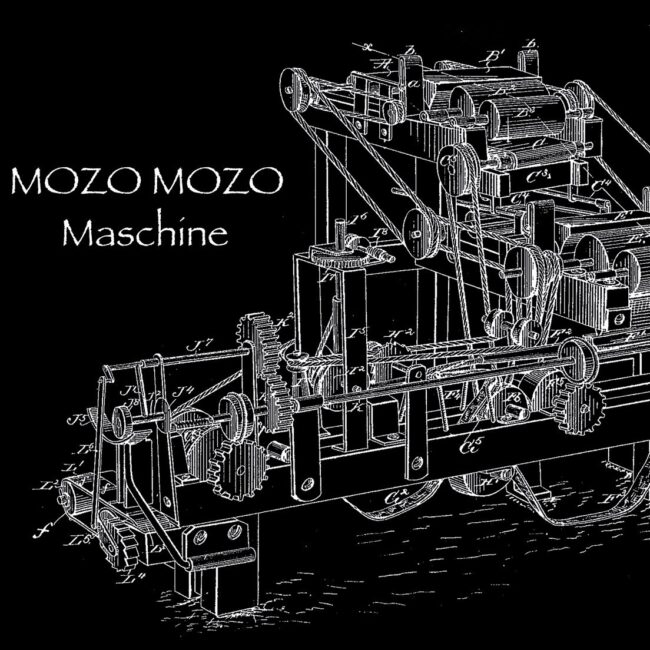Als in den frühen 1990ern mit reichlich Hardcore sozialisierte Person widersetzt sich mir der Titel von Lana Del Reys neuem Album insofern, als ich ihn permanent falsch als »Powerviolence« im Kopf habe. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehen mag – ganz so abwegig ist diese Fehlleistung nicht. Schließlich punkten auch Del Reys musikalische Gewalttätigkeiten mit Stop-And-Go-Songwriting, reichlich naiv zur Schau gestellter Genussgruppen-Zugehörigkeit sowie dem unbedingten Willen zu Pathos und der großen Geste – »Hotel California«-Reminiszenzen (»Pretty When You Cry«) inklusive. Wahrscheinlich ist »Ultraviolence« gerade deswegen eine richtig gute Genre-Platte. Exploitation-Tearjerk! Die hölzerne Persona Lana Del Rey, zusammen mit verstörenden Absagen an feministische Kritik an den bestehenden Geschlechterverhältnissen im Pop, passt hier selbstverständlich wie die vielbemühte Faust aufs Auge. Del Reys morbides Universum aus geistesgestörten Sängerinnen, die reichen alten Säcken verfallen sind, ist schließlich kein Gender-Studies-101-Diskursparcours. Hier artikuliert sich vielmehr eine ultimativ schwelgerische Absage an das Anal-Retentive – was »Ultraviolence« nicht zu guter Politik macht, aber immerhin zu einem wirklich beeindruckenden musikalischen Exzess in Langsamkeit und Kanarienvogel-Trills, der in der gegenwärtigen Kommerzpoplandschaft seinesgleichen sucht. Mit verhallten Gitarren. Just sayin‘.

Lana Del Rey
»Ultraviolence«
Polydor
Text
Ana Threat
Veröffentlichung
11.11.2014
Schlagwörter
100
Fiction/Polydor/Universal
G-Unit/Interscope
Lana Del Rey

Unterstütze uns mit deiner Spende
skug ist ein unabhängiges Non-Profit-Magazin. Unterstütze unsere journalistische Arbeit mit einer Spende an den Empfänger: Verein zur Förderung von Subkultur, Verwendungszweck: skug Spende, IBAN: AT80 1100 0034 8351 7300, BIC: BKAUATWW, Bank Austria. Vielen Dank!