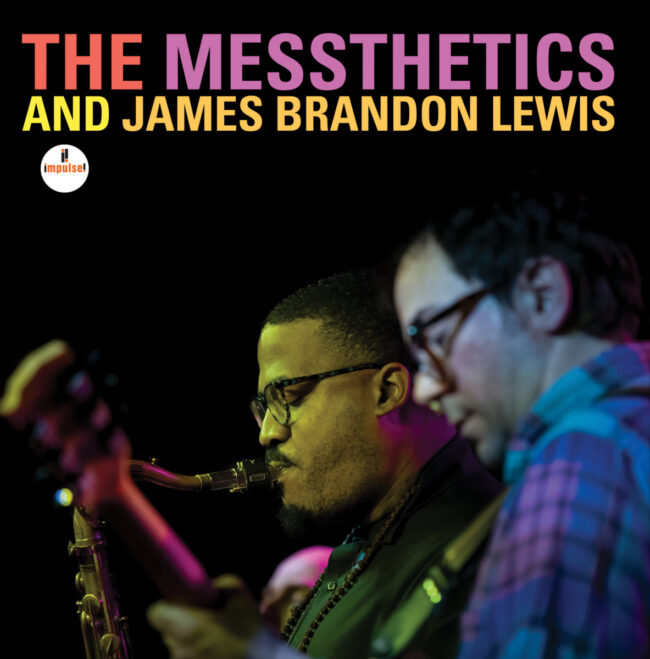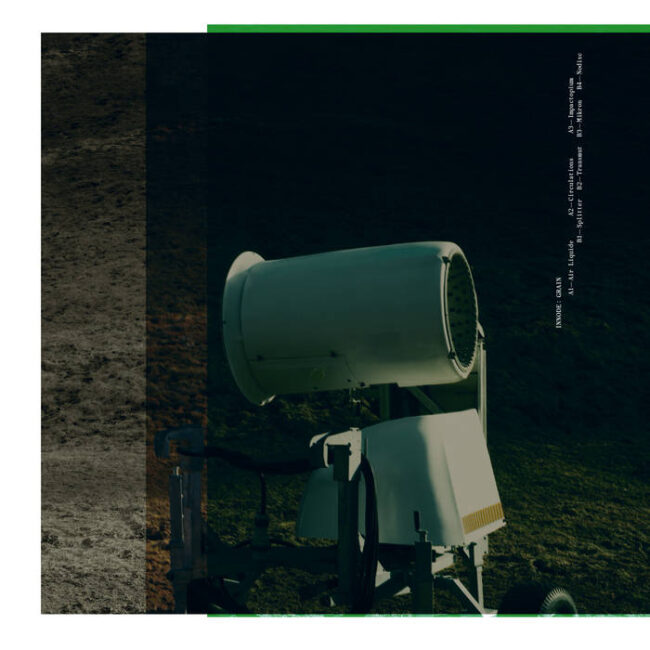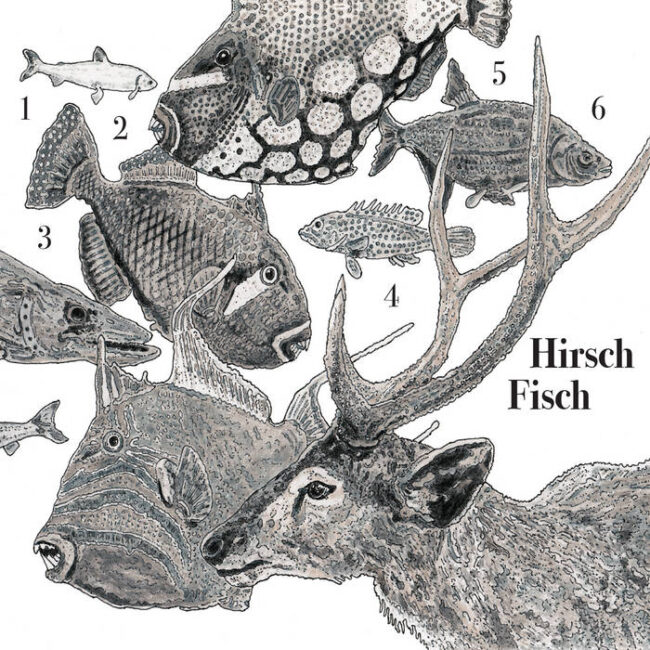Janelle Monaé ist ein »Dirty Computer« und überhaupt nicht bereit, bereinigt zu werden. Das suggerieren Albumtitel und -texte und erst recht der dazugehörige trashig-futuristische Film. Erinnerungen an exzessive Partys und guten Sex machen uns schließlich erst zu Menschen. Ebenjene erfreulichen Nebensachen in unserem Leben haben aber in der auf diesem Album imaginierten, unguten Zukunftswelt keinen Platz mehr. Die vorliegende Platte muss somit als Aufbegehren gegen diese lustfeindliche Gleichmacherei-Dystopie verstanden werden, in der reibungslos funktionierende Robotermenschen erwünschter sind als »dreckige Computer«, die stattdessen den nächsten schnellen Fick im Swimmingpool im Sinn haben. Dabei ist die Platte nicht nur stellenweise ein klein wenig obszön, etwa wenn Monaé zusammen mit Zoë Kravitz davon singt, bei einem Festival in sexueller Hinsicht hart rangenommen werden zu wollen, sondern vor allem auch politisch. Die Pussy, die der bei (schwarzen) Frauen in Amerika eher unbeliebte Donald Trump begrabschen will, grabscht hier einfach kurzerhand zurück. Da passt es auch ins Bild, dass sich Janelle Monáe vor der Albumveröffentlichung als pansexuell geoutet hat. Folglich ist das weibliche Geschlechtsorgan, dem mit dem Song »PYNK« eine schöne Ode zugeeignet wird, mehr als ein begehrtes Ziel für Männer. Es ist vor allem eine weibliche Kampfansage, Lustort für und Begehrenszentrum von Monáe gleichermaßen.
Die Musik zu diesen Diskursen ist überwiegend bunt, lebensfroh und partyaffin. Prince, der in den letzten Jahren als großer Förderer und Freund von Monáe galt, hatte seinen Einfluss auf ebendiese. Es ist insgesamt ein funkiges Gebräu, das keine Angst vor purem Pop, eindringlichen Melodien oder rauen Rap-Passagen hat. Der zum Teil geäußerte Vorwurf, Monáe würde sich zu wenig vom dem prinzenhaften kleinen Mann emanzipieren, geht dabei aber ins Leere. Lediglich ein Song, »Make Me Feel«, könnte gut und gerne theoretisch aus Prince’ Feder stammen. Für die restlichen Songs übernimmt Monáe viel eher seine Haltung der Musik gegenüber. Genregrenzen existieren nicht und die Hooks sind, mit Verlaub, saugeil und werden dennoch auch nach mehrmaligem Hören nicht fade. Es ist eine Pop-Platte, die aber, dank der kompositorischen Brillanz, nicht die Abnützungserscheinungen von herkömmlicher Popmusik aufweist.
»Dirty Computer« darf uns also als Warnung dienen. Wir sollten nicht angepasst, lustlos und weitestgehend sexfrei und/oder mit schlechtem Sex leben. Wir sollten nicht auf den einen oder anderen Exzess verzichten. Wir sollten diese Aufforderungen aber auch nicht mit plattem Hedonismus verwechseln, der im Spätkapitalismus als Kompensationsort sogar erwünscht ist. Es geht um echte Freude, um echte Befreiung einer eingeengten Sexualität und totgeschwiegener sexueller Identitäten und um Partys, die kein Morgen kennen. Wer saufen kann, der kann auch ausschlafen und sich dem strikten Denken in Kategorien des Funktionierens lässig und selbstbewusst entziehen. Antriebsfeder hierfür ist, zumindest auf dieser Platte, natürlich Sex. Alles ist Sex, außer Sex, der wiederum Kraft bedeutet, und Kraft ist nur Sex. So oder so ähnlich will es uns Janelle Monáe mit diesem famosen Album beibringen. Wir sollten gut zuhören und nach dieser Verkündigung leben.