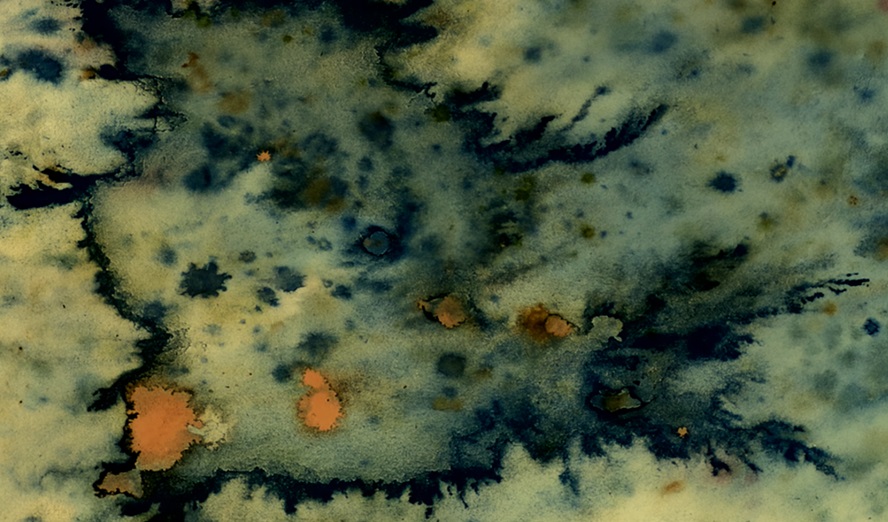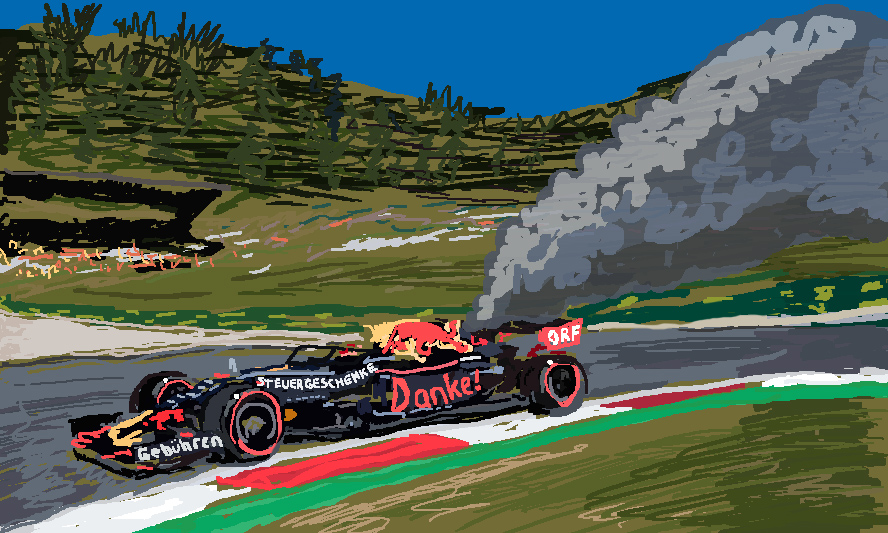30 Jahre skug sind auch Reflexion über einstige skug-Autor*innen, deren herausragende Texte über damalige Redakteur*innen wie Roland Schöny zu skug gelangten. Ö1-Journalist Gerhard Pretting, leider 2014 im 46. Lebensjahr verstorben, hat skug eine zentrale Würdigung des Werks von Michel Foucault zu verdanken. Der französische Philosoph, Historiker, Soziologe und Psychologe, der insbesondere auch den aus der Gesellschaft Ausgegrenzten seine Aufmerksamkeit schenkte, stellte nicht nur die Frage nach der Diskurshegemonie (wer definiert den »wahren« Diskurs?), sondern hat die Antwort auf viele Fragen vorweggenommen. Das Fiese am komplexen Finanzkapitalismus ist, dass er als System dem Menschen die Schuld für sein Versagen zuweist. Foucault erkannte früh, dass Machtsysteme, auch wenn sie sich demokratisch geben, kaum freien Willen zulassen, auch wenn zu viele Menschen das glauben mögen. Das Coronavirus hat dem hoffentlich entgegengewirkt und klar ist, dass angesichts der COVID-19-Disziplinierung der Menschheit gern aus Foucaults Meisterwerk »Überwachen und Strafen« zitiert wird. Die scheinbar freien Gestaltungsmöglichkeiten für das »freie« Individuum verschleiern nur den Blick auf das wahre Ausmaß der Disziplinierung der Gesellschaft. Der Raum jenseits der Macht wird immer enger …

Der Tod des Autors
Zum 15. Todestag Michel Foucaults.
Am 26. Juni 1984 schrieb die französische Tageszeitung »Libération« in einem Artikel über den am Vortag eingetretenen Tod Michel Foucaults: »Seit seinem Tod kocht die Gerüchteküche: Es wird gemunkelt, Foucault sei möglicherweise an AIDS gestorben. Als ob ein außergewöhnlicher Intellektueller, weil er außerdem homosexuell war – zugegebenermaßen sehr im Stillen –, ein ideales Ziel für diese modische Krankheit abgeben würde.« Einige Tage später war es offiziell: Frankreichs Paradeintellektueller verstarb an der »modischen Krankheit«, die erst zwei Jahre zuvor ihren Namen bekam. Dass Foucault homosexuell war, vor dieser Tatsache konnte die französische Öffentlichkeit schwerlich die Augen verschließen, dass einer ihrer klügsten Köpfe aber in den Schwulenbars und -bädern in San Francisco verkehrte und in der S/M-Szene wahrlich kein Unbekannter war, das sollte die »Scientific Community« doch nachhaltig verschrecken. Prototypisch dafür ist die Tatsache, dass James Millers Foucault-Biographie aus dem Jahre 1993 die erste war, die das ausschweifende Leben des Philosophen beschrieb und deshalb auch auf herbe Kritik stieß. Alle vorigen Auseinandersetzungen mit Foucault – speziell jene in Frankreich – negierten das Privatleben des am 15. Oktober 1926 geborenen Historikers.
Mechanismen der Macht
Am 2. Dezember 1970 hielt Foucault am altehrwürdigen College de France seine Antrittsrede und bestieg somit den Olymp der institutionellen Gelehrtheit in Frankreich. Er hatte zu diesem Zeitpunkt drei große Bücher veröffentlicht, die seinen Ruf als unkonventionellen Denker und Erneuerer der Geschichtswissenschaft begründeten. In seinem 1961 erschienenen Werk »Wahnsinn und Gesellschaft« untersuchte Foucault den Umgang der Gesellschaft mit denen, die von ihr als Wahnsinnige bezeichnet werden. Fünf Jahre später veröffentlicht er »Die Ordnung der Dinge«, eine Archäologie der Humanwissenschaften, verfasst noch ganz im Fahrwasser des Strukturalismus. Dieses Werk gelangt – heute kaum vorstellbar, ist es doch eines seiner schwierigsten – auf die Bestsellerlisten in Frankreich.
Drei Jahre später folgt »Archäologie des Wissens«, sein Entwurf für eine neue Geschichtswissenschaft. Man dürfe Geschichte nicht mehr als eine Aneinanderreihung von Namen und Daten sehen, sondern man sollte vielmehr eine historische Abhandlung von Begriffen und Diskursen unternehmen. Also nicht untersuchen, welche Herrscher welche Kriege anfingen, sondern analysieren, wie zum Beispiel eine Gesellschaft mit ihren Ausgestoßenen umgeht, was sie zu welchem Zeitpunkt warum als wahnsinnig bezeichnet und welche Diskurse sich zur gleichen Zeit den Mantel der Vernunft umhängen. Es gehe ihm nicht darum, posthum historische Kontinuitäten zu konstruieren, meint Foucault in »Archäologie des Wissens«, sondern vielmehr um das Aufzeigen der historischen Brüche, der Verschiebungen, der Veränderungen des Bezeichnens.
Knapp nach seiner Berufung ans College de France beginnt Foucault mit den Arbeiten an dem Text, der sein Opus Magnum werden sollte: »Überwachen und Strafen«. Es ist dieses 1975 erschienene Buch – von dem Foucault selbst sagte, es sei sein bestes – das ihn endgültig zum wichtigsten und einflussreichsten französischen Denker macht. Denn wie kein zweiter schafft es Foucault, die subtilen Auswirkungen der Macht zu beschreiben und zu benennen. Er zeigt, wie die Disziplin den Gesellschaftskörper durchdringt und wie es keinen Raum jenseits der Macht geben kann. Foucault versucht, das Wesen der Macht zu erklären und gleichzeitig die Orte, an denen sich das subtile Spiel der Macht am deutlichsten betrachten lässt, zu analysieren. Es sind die Orte der gesellschaftlichen Disziplinierung, allen voran Schule, Kaserne und Fabrik.
Anonymisierter Diskurs
In Foucaults Studien spielt das Individuum immer nur eine passive Rolle, er schreibt keine Heldensagen über Menschen, die etwas bewegen, sondern er versucht, abstrakte Systeme zu kennzeichnen, die das Verhalten des Einzelnen prägen, diesen aber glauben lassen, dass er das, was er tut, aus freiem Willen tut. Foucault wendet sich gegen den Humanismus, nicht deswegen, weil er gegen die Menschen ist, sondern weil er erkannt hatte, dass die übertriebene Betonung des freien Willens, der freien Gestaltungsmöglichkeit die Sicht auf die anderen, wichtigeren, darüber- und darunterliegenden Wahrheitslinien verstellt.
Und deshalb wandte sich Foucault auch gegen die Idee des Autors. Denn diese sei der Angelpunkt für die Individualisierung der Geisteswissenschaften, was zur Konsequenz hat, dass sich alle nur mehr dafür interessieren, wer spricht, und nicht dafür, was gesagt wird. Foucaults Geste der Ausschaltung der Autorenschaft klingt heute – in einer Gesellschaft, in der sich jeder x-beliebige Fuzzi zur Marke stylen will – mindestens so radikal wie zur Zeit der Entstehung. In einem Radiointerview aus dem Jahre 1980 verschweigt Foucault seinen Namen, er wird vom Moderator schlicht als ein »nicht unbekannter französischer Schriftsteller« vorgestellt. In diesem Gespräch erklärt Foucault die Gründe, warum er für einen anonymisierten Diskurs eintritt: »Die Anonymität ist ein Weg, mich direkter an den eventuellen Leser zu wenden, an die einzige Person, die mich interessiert: Da du nicht weißt, wer ich bin, bist du nicht der Versuchung ausgesetzt, nach den Gründen zu suchen, warum ich sage, was du liest; nimm dir die Freiheit, dir ganz einfach zu sagen, das ist wahr, das ist falsch. Das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Punkt, Schluss.«
»Wahrer Diskurs« bindet Ausgegrenzte ein
15 Jahre nach Foucaults Tod haben seine großen Werke nichts von ihrer Gültigkeit verloren, wie sollten denn auch 15 Jahre etwas an Studien ändern, die alle im vorigen Jahrhundert enden? »Überwachen und Strafen« macht mit 1830 Schluss, »Wahnsinn und Gesellschaft« mit 1889. Aber – und das ist der große Verdienst Foucaults – er schaffte es, historische Studien als Zeitdokumente zu beschreiben. Wenn er über die Geburt des Gefängnisses schreibt, über die verschiedenen Taktiken der Einsperrung von Geisteskranken oder über die Art und Weise, wie ein Individuum über sich selbst spricht, dann tut er das so, dass die Historie vergessen wird und die Aussagen problemlos auf das Heute anwendbar werden. Es wäre hoch an der Zeit, neben dem Philosophen auch den Schriftsteller Foucault zu loben. Denn spätestens seit Mitte der 1970er wurden Foucaults Texte zunehmend leichter lesbar. »Überwachen und Strafen« zum Beispiel liest sich stellenweise wie ein »True Crime«-Roman und auch der Trilogie »Sexualität und Wahrheit« ist jene wissenschaftliche Sprödheit fremd, die noch ein Markenzeichen der frühen Texte war.
Bei »Diskurs und Wahrheit«, einem schmalen, 1996 im Berliner Merve Verlag erschienenen Band, der die Berkley-Vorlesungen aus 1983 zusammenfasst, schreibt Foucault über den Begriff der »Parrhesia«, ein Wort, das zum ersten Mal im 5. Jahrhundert vor Christi in Griechenland auftaucht. Über 170 Seiten hinweg betrachtet er alle Bedeutungsnuancen dieses »Wahrsprechens«. »Diskurs und Wahrheit« mutet auf den ersten Blick so trocken und verstaubt an, dass man es gar nicht in die Hand nehmen will. Tut man es aber doch, bekommt man einen Text zu lesen, der mühelos den Sprung über die Zeitgrenzen hinweg schafft. Wer kann wann unter welchen Umständen die Wahrheit sagen, diese Frage ist heute genauso aktuell wie vor 2500 Jahren. Foucaults historischer Verdienst ist es, aufzuzeigen, dass die Mechanismen der Macht, die Strukturen des Diskurses und die Möglichkeiten der vermeintlichen Wahrheitsproduktion sich nur langsam ändern und dass es niemals ein einzelner Revolutionär war, der die Gesellschaft veränderte, sondern Interessen, die sich verbergen, die ihre Macht eben genau dazu nutzen, um als machtlos bezeichnet zu werden.
15 Jahre nach Foucaults Tod findet man im Bereich der »Cultural Studies« fast keinen Text mehr, der sich nicht irgendwie auf den Franzosen bezieht. Und das verwundert kaum, hat er doch alle Fragen, die heute den Diskurs bestimmen, vorweggenommen. Die Frage nach der Diskurshegemonie, die sich rund um den Postkolonialismus-Komplex stellt, also die Thematisierung der Problematik, wer welchen Diskurs als wichtig anerkennt und wer es schafft, seinen Diskurs als »wahren« zu definieren, diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch Foucaults Schaffen. Und er war es auch, der die Ausgegrenzten zu Wort kommen ließ, der die Lage der Irren, der Kranken und der Häftlinge beschrieb und so jene, die mit allen Mitteln aus dem Zentrum des öffentlichen Interesses gedrängt werden sollten, in eben jenes Zentrum zurückholte. Und vor allem im Bereich der »Gender Studies« gibt es kein Vorbeikommen an Foucault, war er es doch, der die Körperpolitik zum Diskursthema machte, der zeigte, wie der Körper des Individuums zum Schlachtfeld politischer und ökonomischer Interessen wurde.