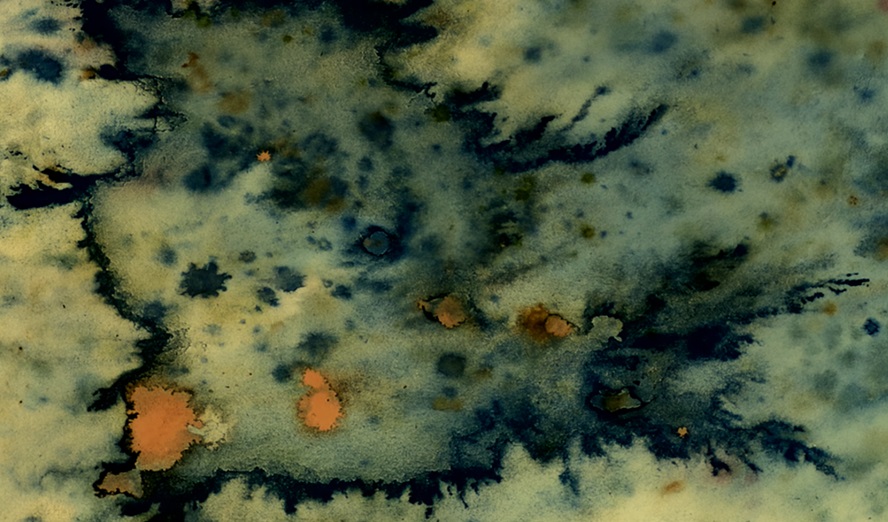Am Dienstag, dem 20. Oktober 2020 um 19:00 Uhr gibt skug- und Buchautor Drehli Robnik eine Präsentation mit Videoeinspielungen zu seinem neuen Pandemie-Buch »Ansteckkino« – das auf skug bereits ausführlich rezensiert wurde – im Wiener Depot. Wir haben ihn vorab zum Interview gebeten.
skug: Herr Robnik, Sie gehören also zu den Menschen die tatsächlich den Lockdown genutzt haben, um ein Buch zu schreiben und auch noch eines über Pandemien. Wie ist es Ihnen denn persönlich in der österreichischen Version des Lockdowns ergangen?
Drehli Robnik: Viel besser – auch ohne privates Grün oder Balkon – als Leuten mit Pflegeverpflichtungen, an Supermarktkassen, in Scheißjobs oder überfüllten Lagern zur Migrant*innenbekämpfung.
Um die Thesen ihres Buches zu diskutieren, sollten wir zunächst ein leicht entstehendes Missverständnis ausräumen. Ihre Arbeit ist kein Kommentar zur Epidemie-Politik, sondern dazu, wie im Film das Wirken von Macht gezeigt wird, anhand von Epidemien. Es geht Ihnen somit weniger um angebliche Gründe (wie etwa: »Wir Menschen neigen in Krankheit dazu, …«), sondern um »Gründungen«, also das, was politisch als Grund angegeben wird und somit eigentlich immer strittig bleiben sollte. Können Sie diesen Ansatz ein wenig erläutern?
Das ist in einem weiten Sinn ein »postfundamentalistischer« Ansatz zur Politik. Er besagt, sehr allgemein, dass Gesellschaften, Institutionen, Projekte sozialer Gruppen sich heute nicht mehr auf stabile Fundamente wie Traditionen, Religion, Mythen, Herrscher-Vaterfiguren o. ä. stützen lassen. Auch die Kapitalisierung von sozialen Verhältnissen oder das Regime Kurz sind unruhige, ständig nachjustieren müssende Formen, grundlegende Macht auszuüben. Daraus folgt, dass das Gründen von Gesellschaft als vollständiges unmöglich ist. Damit wird das Grund-Geben, Grund-Legen aber keineswegs irrelevant (oder es erscheint als irrelevant oder als illegitim nur in Sichtweisen, die eher auf permanentes freies Fließen und Strömen abheben). Vielmehr ist das Gründen gerade als unmögliches weiterhin eine Aufgabe, ein Anliegen – eben als Gründung oder, was dasselbe hieße, Formgebung von Ganzheiten, die eben auch prekäre bzw. unganze sind. Wir sind »post« zu den Fundamenten, d. h., ihr Anspruch wirkt nach. (Und »erledigt« ist in der Geschichte nie etwas, das wäre eine verwandte, auch in meinem Buch relevante Einsicht.) Das im engeren Sinn politische Wort für das Prekäre, Vorläufige, Unganze von Gründungen, lautet Strittigkeit, Konfliktivität. Politik heißt Gründung von Allgemeinheiten an einem partikularen Punkt im Streit mit anderen Partikularansprüchen und in einer Weise, die bestreitbar bleibt.
Ein Grundproblem scheint im Darstellen von Pandemien im Film zu liegen. Wir lernen heute, dass die Covid-Krise eine langsame Krise ist und der Film aber gerade ein Medium ist, das Geschwindigkeit braucht. Roland Emmerich braucht für den Klimawandel in »The Day After Tomorrow« nur wenige Tage Filmhandlung, bis New York eine Eiswüste ist, mitsamt freistreunender, hungriger Wölfe. Die Katastrophen passieren im Film somit notwendig im Zeitraffer. Es scheint, als hätten sich viele zu Beginn von Covid die Pandemie so vorgestellt und als hätten sie nun Probleme mit der Dauer der Krise. Haben wir durch übermäßige Filmrezeption ein falsches Zeitgefühl bekommen?
Was wir durch zu viel Filmschauen bekommen, weiß ich nicht. Vielleicht Augenweh oder einen steifen Hals, wenn wir im Kino zu oft bei zu langen Filmen in der ersten Reihe sitzen. Aber was Sie ansprechen, ist ja die Frage: Wie sehr habe ich, wie sehr hat eine Öffentlichkeit, hat ein Film, von einer Katastrophe eine Vorstellung als dramatisch verdichteter Augenblick – eine heroisierende Vorstellung, die sich gut mit traditionellen Vorstellungen maskulin-autoritärer Politik (oder auch von Großereignis-Politik) verträgt. Oder habe ich Vorstellungen, Filminszenierungen, die das Langwierige, Erschöpfende, auch das Kleinteilige und Infrastruktur-Bezogene von Katastrophen, eben auch einer Pandemie, vermitteln. Den Alltag und wie er sich wandelt. Ein Beispiel für das Augenblicksdramakonzept wären die vielen Zombie-Pandemie-Filme, bei denen das Motiv der Infektion ein Auslöservorwand für Extremsituationen ist, in denen sich dann oft maskuline Gewalt, die Rückkehr zu eindeutigen Hierarchien, die Besinnung auf irgendetwas angeblich Unmittelbares tätig bewähren. Ich habe diese Filme eher peripher erörtert. (Angeblich gibt’s ja schon Bücher über Zombiefilme.) Ein Zugang, der eher die langwierige Zeitlichkeit betont und dem etwas an Sinn abgewinnt, ist z. B. der des irischen Zombiefilms »The Cured« von 2017, den die Starschauspielerin/Aktivistin Ellen Page als Hauptdarstellerin mitproduziert hat – da geht es um medizinisch-polizeiliche Sicherheitsregimes nach einer mörderischen Wut-Zombie-Pandemie und um Politiken der Segregation, der Schikane gegen Geheilte, denen misstraut wird, darum, dass da eine Bevölkerung entsteht, die von vornherein miese Wohnungen und Scheißjobs bekommt, in Analogie zu geflüchteten oder nichtweißen Menschen in Reichtumszonen. Und, was ich interessant fand, die Idee von Selbsthilfegruppen von Geheilten, von Survivors, die durch das Trauma eines Therapielagers einen speziellen Bond haben, und diese Gesprächsselbsthilfegruppen bekommen dann auch das Moment einer politischen Gruppe der »Interessensvertretung« und Selbstbekundung bis hin zur Arbeit im Untergrund. (Mensch bedenke: ein irischer Film, und in Irland, Nordirland zumal, haben Leute, und sei es über Eltern- und Großelternerfahrungen, eine Nähe zu Bürgerkrieg, Polizeischikanen, Untergrundtätigkeit und den Nachwirkungen solcher Gewaltsituationen.)

Der älteste Film des Buches ist der 1919er »Pest in Florenz«, der willentlich/unwillentlich das Gesellschaftsbild der Sozialdemokraten illustriert. Wer vor der Revolution zurückgeschreckt ist, will nur mehr die Tyrannei oder das Chaos als Alternativen kennen. Diese Ausweglosigkeit wird im »Katastrophenfilm« argumentiert, damit man nicht selbst an den verschenkten demokratischen Spielräumen zugrunde gehen muss. Bietet somit manche Infektionskatastrophe im Film Gelegenheit zur falschen Versöhnung mit der politischen Realität?
Ja, das ist ein spezifischer Zug am deutschen Kino, am »Weimarer« Kino der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, den Siegfried Kracauer herausgearbeitet hat: Das Aufbegehren gegen die alte, »tyrannische« Ordnung erscheint als Provokation von noch schlimmerem Unheil, Revolution gilt als sündhaft, und jegliches einschneidende politische Veränderungshandeln ist damit von vornherein aus dem Spiel. Die Sozialdemokratie ist paralysiert (in Österreich ist die Sache etwas anders), das Bürgertum ist in Sehnsucht nach Stabilität und Wiederherstellung verlorener Statusprivilegien. In dem Film von 1919 wird die Sache noch über einen allegorischen Pesttod abgehandelt, der unter den dekadent Feiernden im postklerikalen Florenz seine Ernte hält und somit Buße auferlegt. Der Erstauftritt der Pesttodgestalt – per Überblendung aus einem Sumpf – ist über Zwischentitel angekündigt, die besagen, dass in der frevlerischen Stadt Tugenden zu leeren Worten geworden waren und dass nun »die Steine zu reden begannen«. Das ist etwas, das – in postreligiösem Kontext – in manchen autoritären Entwürfen von Pandemiepolitik wiederkehrt: Im Moment der Entscheidung tritt eine grundsätzlichere, massivere Sprache (hier: der Steine) an die Stelle der leeren Worte. Das ist so in Filmszenen, wo das Krisenstabsgeschnatter durch das Charisma eines väterlichen Führers und sein entschlossenes Wort beendet wird – etwa in dem südkoreanischen populistischen Fieberepidemiedrama »Gamgi« aka »The Flu« von 2013 (ein »Outbreak«-Rip-off, das diesen Juli unter dem Titel »Pandemie« einen kleinen Start in Österreich und der Bundesrepublik hatte). Aber das hat auch ein Echo in den kleinen Rechtsstaats- und Gewaltenteilungsaushöhlungen seitens des Erlöserkanzlers Kurz, wenn er über verfassungsrechtliche Bedenken gegen seine polizeilichen Einschüchterungsmaßnahmen meinte, er habe jetzt andere Probleme, jetzt sei nicht der Zeitpunkt für »juristische Spitzfindigkeiten« und die Frage, ob alles »auf Punkt und Beistrich« (in D: Punkt und Komma) verfassungskonform sei.
Der Film »Pacific Liner« aus dem Jahr 1939 zeigt wie statt Revolte mittels Hygiene wieder der Normalzustand zurückgewonnen wird. Die Arbeit siegt und wieder hat sich nichts geändert. Liegt hierin ein ermattendes Vorbild, denn auch heute muss »nur« Covid bewältigt werden, damit alles so (ungerecht und ausbeuterisch) bleibt, wie es ist?
»Pacific Liner« zeigt ein fast genuin sozialdemokratisches Szenario im Modus eines gehobenen Hollywood-B-Movies: Als die Heizer aufgrund eines Cholera-Ausbruchs unter Deck eines Luxusliners die Arbeit niederlegen und ein Oben- (gesund) und Unten- (krank) Bewusstsein manifestieren, kooperieren der besorgte junge Arzt und der raubeinige Vorarbeiter (der große Victor McLaglen), um sie zum Weiterarbeiten zu bringen. Der eine sorgt für Hygiene und Behandlung, der andere bevormundet und motiviert sie – er ist letztlich »einer von ihnen«, packt mit an, damit die zu verrichtende Arbeit getan wird, und will, dass seine Boys stolz auf ihre Leistung sein können. Einen kleinen Bonus gibt’s auch: In der Corona-Krise war ja für die »Schlüsselarbeitskräfte« nicht mal das drinnen: weder Verbesserung der Lebensverhältnisse von Erntehilfsarbeitenden noch eine Gehaltserhöhung oder Arbeitszeitverkürzung für Arbeitende im Handel oder in der Pflege. Der massenhafte Applaus vom Frühjahr ist rückblickend reine Verarschung. Der Witz, man solle nun die Vermietenden auch mit Applaus statt mit Geld – das man nicht hat – für die Miete bezahlen, ist nach wie vor gut.
Sie weisen nach, dass sowohl im NS- als auch im US-Ansteckungsfilm das Ausblenden des Klassenkampfs zu einem ähnlichen Ergebnis führt. In beiden ist die Infektion das äußere Böse, vor dem das eigene Gute geschützt werden muss. Das DDR-Biopic »Semmelweis« ist hingegen dialektischer, weil auch die Guten das Böse in sich tragen. Es sind die Hände der Ärzte, die den Tod durch Keime bringen. Strebt die heutige politische Verarbeitung von Covid-19 auch eher zur klaren Trennung von Gut und Böse?
Naja, vielleicht hab ich das nicht klar genug ausgedrückt im Buch, dass das »Ausblenden des Klassenkampfs«, oder weiter gefasst, das Nicht-Anerkennen sozialer Differenz und die Unmöglichkeit, sie politisch zu artikulieren, im NS-Kino um 1940 zu genuin biopolitischen Inszenierungen führte – mit dem Arzt als charismatischem Führer, der um die »Verunreinigung des Volkskörpers« weiß und diesen eben reinigt. Im zeitgleichen Hollywood-Biopic ist eher ein progressistisch-liberales Integrationsnarrativ am Werk: Das Andere – das Ethnisch-Andere von Immigrants ebenso wie das Biologisch-Andere einer Krankheit – kann in den majoritären gesellschaftlichen Betrieb integriert werden. Und jüdische Stars wie Paul Muni und Edward G. Robinson dürfen in ihren historischen Rollen großer Ärzte in Form großer Grundsatzreden Intoleranz und Borniertheit anklagen – solang nur nie von Antisemitismus, Rassismus, sozialen Ungleichheiten die Rede ist, sondern alles vage und fortschrittsfroh bleibt. Und das DDR-Biopic »Semmelweis« über den gleichnamigen Ignaz, Erstbekämpfer des Kindbettfiebers, ist am besten nicht als quasimarxistischer Film, der den Arzt um 1850 zum Vorläufer sozialistischer Progressivität stilisieren will, sondern in quasifeministischen oder besser: männlichkeitskritischen Momenten, in denen er die Hierarchien expertokratischer Männerbünde angreift, anhand eines Protagonisten, der an eben diesen Machtspielen zerbricht und durch Wahnsinn seiner bürgerlichen Würde als Wissensträger verlustig geht.
Realität ist fade. Filme brauchen einen Twist. Deswegen sind häufig in Ansteckungsfilmen doch das Militär oder geheime Experimente schuld. Wirken die Erklärungsmuster des Kinos fatal auf das Publikum, das berechtigte Skepsis schnell in Verschwörungsfantasien wandelt?
Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob »das Kino« Erklärungsmuster anbietet. Die sind so verschieden wie die Äußerungsformen von Politik. Manche der Filme, in denen Biowaffen-Machinationen Quasi-Infektionen hervorrufen – kanonisches Beispiel: Verstoß gegen Quarantänebestimmungen in »Alien«, 1979 – haben durchaus Momente (Momente, keine systematischen Panoramen) proletarischer Selbstverständnisse in sich, von wegen der eigenen Austauschbarkeit. Ein Twist ist ja eine wirkliche Wendung, zumal am Ende. Ein gutes Beispiel wäre das Ende des kanonischen US-Globalpandemie-Ensembledramas »Contagion« von 2011: In den vielen Episoden und Strängen des Films werden Geheimhaltungen durch Behörden ebenso wie die Aktivitäten eines verschwörungsgläubigen Aluhut-Bloggers (gespielt von Jude Law) dargelegt. Der Twist am Ende ist der nachgereichte »Day 1«, denn der Film hat mit der hustenden Gwyneth Paltrow am Tag 2 begonnen, und am Ende wird die Infektionskette ganz zurück verfolgt, bis zum Spillover Event, als eine durch Abholzungen in asiatischen Wäldern aufgeschreckte Fledermaus ein Schwein infiziert, das Schwein als totes die Hände eines Kochs in einem Casino auf Macau, der Koch die Geschäftsreisende Paltrow – und es stellt sich heraus, dass der Konzern, für den sie rumreist, ihre tödliche Infektion verursacht hat. Jedoch: Da ist dann wieder eine sexistische und organizistische Fantasie mit im Spiel. Die Mobilität des Finanzkapitals, verkörpert in der mobilen, kalten Frau im Casino, die auf dem Heimflug heimlich einen Lover zum Sex im Flughafenhotel trifft, im Kontrast zur Organizität der Familie ihres ahnungslosen, »betrogenen« Ehemanns (Dackelauge Matt Damon) – das ist ein Twist, zugleich eine Verdrehung von Kapitalismusskepsis in eine Gender-Projektion und eine Phobie gegen das mobile Kapital im Unterschied zu einer eingewurzelten Bürgerlichkeit. Nicht schön, das!

Die Corona-Skeptiker und Wutbürger-Demos die wir aktuell erleben, wurden bereits in vielen Filmen porträtiert, wie etwa in George Romeros 1970er »The Crazies«. Hier zeigt sich die schwer auflösbare Melange aus Staatsphobie, berechtigter Kritik am Grundrechteeinschränkungen, libertärer Grundhaltung und plumpem Rassismus. Die Filmhandlungen scheitern oftmals an dem Widerspruch, die Skepsis goutieren zu wollen und zugleich die wahnhaften Ausformungen abzulehnen. Kann deshalb das Ansteckungskino die heutige Misere porträtieren?
Ich sag mal so: Es ist erstaunlich, wie hoch der Preis der »Staatsübergriffskritik« in einem Klassiker des Angst-vor-der-Schutzanzug-Polizei-Kinos wie Romeros »The Crazies« von 1973 ist. Ein hoher Preis, insofern als Alternative zum Machtexzess des Staates samt Flammenwerfer, Masseninternierung etc. hier ein Burschen-Cowboy-Habitus mit Privat-Flinte gilt, also ein Maskulinismus an der Grenze zum Militia-Unwesen. Die heutige Misere … die ist zu groß, um sie zu porträtieren; da käme eher ein Wimmelbild raus. Interessant aber, dass das Remake von »The Crazies« von 2010 den Typus des schießfreudigen lokalen Cowboy-Mannes explizit in Frage stellt; das ist nicht viel, aber auch nicht nichts.
Zugleich scheint die eigentliche Bedrohung des Jahres 2020, die per Durchgriffsrecht eingeschränkte Demokratie des neoautoritären Regierens, kaum in Filmen aufzutauchen. Ist dies zu abstrakt für Filmhandlungen?
Vielleicht. Obwohl westeuropäische Politkrimis der 1970er ganz gut darin waren, Verfassungsbrüche von rechts in spannenden Plots zu problematisieren. Dass die Sache mit bürgerlichen Rechten und ihrer Aushebelung im »Ausnahmezustand« kompliziert ist und viele null interessiert, weil sie eh tun, was die Polizei von ihnen verlangt, und sei es »I Am From Austria« vom Balkon abzuspielen – das machen sich ja auch Kurz & Konsorten zu Nutze. An der Verfassung hängt wenig Pathos – an der österreichischen, im Sinn des »zurückhaltungsethischen«, rechtspositivistischen Ansatzes von Hans Kelsen, sozusagen paradigmatisch wenig Pathos. Viel Gewaltenteilung, Abwägung, Einhegung, Bremsung von Durchgriffsmöglichkeiten. Ein Kurz oder ein Orbán mögen diese Bremsen nicht. Und der Genrespielfilm scheint heute auch wenig Freude am Darlegen solcher Bremsen bzw. am Beschwören ihrer Aushebelung zu haben. Dann würde man sich wünschen, dass der Populismus, den manche der Inszenierungen beschwören – also: gegens Establishment, gegen abgehobene Regularien (gerade in südkoreanischen Pandemie-Schockern) –, weniger macho, weniger »identitär«, mehr kämpferisch, bündnisorientiert, links, herrschaftskritisch wäre. Naja, das sagt sich jetzt auch leicht … aber immerhin: ein toller, Macht- und Karriere-Milieu-analytischer Film zur Stunde ist der Laborthriller »Little Joe«, von Jessica Hausner, eine ösi-britische Produktion von 2019. Eine der Pointen ist: Wenn die zwecks Selbsterhaltung die Leute per Sporen infizierende Pflanze die Seelen der Leute übernimmt – Bodysnatching und so –, dann verändern sie sich, und zwar ein bisschen. Nicht sehr. Denn zwanghaft fröhlich, besorgt um ihre Selbstoptimierung, um korrektes Mutter-Sein, Kollegin-Sein, Leistungssteigerung etc., das waren sie ja vorher schon, und das alles ist so normal wie das Leben unter Leistungszwang, nur ein bisschen zu bunt und daher creepy.
Sie behandeln auch Katastrophenfilme, die sich ihre Genrezuordnung in dem Sinne verdienen, dass sie katastrophal schlecht sind. Der Pro7-Streifen »Ratten – Sie werden Dich kriegen« wäre hier ein gutes Beispiel. In dem Film wird durch ungeschickte Metaphorik ein plumper Antisemitismus erzeugt, indem gezeigt wird, wie Deutsche durchgreifen müssen gegen die Ratten »aus dem Osten« und »von der Börse«, die bei ihrer Verbrennung ein kollektives Gedächtnis entwickelt haben. Schmerzt das Anschauen solcher Machwerke manchmal?
Vielleicht ist »Ratten« ja auch allzu geschickt in seiner Metaphorik: Ein Event-Movie, das kein Event ist, bietet dann halt ein bissl angedeuteten Antisemitismus rund um die Ratten-Symbolik als einzigen Special Effect. In der Rezeption von heutigem nasalem Kabarett gilt sowas dann überhaupt als »kontrovers« … Aber, um das nur kurz anzudeuten: Über die Jahre gewöhnst du dich dran, wenn du kritisch-analytisch oder, wie ich gern sage, »wahrnehmend« über Filme schreibst, dass dann auch das Anschauen vieler »Machwerke« in dem Sinn »Spaß« macht (was mensch dann halt Spaß nennt), dass sich vieles findet, von dem ich glaube, es macht Sinn, darauf hinzuweisen. Aber natürlich sehe ich am Ende genauso gern oder lieber sozial luzide und sauspannende oder superlustige Filme wie z. B. Jordan Peeles »Get out« und »Us« oder Boots Rileys »Sorry to Bother You« oder eben »Little Joe«.
Eine letzte Frage: Hat eigentlich der österreichische Bundespräsident mit seinem seltsamen Satz zur Ibiza-Affäre: »So sind wir nicht!« ein politisches Grundmotiv vieler Ansteckungsfilme zusammengefasst: Das Bedürfnis, ein verseuchtes Äußeres von dem angeblich sauberen Inneren abzugrenzen?
Ich fürchte ja. Aber: »So bin ich nicht«, dass ich irgendwas von mir wegprojizieren würde. Wobei: Hochgestochen gesagt, könnte der Satz des Bundespräsers »performativ« gemeint gewesen sein – in dem Fall, um eine Delegitimierung Straches und damit freiheitlich-nationalautoritärer Politik zu markieren, was aber wiederum eine Erfolgswelle konservativ-neoliberal-nationalautoritärer Hybridpolitik nach sich gezogen hat …
Herr Robnik, vielen Dank für dieses Gespräch.