»Polen und Juden während der Shoah«, lautet der vielsagende Untertitel des auf Oral History basierenden, famosen Standardwerks »Wir aus Jedwabne« (Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 2020), aus dem Polnischen übersetzt von Sven Sellmer. Anna Bikonts Niederschrift lässt erahnen, wie immens der katholische Klerus auf die (wie großteils die jiddische) verarmte polnische Bevölkerung negativen Einfluss nahm und dieser in gewissen Regionen immer noch furchtbar nachwirkt. Anna Bikont hat sich viel Auszeit genommen und besessen vom Thema einen Hauptaspekt des insbesondere in Ostpolen erbarmungslosen Antisemitismus beschrieben. Der Mythos, dass die Juden Jesus getötet haben, lebt auch heute noch unhinterfragt fort und hatte im Sommer 1941 tödliche Konsequenzen für die jiddische Nachbarschaft in einer Region zwischen den Städten Ełk (Woiwodschaft Ermland-Masuren) und Białystok (Woiwodschaft Podlachien). In letzterer multiethnischer Großstadt in Nordostpolen veröffentlichte Ludwik Lejzer Zamenhof 1887 die Grundlagen des Esperanto. Eine leicht zu erlernende, neutrale Sprache als Notwendigkeit, um Ghettobildung und Rassismus zu verhindern. Was leider ein idealistisches Unterfangen blieb und kein Schlüssel zum Frieden war.
Verschwörungsmythen, die Behauptung des Reichtums von jüdischen Gewerbetreibenden und die nicht wahre Verallgemeinerung, dass alle Mitbürger*innen der jiddischsprachigen Bevölkerung für den UB, den polnischen Ableger des NKWD, gespitzelt hätten, sind auch heute noch tief im Großteil der Einwohnerschaft von Jedwabne und Umgebung verankert. Es gibt zwar keine Fememorde mehr an den wenigen verbliebenen jüdischen Einwohnern und aufrechten Polen, deren Großeltern ihre Nachbarn versteckten bzw. die ungeheuerlichen Gewalttaten bezeugten (es gab einige Prozesse mit Verurteilungen), doch ihren Judenhass sprechen viele Jedwabner während Anna Bikonts Recherchen unverblümt aus. Lassen die echten polnischen Patrioten spüren, dass die historische Wahrheit der Verbrechen von Polen an Juden nicht erwünscht ist.
Marschall Józef Piłsudski führte Polen 1918 in die Unabhängigkeit, regierte aber nach dem Maiputsch 1926 aufgrund von Korruption, Wirtschaftskrise und politischer Instabilität mit einem Militärregime. Es gab zwar Wahlen, die politische Opposition sowie ukrainische und weißrussische Minderheiten wurden aber mit polizeilichen Methoden unterdrückt. Antisemit war Piłsudski dezidiert keiner, weshalb erst nach seinem Tod am 12. Mai 1935 die Nationalpartei SN ihr unseliges Wirken entfesseln konnte. Jüdische Bürger, die mit polnischen Bürgern Seite an Seite für die Wiedererringung der Eigenstaatlichkeit gekämpft hatten, wurde aus gemeinsamen Reservistenbünden ausgeschlossen. Das Unheil nahm mit ersten Pogromen seinen Verlauf.
Meirs Schule, Deportation und Flucht
Ende der 1930er-Jahre begann in den von der SN dominierten Gebieten eine Separierung der jüdischen Schüler*innen, ähnlich der Situation im bereits von Nazideutschland einverleibten Österreich. Meir Grajewski (aka Ronen), der sich gegen die Lehrer*innen, die ihn Mosiek riefen, wehrte, über die bedrohliche Situation in seiner Schule: »In der sechsten Klasse, als wir schon in der letzten Bank saßen, kontrollierten die Lehrer nicht mehr unsere Hefte und holten uns nicht mehr an die Tafel, es sei denn, um uns anzuschreien. Wir waren fremd in der Klasse, die polnischen Schüler sprachen nicht mit uns …« Das Titelbild dieser Buchrezension zeigt die Abschlussfeier der 7. Klasse der Grundschule in Jedwabne. Auf dem Foto aus dem Jahr 1936 sind nur wenige jüdische Kinder zu sehen. Die meisten Eltern nahmen sie wegen der Schikanen durch Lehrer*innen und Schüler*innen aus der Schule. Der von Polen gesäte Hass verunmöglichte eine Klassenkameradschaft.
Die Massendeportationen, die noch kurz vor dem Einmarsch der Wehrmacht im sowjetisch besetzten Ostpolen (Hitler-Stalin-Pakt 1939) erfolgten, betrafen hauptsächlich polnische Familien aus Jedwabne, aber auch vier jüdische. Meir Grajewski, dessen Vater bereits im Dezember 1939 von Sowjets verhaftet und vermutlich erschossen wurde, hat wegen seiner Verbannung nach Kasachstan das Massaker in Jedwabne nicht miterleben müssen, schildert jedoch, dass die Todesrate unter den Deportierten enorm hoch war. Die meisten Polen ließen ihn trotz gemeinsamen Schicksals spüren, dass er unerwünscht war, und nach seiner Rückkehr nach Polen bekam er oft zu hören: »Wo kommen denn noch die ganzen Juden her? Hat Hitler nicht alle erledigt?« Nach dem Pogrom von Kielce am 4. Juli 1946 mit über 40 ermordeten und über 80 verletzten Juden wartete Grajewski nicht mehr im staatlichen Repatriierungsprogramm in Stettin. Ohne Dokumente flüchtete er durch halb Europa und schaffte es trotz vieler Hindernisse 1947 nach Palästina. Meir Grajewski ging sogleich an die Front und hat, weil es ein Befehl Gurions war, für den Dienstpass der israelischen Armee den hebräischen Namen Ronen angenommen. 1963 absolvierte er eine Flugabwehrschulung in Deutschland, weil Adenauer an Israel Geschütze schenkte. Ronen wohnte mit deutschen Soldaten und betont, dass es in Polen unmöglich gewesen wäre, sich einem Juden gegenüber so anständig zu verhalten.
Zwar ist verständlich, dass die Massendeportationen viele Polen zornig machten. Dies entschuldigt jedoch keineswegs, dass der wütende polnische Mob ohne Zutun, aber mit Ermutigung/Duldung der Gestapo die jüdischen Nachbarn erbarmungslos massakrierte und währenddessen auch Frauen und Kindern deren Hab und Gut aus ihren Häusern raubten.

Antonina Wyrzykowska – Gerechte unter den Völkern
Anna Bikont befragt viele Zeitzeugen, nimmt die Mühe vieler Reisen auf sich, um das Überleben der in Israel und in der Diaspora verstreuten Überlebenden zu rekonstruieren, sucht aber auch die Mörder und deren Nachfahren auf, die allzu oft ihre Version der Unwahrheit darbringen. Besonders ans Herz gehen die Schicksale jener, die jüdische Leben retteten. Etwa die Erzählungen des unbeugsamen Stanisław Ramotowski oder die erschütternde Geschichte von Antonina Wyrzykowska, die sieben Jüd*innen unter einem Schweine- und Hühnerstall versteckte. Unter dem nach Jauche stinkenden Versteck war sogar ein Kind zur Welt gekommen, jedoch musste ein Paar sein Baby bei der Geburt töten, weil 100 Meter vom Schweinestall entfernt zwei deutsche Besatzer wohnten, die den Geburtsschrei gehört hätten.
Wyrzykowska, die ein extrem karges Leben fristen musste, bringt die Ungerechtigkeit, die ihr als guter Mensch widerfahren ist, in einem Gespräch mit Bikont auf den Punkt: »Man muss sich ehrlich eingestehen: Wenn man einen Juden zum Freund hat, hat man die Polen sofort zu Feinden. Warum das so ist – ich weiß es nicht. Als ich die Auszeichnung bekommen habe, diese Medaille für die Gerechten unter den Völkern, da hat meine Helena sie gleich in den Mülleimer geschmissen. Und das war auch besser so, ich hätte sie ja doch niemandem zeigen können. Im Amerika habe ich einem Priester in Chicago gebeichtet, dass ich Juden gerettet habe und täglich für sie bete. Er hat nicht gesagt, dass man das nicht darf, also ist es offensichtlich keine Sünde. In Polen würde ich einem Priester solche Sachen nie erzählen, um nichts in der Welt.« Die Anwesenheit eines ihrer Schützlinge, Szmul Wasersztejn, musste sie nach dem Einmarsch der Russen am 23. Jänner 1945 verleugnen und wurde dafür von einer sechsköpfigen Bande, die bereits in Jedwabne mordete, fast zu Tode geprügelt und beraubt. Irgendwann verliebte sie sich in Waserstzejn – ein Foto, entstanden 1945 im Flüchtlingslager in Linz, zeigt Wyrzykowska neben Waserstzejn sitzend –, kehrte aber nach Polen zurück und zog mit ihrer Familie nach Bielsk Podlaski. Dieser Ort liegt unweit von Jedwabne und ihre Verfolger schüchterten sie weiter ein. Wegen der ständigen Angst begann ihr Mann zu trinken und vom Bauernhof, den Wasersztejjn mit dem Geld seines Bruders aus Kuba gekauft hatte, blieb nichts mehr übrig.
Gedenkbücher, papierene Mahnmale vernichteter Existenz
Waserstzejn emigrierte nach Kuba, war dort Unternehmer, zog jedoch nach der Machtergreifung Fidel Castros nach Costa Rica, wo er ebenso erfolgreich war, dabei aber stets seine Geschichte dieser extremen Gewalterfahrung verbreitete. Daraus resultierte das 400-Seiten-Buch »La Denuncia, 10 de Julia 1941. Die Enthüllung. Der 10. Juli 1941«. Waserstzejns Sohn Izaak publizierte es im Jahr 2000 nach Szmuls Tod. Die starke Mythologisierung, die ein Entlanghanteln an der Wahrheit ist und auch Übertreibungen beinhaltet, ist auch dem »Jedwabner Gedenkbuch« eigen. Bikont suchte dazu in Brooklyn/New York den seit 1938 im Exil lebenden Rabbi Baker auf, der das Buch mit seinem Bruder verfasste. Eine gute Quelle, denn Gedenkbücher bewahren Personen und Welten, die nicht mehr existieren, vor dem Vergessen. Eine emotional und historisch bedeutsame Weiterführung einer frühmittelalterlichen Tradition, als während des Gebetes lange Listen von Pogromopfern vorgelesen wurden.
Exemplarisch auch das Schicksal der Müllerfamilie aus Radziłów, wo das erste große von Polen begangene Massaker mit Judenverbrennung in einer Scheune am 7. Juli 1941 stattfand. Die Memoiren von Chaja Finkelsztejn erscheinen wie eine Parabel auf einen rassistischen Wahn, hinter dem Macht- und Raubinteressen stehen, wie gegenwärtig im inneräthiopischen Krieg gegen die Tigrays mit marodierenden Milizen sogar aus Eritrea oder den Jugoslawien-Kriegen. Doch auch als Parabel darauf, dass sich in einer nationalstaatlichen Welt(un)ordnung das Töten und grobes Unrecht wiederholen. Das Überleben konnten sich die Finkelsztejns dank Chajas Verhandlungsinstinkt nur erkaufen, indem sie dem Pfarrer Geld gaben und zum katholischen Glauben konvertierten. Die des Öfteren geteilte Familie musste die Abschlachtungen ihrer Nachbarn mitansehen, Unfassbares erdulden und über fünfzig Mal ihr Versteck wechseln. Nach dem Krieg hießen die Stationen Białystok und Łódź, mit gefälschten Papieren gelang die Ausreise. Auch das Schiff der Finkelsztejns wurde aufgebracht, die Odyssee führte nach Zypern und 1947 war man endlich in Erez Israel. Der noch nicht 16-jährige Sohn Szlomo meldete sich zur Armee und wurde 1948 in der Nähe von Jerusalem bei Kämpfen gegen die palästinensischen Nachbarn getötet.

Fememorde an befreiten Juden
Noch bitterer ist es, sein Kind durchgebracht zu haben und mitzubekommen, dass es beim Spielen von polnischen Nachbarjungen mit Steinen erschlagen wurde. Geschehen ist dies Icek, dem ebenso katholisch getauften Sohn von Helena Chrzanowska (jüdischer Name Sara Kuberski). Ihre Bitternis schrieb Chrzanowka in einem Brief an Wyrzykowska: »Wenn ich gewusst hätte, was das für ein Leben werden würde, dann hätte man es lieber nicht retten sollen.«
Vermutlich mehr als 70 Juden, die den Krieg mit unglaublichen Entbehrungen überlebt hatten, wurden im Raum Białystok getötet. So erschlug etwa Antoni Kosmaczewski, Mitglied der Heimatarmee AK, den Schuster Mordechaj Dorogoj und dessen Sohn Akiwa fünf Tage nach der Befreiung am 28. Jänner 1945, nachdem diese den Krieg in einem bitterkalten Erdloch überlebt hatten. Von Kompanieführern der AK geduldete Tötungen, um Zeugen zu eliminieren, denn Kosmaczewski ermordete 1941 bereits Dorogojs Tochter Dora.
Bikont sieht sich als Sozialhelferin und Psychotherapeutin für jene Polen, die sich ihren Anstand bewahrt haben und dies aufgrund des hässlichen Antisemitismus ihrer Nachbarn büßen müssen. Ihr selbst wird vorgeworfen, dass es ihr wie den polnischen Helfern nur ums Geld gehe und ging. Die jüdische Hauptanschwärzerin von der »Gazeta Wyborcza« habe sich ihren Ruf durch polenfresserische und lügnerische Artikel redlich verdient, schrieb ein antisemitisches, dem Jedwabner Pfarrer wohlgesinntes Blatt im Mai 2002.
Gespenster der Vergangenheit
Anno 2021 (der Band entstand zwischen 2000 und 2004) sind alle Zeitzeugen verstorben. Das Denkmal, das außerhalb von Jedwabne an der Stelle der abgebrannten Todesscheune errichtet wurde, ist nur beschwerlich zu finden. Die städtischen Behörden boykottieren den alljährlich am 10. Juli wiederkehrenden Gedenktag, zu dem Menschen aus Warschau und anderen Städten anreisen. Ein Gegendenkmal am Marktplatz erinnert an die Polen, die während des Krieges nach Sibirien deportiert wurden. Über die Unwahrheit, dass die Polen massiv von Juden denunziert und deshalb nach Sibirien in die Verbannung geschickt wurden, besteht in Jedwabne weiterhin kein Zweifel. Die rechtskonservative bis erzreaktionären PiS (Partei für Recht und Gerechtigkeit) spricht ihrem Namen Hohn und lässt die Geschichte umschreiben. Das Institut für nationale Geschichte (IPN) hat eine neue Leitung und annullierte die von Vorgängern erarbeitete historische Wahrheit.
Die Verdienste des IPN-Anklägers Radosław Ignatiew aber bleiben, auch dank »Wir aus Jedwabne«. »Polen waren die einzigen direkten Täter der Verbrechen«, die Essenz der Ermittlungen, führte im polnischen Sejm Ende Februar 2002 bei der Präsentation des IPN-Tätigkeitsberichtes zu einem Eklat. Abgeordnete der Liga der polnischen Familien (Vorläufer der PiS) fanden Worte wie ein Schlägertrupp, etwa: Was Aleksander Kwaśniewski (Polens Präsident von 1995 bis 2005) sage, sei »der Höhepunkt der Steinigung des polnischen Volkes«. In einem Unterstützerbrief für Leon Kieres, den Vorsitzenden des IPN und polnischen Patrioten, der beschuldigt wurde, ein Jude zu sein, ist ein leider prophetisches Zitat zu finden: »Im Parlament sich einer solchen Sprache zu bedienen, hat Tradition – und eine Zukunft: den Faschismus.«

Antisemitische Ideologie im Umkreis von Łomża
Immerhin besteht das 2003 gegründete Zentrum zur Erfassung der Judenvernichtung (Centrum Badań nad Zagładą Żydów) weiterhin und publiziert hervorragende Bücher zur Shoah in Polen. Und eine positive Folge der Aufarbeitung von Jedwabne war die Bewusstmachung des polnisch-jüdischen Verhältnisses in der polnischen Öffentlichkeit, was auch in der Popkultur einiges bewirkte. Doch grundehrliche Bürger wie Leszek Dziedzik und der Jedwabner Ex-Bürgermeister Krzystof Godlewski sind aufgrund von Drohungen und Schmähungen in die USA emigriert und nicht zurückgekehrt. Es ist verständlich und absolut nachvollziehbar, dass die wenigen in der Region um Jedwabne verbliebenen Juden aus Angst ihre jiddische Identität verschweigen.
Warum aber kam und kommt es gerade in diesem Landstrich um Jedwabne zu einer derartig bösartigen wie gefährlichen Ausprägung des Antisemitismus? Warum konnten die Mörder unschuldiger Opfer als Mitglieder der AK wie Nationalhelden auftreten? Darüber ist natürlich bei angeblich patriotischen Historikern wie Tomasz Strzembosz, der allzu oft auf falsche Aussagen von nicht zur Rechenschaft gezogenen Schlächtern zurückgreift, nichts zu erfahren. Mehr allerdings in Jan Tomasz Gross bedeutsamem Werk »Nachbarn«, das die Akte Jedwabne angestoßen hat. Fündig wird Bikont bei Adam Dobroński, einem Regionalhistoriker aus Bydgoszcz. Im 19. Jahrhundert galt das Gouvernement Łomża, zu dem die Kleinstädte Wąsosz, Radziłów und Jedwabne zählen, als Stammland des Polentums und des Katholizismus. Ein Eldorado für Kleinadelige, die die antisemitische Ideologie von Roman Dmowski (1864–1939), eines lokalen Hauptakteurs der National-Demokratischen Partei, verinnerlichte. Die jiddische Bevölkerung wurde als fremdes Element empfunden, nach dem Ersten Weltkrieg rückte Łomża an die Peripherie und die Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre führte auch zu einem kulturellen Abstieg. Einzig das Polentum und der katholische Glaube wurden konserviert. Dazu kam, dass sich die örtliche Intelligenz moralisch nicht intakt verhalten hatte. Die Eliten in Wąsosz (erste Auslöschung polnischer Juden am 5. Juli 1941), Radziłów und Jedwabne waren oft selbst Rädelsführer und Täter, während in Knyszyn, unweit dieser heruntergekommenen Städte situiert, der Pfarrer und die Gemeindevertreter den plündernden Mob, der auch hier zuvor jüdische und polnische Häuser kenntlich machte, in Schach halten konnte.
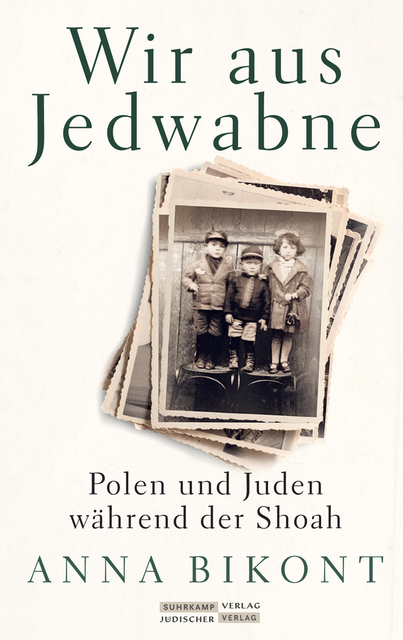
Link: https://www.suhrkamp.de/buecher/wir_aus_jedwabne-anna_bikont_54300.html



















