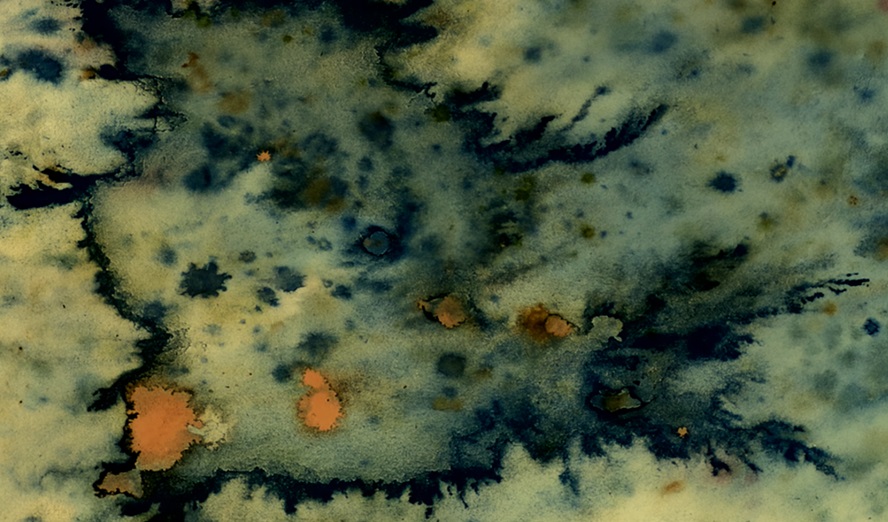Ein wenig nostalgisch schaut sie aus, die neue Pestsäule Wiens, die nach zahlreichen administrativen und politischen Schwierigkeiten ihren Ort auf dem Anitta-Müller-Cohen-Platz im 2. Wiener Gemeindebezirk gefunden hat. Viele alte Radio- und Fernsehgeräte mit ihren wuchtigen und erstaunlich stabilen Holzgehäusen wurden zusammengeschraubt und auf den ersten Blick könnte die Arbeit von Nam June Paik sein. Denn die einzelnen Apparate bilden in ihrer Kombination eine Skulptur, die in ihrer Form in keinem inneren Zusammenhang zu den Apparaten steht. Die Radiokasterl sind die Bausteine einer Pestsäule, worin eine gewisse Naivität liegen mag. War das Pestsäulenoriginal in der Wiener Innenstadt Bildsäule, die optisch den Weg aus dem irdischen Schmutz erlebbar machen will, also vom »Fotzenpoidl« am Boden bis hin zu den Engerln an der Spitze, dann ahmt die neue Pestsäule morphologisch nur nach, ohne eigene Apotheose-Absichten zu haben. Warum aber überhaupt?
Der Dank an die himmlischen Retter dürfte heute hinfällig sein und war auch damals weitgehend dem Repräsentationsbedürfnis des Stifters Kaisers Leopold I geschuldet. Der hatte mit zur Schau gestellter Frömmigkeit politischen Erfolg und ließ unter anderem die Wiener Juden vertreiben. Zum »Dank« heißt der ehemalige jüdische Stadtbezirk bis heute »Leopoldstadt«, was der zu Eröffnung erschienene Bezirksvorsteher Alexander Nikolai auch so sagt (er könnte schließlich ebenso die Formulierung »hier im Zweiten« wählen). Unterm Strich wird somit die Selbsthuldigungsskulptur eines Antisemiten nachgebaut und in dem traditionell jüdischen Bezirk auf eben jenen Platz verpflanzt, der der Zionistin Müller-Cohen gedenken will. Eine seltsame Pointe, aber Geschichte ist eben kompliziert und daran zu erinnern fast ein bisschen unfair, denn um die gewundene Stadtgeschichte geht es bei der im Ganzen sehr gelungenen Skulptur gar nicht.

Schwierige Ortsfindung
Sie sollte ja auch nicht in den 2. Bezirk, sondern in den 1. Bezirk, unmittelbar neben die Originalsäule, was ihrem optischen Nachähneln sicherlich gutgetan hätte, weil der Bezug unmittelbar erfahrbar gewesen wäre. In den zweiten Bezirk wirkt ihre »phallische Formensprache« (Sabine Knierbein) ein bisschen unmotiviert. Wobei nicht von der Hand zu weisen ist, dass für alte Elektroapparate sich meist Männer interessieren und das Team, das bei der Aufstellung geholfen hat, tatsächlich nur aus Männern besteht. Aber Benoît Maubrey wollte genau diesen Bezug heraufbeschwören: Neben die Pestsäule, die nach überstandener Pandemie im Wien des 17. Jahrhundert errichtet wurde, eine neue Säule, die das Ende der Corona-Pandemie markiert. Wie bei so vielem, macht das Virus hier mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Ob die Pandemie sich ihrem Ende nähert, ist eine komplizierte Expert*innendebatte. Am 28. Jänner 2022 bestimmt Covid immer noch das Leben der Menschen in Wien.
Nun ist das Aufstellen einer Säule in Wien kein Lercherlschas, wie der künstlerische Leiter von Tonspur Kunstverein Wien und Initiator des Projektes Georg Weckwerth betont. Zwar seien die Verantwortlichen im 1. Bezirk von der Skulptur begeistert gewesen, haben sich aber vor dem Sound aus den unzähligen Lautsprechern gefürchtet. Die Gewerbetreibenden hatten, geplagt von zwei Jahren Pandemie, einfach Angst, die Kunst könne Kaufwillige vertreiben, und so landete die Skulptur ironischerweise vor dem Gebäude der WKÖ, mithin der Dachorganisation der Handelstreibenden Wiens.
Georg Weckwerth durchschaut den Ort natürlich gleich, an dem die Skulptur zum Stehen kam. Es ist einer dieser leblosen Plätze inmitten betongewordener Investorenmacht. Gerade das WKÖ-Gebäude ist ein übles Beispiel von Sparkassenarchitektur, bei dem die Architekt*innen zur innovationswilligen Formensprache verpflichtet wurden, die zugleich aber nix kosten darf. Das sieht dann immer so aus, wie es leider ausschaut. Neubauareale dieser Art ersticken in einem spätkapitalistischen Repräsentationsbedürfnis, das die Menschen insgeheim gerne vertreibt. Dass es an dem Platz nicht einmal Bänke gibt, wagt Weckwerth im Schatten des WKÖ-Gebäudes zu erwähnen, und man habe deshalb bei der Podesterie darauf geachtet, Sitzmöglichkeiten zu schaffen. Bezirksleitung und Wirtschaftskammer werden dies mit gemischten Gefühlen sehen. Es sind nur wenige Meter bis zum Hinterausgang des Bahnhofs Pratersterns. Na, wer wird sich da wohl niederlassen?

Was bewirkt die Soundskulptur?
Im Grunde sind alle ein bisschen überfordert. Politik und Wirtschaft wünschen sich aufrichtig nach den quälenden Jahren der Pandemie wieder Belebung der Städte, die durchaus eben auch Belebung des Umsatzes sein könnte. Warum nicht Kunst dafür einsetzen? Gerne redet Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien, in ihrer Grußbotschaft von »Hoffnung« und bleibt dabei standestypisch unbestimmt. Auch der Bezirksvorsteher freut sich auf die Umgestaltung und Erneuerung des Pratersterns, er verspricht viel Grün und eine lebenswerte »Leopoldstadt«, in der die Menschen wieder zusammenkommen. Hinter Plattheiten lauert die Ohnmacht. Was aber, wenn mit dem öffentlichen Raum etwas nicht mehr stimmt?
Genau dem möchte sich »Streamers« stellen. Die Eröffnungsveranstaltung soll nur Auftakt verschiedener Events an der »Covid-Sculpture« sein und ist bereits sehr gelungen. Burkhard Stangl musiziert am Fuß der Pestsäule sphärisch auf der E-Gitarre und der Schauspieler Markus Meyer liest aus Camus’ »Die Pest«. Die Pandemie währt nun schon so lange, dass alle schon wieder vergessen haben, dass alle zu Beginn Camus zitiert haben. Die Worte des Existenzialisten sitzen aber noch immer. Nur lernen wir längst nichts mehr von der Pandemie, sondern erfahren zunehmend die existenzielle Ermüdung. Benoît Maubrey ist davon aber nichts anzumerken. Er ist im guten Sinn ein »starker Typ«, der in seiner Wahlheimat Brandenburg 500 Rundfunkgeräte gesammelt hat, um sie sukzessiv in Skulpturen zu verwandeln, die dem öffentlichen Raum neue Interaktionsmöglichkeiten geben sollen.
Mit ausgebreiteten Armen lädt Maubrey die bei schlechtem Wetter leider nur recht spärlich erschienenen Anwesenden ein, die Skulptur zu nutzen. Jede*r soll die unzähligen Lautsprecher der Skulptur einsetzen. Entweder, indem vor Ort sich in den Audioeingang eingestöpselt oder per Telefon angerufen wird. Dann haben die Anrufer*innen (von 8 bis 22 Uhr täglich) drei Minuten Zeit zu sagen, was sie dem Anitta-Müller-Cohen-Platz (und den möglichen anwesenden Passant*innen) zu sagen haben. Per Twitter geht es auch, dann übersetzt eine Maschine die Worte in Stimme. Rufen zwei Personen gleichzeitig an, gibt es eben Kakophonie, wie Maubrey mit einer gewissen Genugtuung erklärt. Es sei im Übrigen »erstaunlich«, was die Menschen so alles am Telefon loswerden wollen, und es sei ein wenig beruhigend, wie selten die Äußerungen ungut sind. Ja, die Pandemie sei schrecklich und zerre an aller Nerven, aber die Angst sei das Hauptproblem. Diese Message will die »Streamers«-Säule in die Welt aussenden und ihr Erbauer zeigt sich allein deswegen optimistisch, weil es überhaupt gelang, die »gordischen Knoten« der Bürokratie zu durchschlagen. Durch ihr Dasein gibt die Säule schon ein wenig Mut.

Öffentlicher Raum und öffentliche Sphäre
Keine Frage. Die Probleme des durch Pandemie und andere Ereignisse leer gewordenen öffentlichen Raumes müssen einmal in den Blick genommen werden. Hierzu liefert am Eröffnungstag Sabine Knierbein, Stadtforscherin und Professorin für Stadtkultur und öffentlicher Raum an der TU Wien einen wertvollen Beitrag. Die Urbanistik unterscheidet zwischen öffentlichem Raum und öffentlicher Sphäre. Ersterer, in dem das öffentliche Leben stattfindet, ist vielleicht gar nicht in einem solch schlechten Zustand. Die Begegnungen im öffentlichen Raum sind divers, es treffen Querdenker*innen auf Antifaschist*innen, die Corona-Demos führen zu Gegendemos und die öffentlichen Angelegenheiten sind somit umstritten und das sei auch gut so. Das ist, was sich Forscher*innen, Künstler*innen und Bürger*innen von einem Stadtraum erwarten dürfen.
Die öffentliche Sphäre hingegen sei in Gefahr. Die Ansichten und verschiedenen Meinungen schrappen physisch auf der Straße und den Plätzen nur mehr aneinander vorbei, gebildet und verfestigt werden die Standpunkte aber mehr und mehr unter der Obhut von Algorithmen. Cambridge Analytica und Co. entwickeln Tools, die nur mehr jene Personen zusammenführen, die gerne gemeinsam gegen die Wände ihrer gummizellenartigen Echokammern anbrüllen. Demokratie braucht aber das Zusammentreffen der verschiedenen Standpunkte. Die öffentliche Sphäre braucht den öffentlichen Raum, der öffentliche Formate anbietet, die auch tatsächlich »öffnen«. Öffnen, um auf das zu hören, was die Einzelnen vielleicht gar nicht hören mögen. Der Urbanist und Geograph Mustafa Dikeç drückte es so aus: »Space is a mode of political thinking.« »Streamers« mag als Beitrag verstanden werden, diesen Raum neu zu eröffnen.
Am Ende der Eröffnungsveranstaltung wird die Skulptur erstmals eingesetzt. Der erste Anrufer ist ein gewisser Peter Weibel, seines Zeichens Direktor des ZKM in Karlsruhe. Er versteht es, seine drei Minuten zu nutzen. Der öffentliche Raum sei Schmutz und Schund anheimgefallen. Werbung und Autolärm verpesten alle Räume (tatsächlich ist die Skulptur kaum zu fotografieren, ohne Werbebotschaften mit auf dem Bild zu haben, dabei ist die Gegend noch im Aufbau befindlich). Dank all der Reklame sei der öffentliche Raum voller Lärm ohne Klang. Laut Weibel müsse ein Gesetz her, das Sound Art fördere und eine akustische Kunst als Heroine des Widerstandes etabliere. – Als die Jeanne D’Arc dieses Widerstandes müssen wir uns durchaus Georg Weckwerth vorstellen, der genau dies seit Jahren in Wien und anderswo tut.

Benoît Maubreys »Streamers – a Covid Sculpture« ist vom 29. Jänner bis zum 1. Mai 2022 Auf dem Anitta-Müller-Cohen-Platz in 1020 Wien zu sehen. Weitere Infos unter: https://streamers-a-covid-sculpture.tonspur.at/