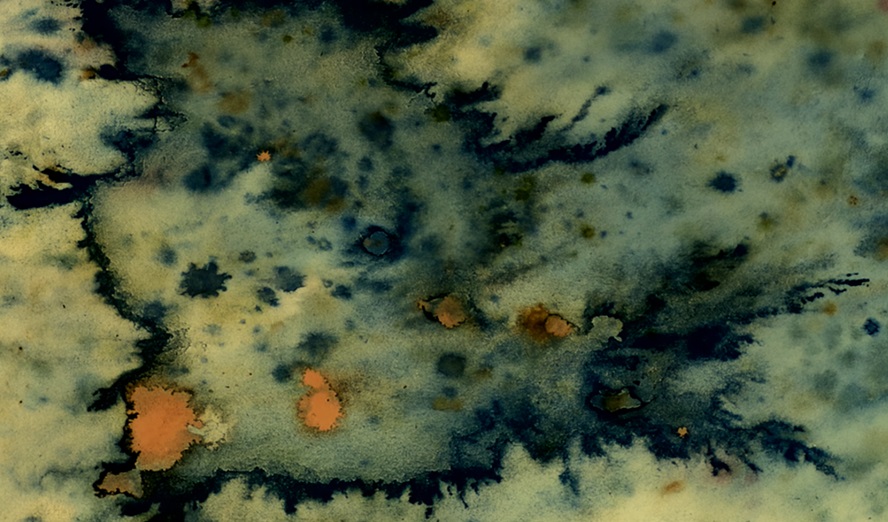Gewalt unter Menschen ist allgegenwärtig, selbst im vermeintlich sicheren Europa sind wir regelmäßig damit konfrontiert, auch wenn sie sich selten in körperlicher Form vor unseren Augen abspielt. Nichtsdestotrotz findet sie an vielen Orten statt. Kunst und Musik sind für von Gewalt Betroffene wichtige Ausdrucks- und Projektionsflächen. Eine weitere Form des Umgangs ist der Protest und zivile Ungehorsam, in denen Menschen deutlich machen, dass sie nicht mehr wegschauen können oder wollen. Wir haben mit dem Gewalt- und Friedensphilosophen Pascal Delhom über die vielen Facetten der Verletzung und des Erleidens gesprochen und wie wir damit persönlich innerhalb und außerhalb der Kunst umgehen können. Dabei ist kaum ein Thema unserer Zeit ausgespart worden. Warum reagieren wir, wie wir reagieren, wenn wir etwa mit Mobbing oder Wohnungslosigkeit konfrontiert sind, und warum lassen wir Menschen im Mittelmeer ertrinken? Wieso werden diskriminierungsarme Sprache oder der Klimaprotest von manchen selbst als Gewalt wahrgenommen, wenn sie doch gerade Verletzungen und Zerstörung verhindern wollen? Und wie hängen die vermeintliche Bedrohung durch Migration und die reale Bedrohung durch Krieg mit unseren Werten und Normen und gegenseitigem Vertrauen zusammen?
skug: Bevor wir über deine philosophische Arbeit sprechen, würde ich gern mehr über dich als Person erfahren. Kannst du uns etwas über deine musikalischen Vorlieben erzählen? Welche Musik hast du in deiner Jugend und im Studium gehört? Und wie beurteilst du die aktuelle Popkultur?
Pascal Delhom: Meine musikalischen Vorlieben sind sehr vielfältig, von Klassik über Jazz bis Pop oder französische Chansons. In meiner Jugend habe ich zunächst wenig Musik gehört, wurde dann aber durch Freunde auf ein wenig Popmusik aufmerksam. Während meines Studiums in Genf entdeckte ich dann die Jazzszene, was für mich eine völlig neue Welt war, da ich zuvor nur klassische Musik durch meine Eltern kannte. Es gab dort Veranstaltungsorte wie das New Morning oder das Sud des Alpes, wo großartige Konzerte und Jam-Sessions stattfanden. In der Nähe des Bahnhofs war auch ein wunderbarer Plattenladen mit der ganzen Breite des Jazz. Das war für mich eine große Entdeckung. Das Umziehen nach Deutschland brachte dann eine deutliche Veränderung in meinem Musikkonsum mit sich. Während Jazz im französischen Radio der Schweiz sehr präsent war, ist in Deutschland neben Schlager mehr Klassik und Pop gelaufen. Durch meine drei Kinder hat sich mein Ohr dann auch an Genres wie Rap und HipHop gewöhnt, wovon ich einiges jetzt auch gerne höre, auch wenn ich es von mir aus nicht auflegen würde.
Du beschäftigst dich viel mit der Art und Weise, wie Gewalt erfahren wird. In der Popmusik wird häufig die unerfüllte Liebe und die romantische Verletzung thematisiert, und in der Entstehung von Genres wie Jazz und HipHop verarbeiteten People of Color unter anderem auch ihre geteilten Gewalterfahrungen. Wie hängt das Moment des Erfahrens von Gewalt aus deiner Sicht mit Musik zusammen?
Tatsächlich, die Tonalität von Musikstücken, aber auch die Texte erzählen sehr viel über Erfahrung. Viele Zuhörer*innen finden ihre eigenen Erfahrungen darin wieder. Es ist eine gute Projektionsfläche für das Zu-Wort-kommen-Lassen der eigenen Erfahrung. Das ist wichtig für Gewalterfahrungen, die oft die Fähigkeit beeinträchtigen, darüber zu sprechen oder sie zu verarbeiten. Menschen finden in Liedern oder Gedichten genau das, was sie gerne gesagt hätten, aber nicht in Worte fassen konnten. Es hilft ihnen, mit anderen darüber zu kommunizieren.
Trifft das auf die Künstler*innen genauso zu wie auf die Zuhörer*innen?
Ich bin nicht sicher, dass die Künstler*innen die Gewalt selbst erleiden müssen. Es ist auch möglich, über Dinge zu singen, die man selbst nicht erlebt hat. Aber häufig ist Musik auch eine Projektionsfläche für die Künstler*innen. Themen der Gewalt können ebenso in einer Weise angesprochen werden, dass sie viel breiter rezipiert werden kann und so mit anderen Erfahrungen in Verbindung gebracht wird. Das sieht man auch an der Reaktion, so steht in Kommentaren auf YouTube oder auf anderen Kanälen häufig, dass die Hörer*innen das auch so erlebten. Das führt mich zu meiner philosophischen Beschäftigung mit dem Thema. Es gibt eine gewisse Anziehung von Phänomenen der Gewalt. Zum einen natürlich, wenn wir das selbst erlitten haben. Es ist etwas, was uns beschäftigt, was uns nicht in Ruhe lässt, was in vielfacher Weise zu nah an uns bleibt. Das macht es auch schwierig, Gewalt zu analysieren und sie in Worte zu fassen. Wir können nur schwer Distanz dazu gewinnen. Erfahrene Gewalt klebt an uns. Zum anderen sind die Erfahrungen wichtig, in denen wir Zeugen von Gewalt wurden. Auch diese Momente können wir nicht einfach ignorieren, das Weggucken fällt uns schwer. Es kann uns zum Handeln bringen, wir können die Flucht ergreifen oder nach Hilfe suchen oder vielleicht selbst mit einer gewaltsamen Reaktion antworten.
In einem deiner Texte schreibst du, dass beim Hinschauen auch etwas unangenehm Voyeuristisches durchbrechen kann. Bei der Musik, im Theater und im Film ist aber das Gegenteil der Fall und wir schauen hin, fühlen mit und finden uns darin wieder. Wo würdest du den Kipppunkt vom Wegschauen zum Hinschauen sehen?
Stimmt, wir können schnell den Eindruck haben, dass dort etwas passiert, was wir nicht miterleben sollten. Und nicht nur, weil wir Gewalt selbst nicht miterfahren möchten. Auch weil die Personen, die das erleiden, es vielleicht verstecken wollen. Der mitleidende Blick kann ebenso verletzend sein, Scham auslösen oder die Dimension der Gewalt noch größer machen. Das passiert zum Beispiel im Cybermobbing, wo sich Personen nie vor diesen Blicken schützen können. Zugleich gibt es einen Appell der verletzenden Gewalt, dass das, was dort passiert, nicht versteckt bleiben darf. Es muss in Worte gefasst werden, damit die Dimension des Unrechts, die mit Gewalt einhergeht, thematisiert wird und als Unrecht erkannt werden kann. Hier spielt die philosophische Arbeit eine wichtige Rolle. Und auch wenn wir Zeug*innen von Gewalt werden, spüren wir diese Form der Anrufung, worauf wir zu antworten haben. Wir können das auch aus Selbstschutz ignorieren, aber wenn wir das nicht tun, lässt es uns keine Ruhe mehr. Das ist der Grund, warum viele Menschen in einer Menschenrechtsorganisation, in der Therapie oder auch in der Kunst sich aktiv mit Gewalt beschäftigen.
Ich finde es besonders bei wohnungslosen Personen schwer einzuschätzen, was jetzt der richtige Umgang ist. Häufig ist es ja deutlich, dass diese Gewalt erlitten haben.
Es ist eine Form der strukturellen Gewalt. Es gibt Formen der Gewalt, die nicht notwendigerweise mit Gewalthandlungen verbunden sind. Als institutionelle oder strukturelle Gewalt wird etwas dann erlitten, wenn es von Entscheidungen der Menschen abhängt, dass dieses Unglück passiert. Obdachlosigkeit ist kein Naturphänomen. Sie besteht aufgrund der Organisation der Gesellschaft und ist mit persönlichen Schicksalen von Gewalt verknüpft. So werden beispielsweise viele Frauen aufgrund von häuslicher Gewalt in die Obdachlosigkeit getrieben. Diese Kombination von struktureller und unmittelbarer Gewalt zwingt uns auch dazu, Gewalt viel breiter zu verstehen. So ist Gewalt das, was uns oder andere Menschen verletzt und was von Menschen abhängt.
Bleibt das auf der persönlichen Ebene oder kann Gewalt auch von Gruppen erfahren werden, so wie es bei Protestbewegungen häufig anklingt?
Nein, es kann durchaus kollektiv sein. Das Erleiden der Gewalt selbst ist etwas, was uns als Individuen geschieht. Doch kann ich Gewalt nicht nur erfahren, weil ich ich bin, sondern auch als Teil einer Gruppe. Politische Bewegungen sind häufig eine Reaktion darauf, dass eine ganze Gruppe Zwang erfährt oder ausgeschlossen und angegriffen wird. Und auch hier muss ich die Gewalt nicht selbst erfahren haben. Viele Menschen reagieren im Protest auf Gewalt, um exkludierte Gruppen zu unterstützen.
Die Protestbewegungen im Rahmen von Black Lives Matter, der Klima- und der Corona-Krise oder auch Proteste von FLINTA* klagen alle Gewalterfahrungen ein. Sie sprechen von Verletzungen der Freiheit und Unversehrtheit aufgrund anderer Menschen. Ist das im Kern das Gleiche? Wie kommt es, dass wir das alles Gewalt nennen, obwohl das so unterschiedliche Dinge sind?
Ich glaube tatsächlich, dass vieles als Gewalt erfahren werden kann. Dazu gehört auch, dass wir die Quelle der Gewalt anderen zuschreiben. Es ist nicht immer der Fall, dass ich eine Person sehe, welche mir oder anderen Menschen Leid zufügt. Ich habe viel mehr ein Gefühl der Unsicherheit, von dem ich sage, dass Menschen mir Böses wollen. Das erfahre ich dann auch als Gewalt. Es ist somit auch eine Frage der Zuschreibung. Und die Erfahrung müssen wir erst einmal ernstnehmen. Und dennoch ist es gesellschaftlich wichtig, zu beurteilen, ob es wirklich soziale, politische oder gesellschaftliche Faktoren sind, die die Verletzungen verursachen oder ob es sich um eine Verschwörung oder Vorurteile handelt. Dafür bemühen wir dann häufig einen politischen Diskurs. Wir können uns aber auch die Frage stellen, wie wir als einzelne Personen auf diese Berichte zur Gewalt antworten? Geht es dort darum, Gewalt als Unrecht zu benennen und zu beurteilen, oder wird Gewalt dort vielmehr als Argument benutzt, um selbst Formen der Gewalt zu rechtfertigen? Ist es das Ziel, Menschen auszuschließen und zu verurteilen, denen wir die Schuld am Erleiden von Gewalt zuschreiben?
Komplizierter ist noch dazu, dass das Einklagen von Gewalterfahrungen teils selbst als Gewalt empfunden wird. Klimaaktivist*innen werden zu Terrorist*innen hochstilisiert und diskriminierungsarme Formulierungen werden als Gewalt an Kultur und Sprache wahrgenommen. Kommen wir aus diesem Zirkel raus? Gibt es eine Möglichkeit, dem vorzubeugen, und wie verhandeln wir das?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Es gibt erst einmal viele Fälle, wo sich diese Frage nicht stellt. Eine Überschwemmung oder andere Naturkatastrophen erscheinen zuerst als Unglück, um es mit den Worten der amerikanischen Philosophin Judith Shklar zu sagen. Doch betroffen sind diejenigen, die in einer niedrigen Lage der Stadt wohnen, mit niedrigen Mieten und hohen Kosten für Versicherungen. Und die Voraussetzungen der Menschen sind ähnlich, es sind Menschen einer bestimmten Gesellschaftsgruppe, einer bestimmten Klasse oder Ethnie. Wenn wir diese Situationen als strukturelle Gewalt benennen, dann tun wir niemandem Gewalt an. Man bringt etwas ans Tageslicht, was von Menschen abhängt und gelöst werden muss. Doch bei vielen politischen Bewegungen wird tatsächlich die Reaktion auf Gewalt selbst als Gewalt wahrgenommen. Bei den Klimaaktivist*innen ist ja das Interessante, dass da förmlich danach gesucht wird, dass sie endlich mal etwas tun, was als Gewalt charakterisiert werden kann. Wenn dann einmal ein Krankenwagen nicht durchkommt, dann wird diese Geschichte aufgeblasen, so dass wir zeigen können, dass die eben auch gefährlich sind. Auch wenn das in anderen Stausituationen hundertfach genauso geschieht. Dieser Fokus ist Ergebnis des sozialen Diskurses, der analysiert und dekonstruiert werden muss. Menschen, die sich am Boden festkleben, setzen sich der Aggressivität anderer aus. Wollen wir das wirklich Gewalt nennen? Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob man Gewalt an Sprache ausüben kann. Aber Gewalt an dem Empfindungsvermögen von Menschen, die in der Sprache oder nichtsprachlichen Umgangsformen eingebettet sind. Etwas wird durchaus als Gewalt empfunden, wenn die Veränderungen mit Zwang durch eine Autorität verbunden sind und die Menschen stigmatisiert werden, die der Reform nicht folgen. Andersherum kann die Sensibilität für das erhöht werden, was tatsächlich in unserer Sprache ganze Gruppen von Menschen verletzen kann. Es gibt viele rassistische, klassistische oder sexistische Elemente in unserer Sprache, bei deren Überwindung eine Akzeptanz auch für die Veränderungen notwendig sein muss. Wir wollen ja miteinander sprechen können, ohne dass dadurch Menschen Gewalt angetan wird. Dann ist solch ein Umgang mit struktureller Gewalt nötig. Es sollte aber mit einem Wachstum der Sensibilität für andere verbunden werden und nicht einer Zwangsmaßnahme.
Diese Beschreibung erinnert mich sehr an deine Unterscheidung von Einbruch, Ausschluss und Zwang als Formen erlittener Gewalt. Handelt es sich hier um eine Alternative, um nicht immer zwischen körperlicher oder struktureller Gewalt unterscheiden zu müssen?
Ja, es gibt viele Formen von Gewalt, die im Diskurs unterschieden werden. Zum einen gibt es die physische Gewalt, bei der der Körper direkt betroffen ist. Dann gibt es psychische, verbale und auch symbolische Gewalt, die oft mit Sprache verbunden sind. Mein Ansatz besteht darin, mich auf das Erleiden von Gewalt und die Verletzungen durch Gewalt zu konzentrieren, anstatt mich auf den Akt der Gewalt selbst zu fokussieren. Es geht also darum, zwischen verschiedenen Formen von Verletzungen zu unterscheiden. Hierbei halte ich es für relevant, zwischen Formen von Gewalt zu unterscheiden, die in die persönliche Sphäre einer Person oder einer Gruppe eindringen, und solchen, die darin bestehen, Menschen aus einer Gruppe oder einer gesellschaftlichen Zugehörigkeit auszuschließen. Ich denke auch, dass jede Form von Gewalt ein Element des Zwangs beinhaltet. Gewalt geschieht immer gegen den Willen der Betroffenen oder ohne ihre Einwilligung. Es gibt jedoch auch Gewalt, bei der der Zwang im Vordergrund steht. Mit Zwang meine ich aber nicht die Negation einer Freiheit, in der wir alles tun können, was wir möchten. Mit diesem Begriff der Freiheit möchte ich nicht arbeiten. Bei dem gewaltsamen Zwang geht es darum, gezwungen zu sein, etwas tun zu müssen, was ich nicht wollen darf. Da verweise ich auf die Definition der politischen Freiheit bei Montesquieu. Ihm geht es bei Freiheit darum, was wir wollen sollen. So besteht politische Freiheit darin, dass wir nicht gezwungen sind, das zu tun, was wir nicht wollen sollen. Sie meint aber auch, dass wir nicht daran gehindert werden, das zu tun, was wir wollen sollten. Zwang ist dann immer das, was im Widerspruch zum eigenen Selbstverständnis steht, sei es persönlich, gesellschaftlich oder moralisch. Diese Art von Zwang kann auf äußere Einflüsse oder gesellschaftliche Normen zurückgehen und wird als Gewalt empfunden. Es ist wichtig anzumerken, dass soziale Normen aber auch auf anderer Weise eine Rolle spielen. Diese Normen regeln nicht nur das Handeln, wie es oft in der Moralphilosophie diskutiert wird, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen miteinander leben. Nehmen wir den Einbruch, in dem die soziale Norm der Integrität verletzt wird. Wie wenn der Körper oder die private Sphäre verletzt oder in die Wohnung eingebrochen wird. Soziale Normen bestimmen zum Beispiel, wer wann und unter welchen Umständen den eigenen Körper berühren darf. Der Verstoß gegen solche sozialen Normen kann als Gewalt empfunden werden. Ebenso betrifft der Ausschluss aus sozialen Gruppen eine gesellschaftliche Norm. Die Norm der Zugehörigkeit wird verletzt. Wir sind nie allein auf der Welt, Gruppen ermöglichen uns, die Person zu sein, die wir sind. Anerkennung, Zugehörigkeit und auch Abhängigkeit von einer Gruppe sind entscheidend für unsere Identität. Ein Ausschluss fühlt sich daher auch als Verletzung an.
Meinst du mit Normen jetzt gemeinsame Werte?
Ich weiß nicht, ob es immer Werte sind. Unsere westlich-europäische Kultur tendiert dazu, von Werten zu sprechen. Andere sprechen vielmehr von Gesetzen, Regeln oder Normen. Da müsste ich mich nicht um das Wort streiten. Ich denke aber tatsächlich, dass so etwas wie Integrität, Zugehörigkeit, politische Freiheit als Normen verstanden werden können und das diese den Zusammenhalt von Menschen regeln.
Im Zuge der Migration aus Nordafrika ist die Gefährdung der sogenannten christlich-europäischen Werte häufig Thema, als Gefährdung der »europäischen Integrität«. Als Reaktion lassen wir die Menschen im Mittelmeer ertrinken. Ist das etwas, das wir mit Integrität wollen können?
Es ist eine Frage des Diskurses. Wird die Ankunft vieler Menschen als Verletzung unseres Lebensstils betrachtet und thematisiert? Oder handelt es sich um einen Einbruch in »unseren« Lebensraum? Schon Kant sagte, dass der Boden niemandem gehört. Daraus resultiert kein Gastrecht, aber der Anspruch auf Hospitalität, also eine Einstellung der Gastfreundschaft. Wir weisen Menschen nicht ab oder betrachten sie nicht als rechtslos, nur weil sie sich auf einem Boden befinden, der nicht ihrer ist. Doch der Diskurs besteht weiterhin oder überwiegend darin, die Ankunft von Menschen so darzustellen, als würde ein Einbruch verursacht. Das können wir dekonstruieren, aber andererseits muss auf die Normen des Zusammenlebens verwiesen werden, die durch unsere Reaktionen verletzt werden. Wenn wir sagen, dass wir ein Kulturraum sind, der sich auf die Menschenrechte bezieht, dann ist das Teil unserer Identität. Diese Werte müssen wir verteidigen. Und mit der inhumanen Politik von Pushbacks verletzen wir die eigenen Werte. Das ist grausam gegenüber den Flüchtenden, aber dazu auch eine Form der Selbstverletzung. Wir handeln gegen die Dinge, von denen wir behaupten, dass sie uns ausmachen.
Nun beschäftigst du dich neben Gewalt auch mit der Friedensforschung. In einem Interview hast du gesagt, dass dafür gegenseitiges Vertrauen wichtig ist. Werte und Überzeugungen spielen auch bei Frieden eine wichtige Rolle, weil Vertrauen dann gestiftet wird, wenn wir Überzeugungen und Werte mitteilen und dann auch nach diesen handeln. Sind Normen und Werte der Ort, an dem sich Friedensforschung und Gewaltforschung überschneiden?
Ich würde mich nicht direkt als Friedensforscher bezeichnen, sondern als Friedensphilosophen. Der Begriff Frieden umfasst für mich nicht nur das Gegenteil von Krieg, sondern vielmehr das Gegenteil von Gewalt. Frieden definiere ich als eine Form des Zusammenlebens, die möglichst frei von Verletzungen ist. Es geht darum, dass Menschen sich darum bemühen, Verletzungen durch verschiedene Formen von Gewalt zu vermeiden und Konflikte gewaltfrei zu lösen. Wenn viele Menschen zusammenleben, gibt es natürlich Konflikte. Und es erfordert große Anstrengungen und gemeinsames Handeln zwischen Einzelpersonen, Gruppen und politischen Organisationen, damit diese Konflikte ohne Gewalt gelöst werden. Diese aktive Kooperation wiederum erfordert Vertrauen. Dabei ist Vertrauen nicht immer positiv. Wir haben erst vor Kurzen in den Nachrichten gehört, wie das Vertrauen von vielen Eltern und Kindern in die evangelische Kirche systematisch missbraucht wurde. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Das Vertrauen in eine Führungsperson kann politisch verheerend sein. Dennoch ist Vertrauen notwendig für erfolgreiche Kooperation. Es geht einerseits darum, dass wir bereit sind, anderen zu vertrauen. Das bleibt mit einem gewissen Risiko verbunden. Wir müssen uns überlegen, worauf wir uns einlassen und welche Risiken wir eingehen wollen. Andererseits müssen wir auch selbst vertrauenswürdig sein. Das ist nicht einfach gegeben und muss aufgebaut werden, indem wir zuverlässig handeln und die anderen nicht verletzen. Dazu gehört auch, dass wir zu unseren Normen und Werten stehen und entsprechend handeln. Auf politischer Ebene können wir nicht sagen, dass wir den Frieden wollen, während wir seit dreißig Jahren systematische Angriffskriege außerhalb unseres Territoriums führen. Das ist nicht vertrauenswürdig und tatsächlich friedenszerstörend.
Dass Vertrauen nicht generell etwas Gutes ist, ist ein wichtiger Punkt. Du hast an anderer Stelle davon gesprochen, dass wir in einer Vertrauensgesellschaft leben. Bei vielen wichtigen Dingen, wie dem Geld, der eigenen Sicherheit oder der Erziehung, vertrauen wir darauf, dass sich andere darum kümmern werden.
Wir delegieren Aufgaben, aber damit geben wir nicht unsere Verantwortung ab. Wir glauben, dass Lehrer*innen besser darin sind, Schulfächer zu unterrichten, als wir. Doch die Verantwortung bleibt letztendlich bei uns. Und wenn etwas schiefläuft, ist es immer noch unsere Angelegenheit. Verantwortung zu übertragen, ist nicht einfach. Bestimmte Aufgaben delegieren wir jedoch ständig, weil wir sonst nicht überleben könnten. Das ist ein sehr umfassender Prozess. Heute Morgen habe ich Tee getrunken. Wer hat den gepflanzt und gegossen? Wer sorgt dafür, dass er richtig schmeckt und sicher ist? Wenn man darüber nachdenkt, wird schnell deutlich, wie sehr wir von anderen abhängig sind und nicht alles kontrollieren können oder wollen. Wenn wir alles kontrollieren müssten, wäre das genauso eine Form von Gewalt.
Dieser Vertrauensverlust lässt sich ja auch bei den Corona- und Klimaprotesten finden. Ist das so ein Moment, indem der Verlust von Vertrauen in erlittene Gewalt umschwingt?
Der Verlust von Vertrauen kann zu Gewalt führen, muss aber nicht unbedingt. Ich war vor einigen Jahren bei einer Gesprächsrunde im Berliner Gorki Theater dabei, bei der auch die belarussische Philosophin Olga Shparaga anwesend war. Diese hat sich auch an den Protesten in Belarus beteiligt und hat davon berichtet. Sie betonte, dass das Vertrauen in die Regierung verloren gegangen ist. Trotzdem entstand eine Art horizontales Vertrauen zwischen den Menschen, die protestierten. Das klassische politische Vertrauen gegenüber Repräsentanten ist vertikal, es geht in die Höhe. So hat John Locke gezeigt, dass es dadurch erzeugt wird, dass die Regierenden in unserem Sinne handeln. Wenn das Vertrauen nach oben zerfällt, zwingt es uns dazu, ein Vertrauen zwischen uns aufzubauen, sei es zivilgesellschaftliches oder gruppendynamisches Vertrauen. Dadurch kann politische Macht entstehen und neue Handlungsfähigkeit gewährleistet werden. Vertrauensverlust muss also nicht zwangsläufig zu Gewalt führen. Wenn wir jedoch den Eindruck haben, dass wir isoliert sind und keine Mittel zur Handlung haben und die Leute, denen wir diese Aufgabe anvertraut haben, nicht in unserem Sinne handeln, ist das sehr frustrierend. Es ist wichtig zu beurteilen, welche Art von Antworten darauf gegeben werden. Reagieren wir, indem wir andere Formen der Gewalt propagieren, zum Beispiel den Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen? Oder versuchen wir, eine andere Dynamik zu schaffen, so mühsam es auch sein mag, wie es das Beispiel Weißrussland zeigt?
Das passiert ja schon innerhalb des Protestes selbst, also in dem Moment, wo Leute miteinander auf die Straße gehen, ein Problem als gemeinsames Problem festmachen und kooperative Umgangsform erproben. Das ist für das Selbstverständnis vieler Menschen sehr wertvoll, oder?
In der Kooperation liegt nicht nur eine momentane Chance, sondern sie zeigt auch langfristige Wirkungen. Als Gewalt- und Friedensphilosoph werde ich häufig gefragt: »Was kann ich als Individuum tun?« Sicherlich, vielleicht dusche ich einmal kalt, aber das wird die Welt nicht verändern. Das muss in der Politik passieren. Ich denke jedoch, dass es zwischen den verschiedenen Ebenen – von Regierungen über große Organisationen bis hin zum Individuum – viele Möglichkeiten des kollektiven Handelns gibt. Diese müssen jedoch organisiert werden und sie funktionieren umso besser, je effektiver die interne Kooperation ist und je mehr Vertrauen vorhanden ist, egal zu welchen Zwecken. Auch wenn diese Form der Kooperation und des Vertrauens zu Zwecken erfolgt, die ich persönlich nicht unterstütze. Auch da zeigt sich, dass es eine wichtige Ebene des Handelns ist. In verschiedenen politischen Bewegungen sehen wir, wie das Empowerment politischer Akteur*innen funktioniert. Menschen, die sich vorher hilflos gefühlt haben, entdecken in kollektiven Handlungen, dass sie sehr wohl etwas bewirken können und dass ihre Handlungen wichtig und relevant sind. Dann wird es wieder zu einer friedensphilosophischen Frage darüber, wie Konflikte organisiert werden können, so dass sie ohne Gewalt gelöst werden können oder dass Formen des Zusammenlebens gewaltarm sein können.
Und selbst bei den besten Vorsätzen bleibt Vertrauen brüchig. Mit dem Angriffskrieg Russlands wurde unser Vertrauen auf Frieden enttäuscht. Aufgrund der Abhängigkeit von Öl- und Gaslieferung ist das Gegenteil der Handlungsmöglichkeit eingetreten, es hat es schwieriger gemacht, im Sinne unserer Werte auf die militärischen Angriffe zu reagieren.
Auf beiden Seiten wurde Vertrauen zerstört, das muss ich betonen. In den späten 1980er-Jahren gab es vertrauensbildende Maßnahmen, hauptsächlich durch Gorbatschow initiiert. Einseitige Abrüstungsschritte sollten Vertrauen schaffen, und tatsächlich haben sie das auch getan. Ab Mitte der 1990er-Jahre gab es jedoch systematische Verletzungen dieses Vertrauens, vielleicht sogar schon etwas früher mit dem ersten Tschetschenienkrieg durch Russland, aber auch durch Russlands Politik in Georgien. Seitens des Westens gab es auch Vertrauensbrüche, wie die NATO-Intervention im ehemaligen Jugoslawien in den frühen 1990er-Jahren. Russland empfand auch etwa das Projekt eines Schutzschilds gegen ballistische Raketen in Europa seit 2012 als eine Bedrohung und betonte dies wiederholt. Die Vertrauensverletzungen ereigneten sich also auf beiden Seiten. Und wir haben keine Maßnahmen ergriffen, um neues Vertrauen zu ermöglichen. Seit Mitte der 1990er-Jahre haben wir keine kooperative Politik der Zusammenarbeit mehr betrieben. Das ist ein Problem für die heutige Situation. Trotzdem haben wir uns so verhalten, als würden wir es tun und als könnten wir einander vertrauen.
Stimmt, Vertrauen und Frieden ist nichts, was einmal hergestellt wird und dann ewig vorhält.
Es ist auch wichtig, zu beachten, dass sich die Normen verändern, auf denen Vertrauen und Frieden aufbauen. Was in einer Gesellschaft als Zugehörigkeit, Zwang, Freiheit oder Integrität verstanden wird, ist entscheidend, aber auch veränderlich. Auch die Art und Weise, wie Verstöße gegen diese Normen wahrgenommen werden, entwickelt sich in Gesellschaften weiter. So hat sich zum Beispiel das Verständnis von Vergewaltigung in der Ehe stark verändert. Wir müssen feststellen, dass viele Frauen Gewalt erlebt haben, obwohl die politische Norm dies über Jahrhunderte nicht als solche benannte und Tätern sogar einen Schutzraum zusicherte. In solchen Momenten müssen wir unser Verständnis von Normen ändern. Auch das ist ein wichtiger Aspekt für das politische Handeln.
Am Ende sind nicht nur die Regeln menschengemacht, sondern auch unsere Werte und Überzeugungen, welche sich immer wieder von neuem bewähren müssen.
Und auch wenn sie als Teil der Gesellschaft menschengemacht sind, sind sie nicht immer mit Vorsatz oder Plan gemacht. Wir bewirken Dinge im gemeinsamen Handeln, die wir nicht voraussagen oder voraussehen können. Politisch, mit Hannah Arendt gesprochen, setzen wir Initiativen. Wo sie uns dann hinführen, ist nicht oder nur sehr schwierig planbar. Versprechen und Vertrauen kann hier als Art der Eindämmung verstanden werden, als Sicherheit in diesem offenen Feld.
Also stehen wir vor der Notwendigkeit, für den Frieden immer neu anzufangen …
… und dort zu restaurieren, wo er verletzt worden ist. Es ist die Arbeit eines Sisyphus, denn Frieden ist kein Zustand, sondern eine Aufgabe.

Link: https://www.uni-flensburg.de/philosophie/personen/dr-habil-pascal-delhom