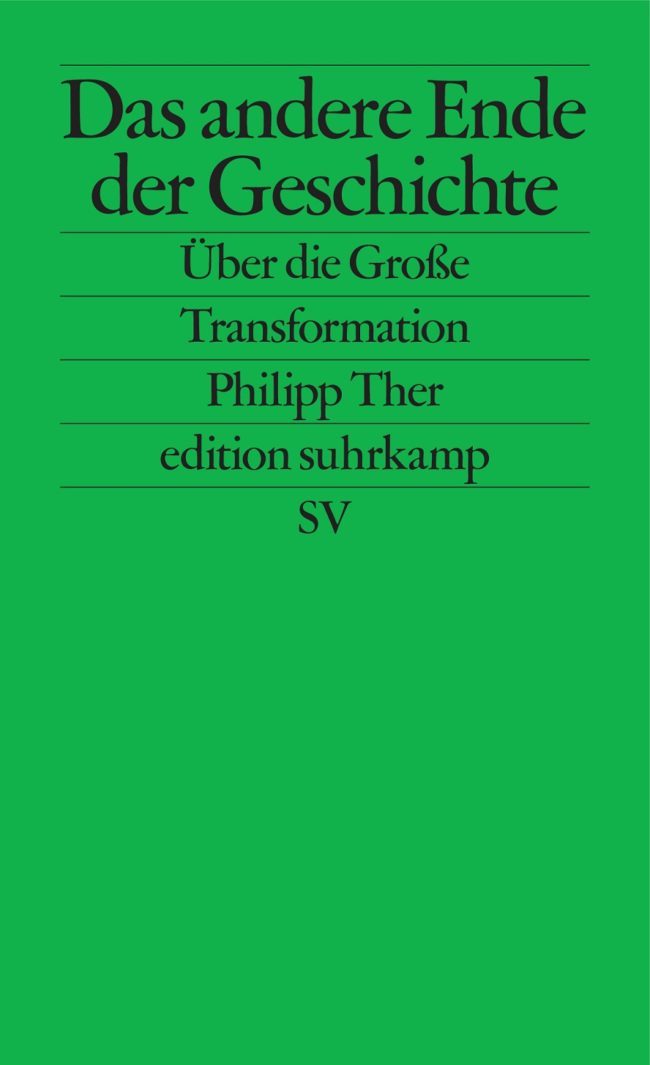Dass Francis Fukuyama mit seinem 1992 erschienen Buch »Das Ende der Geschichte« eher einer Art »The Winner Takes It All«-Erzählung verschrieben war, dürfte mittlerweile ebenso klar sein, wie seine Fehleinschätzungen geopolitischer Verhältnisse (von 9/11 ganz zu schweigen). Dennoch geistert dieses »Ende« immer noch als Erfolgsgeschichte »des Westens« durch diverse (bürgerliche) Feuilleton-Spalten und wird solchen verkauft.
Philipp Ther, der schon mit »Die dunkle Seite der Nationalstaaten. Ethnische Säuberungen im modernen Europa« (Vandenhoeck & Ruprecht, 2011) und »Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent: Eine Geschichte des neoliberalen Europa« (Suhrkamp, 2014) grundlegende Bücher zu den zentralen Problemen beim Thema »Europa« geschrieben hat, geht hier nun als sichtlich enttäuschter Linksliberaler jenen Momenten nach, wo es (historisch) auch hätte anders verlaufen können. Sein »Nachdenken über die Schwäche der Linken und der Liberalen« versteht sich dabei als ausführliches »Kehren vor der eigenen Haustür«, auch weil das »Annus horribilis 2016« (Trump, Brexit) als »Endpunkt längerer Entwicklungen« gesehen werden muss.
Er beruft sich dabei auf den auch von Marx beeinflussten Soziologen Karl Polanyi und dessen 1944 veröffentlichten Klassiker »The Great Transformation«. Hierin wird die Theorie eines (in die Demokratie) »eingebetteten« Kapitalismus entwickelt, wobei es auch um das »Bedürfnis nach Anerkennung« gegenüber den Erfahrungen von »sozialer Abgrenzung« geht. Fehlt dies, so Polanyi, wird auch die working class anfällig für faschistische/nationalsozialistische Politik (etwa als Diskursverschiebung von »class« zu »race«).
Die »Entbettung« des Marktes (ab 1989 von Neocons wie Milton Friedmann propagiert) zeigte nun nicht nur, »dass der Kapitalismus offenbar auch ohne Demokratie (…) funktionieren kann« (vgl. China), sondern dass der »Illiberalismus« eine Konsequenz dieser neoliberalen Verschiebung sein kann (wie etwa in Ungarn zu beobachten ist). Dazu stellt Ther nüchtern fest: »Der Aufschwung des Rechtspopulismus begann in der Zeit des radikalen Neoliberalismus«.
Gobale Tristesse
Ther geht dabei von eigenen Beobachtungen aus und berichtet, wie sich ab den 1990ern Städte im Ostblock, den nordenglischen Industrierevieren und dem Rust Belt der USA immer mehr zu ähneln begannen, bis sie alle jene »postkommunistische Tristesse« ausstrahlten, die mit der »Tirade Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung« einherging, welche sich schnell als realexistierende »Beschneidung von staatlichen Kernkompetenzen« bei gleichzeitiger »Deindustrialisierung« herausstellte. Es sei daher auch kein Zufall, dass gerade jene Staaten, die sich als erste dem Neoliberalismus verschrieben haben (etwa Polen, Ungarn und England), heute als Hotspots »populistischer Revolte« (bei parallellaufendem »Ausbau der nationalistischen Propaganda«) präsentieren.
Andererseits wurden für Ther die Bedingungen für den Aufstieg einer Partei wie der der AfD (für das, was sie als »Anrufung« instrumentalisieren kann) schon 1989/1990 geschaffen, indem es rechtlich eben nicht zu einer »Wiedervereinigung« (gleichberechtigter Staaten), sondern zu einem »Beitritt« der DDR (als »Erweiterung Westdeutschlands«) gekommen ist. Vor allem für die Ex-DDR bedeutete »Privatisierung« (Stichwort »Treuhand«) Stilllegung, wodurch ein Pool von »Transformationsverlierern« geschaffen wurde (die sich vor allem gegenüber anderen Ex-Ostblockstaaten mit einem massiven wirtschaftlichen Downgrading konfrontiert sahen), die vor allem aus ökonomischen Gründen der Zeit vor 1989 nachtrauerten und an die sich nun die »multiplen Schutzversprechen der Rechtsnationalisten« richten konnten.
Das permanente Reaktivieren (realer) Ängste vor Arbeitslosigkeit (im Sinne gesellschaftlicher »Entwertung«) gehört hierbei ebenso dazu wie die steten Verweise auf die »Systemparteien« und deren Arbeitsmarktreformen (Hartz IV). Als gemeinschaftsstiftendes Moment identifiziert auch Ther jenen (europaweiten) »welfare chauvinism«, der das (minimal) Erreichte dadurch schützen will, dass es absolut nicht geteilt wird. Fatalerweise definiere sich aber auch »Europa« immer mehr durch einen »fiskalen Nationalismus«, bei dem alle der »schwarzen Null« aus Gründen der »nationalen Selbstbezogenheit« hinterherlaufen.
Das Vakuum, welches das »Ende des Staatssozialismus« hinterlassen hat, wurde dabei wohl von Berlusconi am exemplarischsten genutzt, um an die Macht zu kommen (bzw. dann den Staat wie »sein Firmenimperium« zu leiten). Auch hier führte »Privatisierung« nicht zu »mehr Wettbewerb«, sondern zu »Kartellen und Monopolen«, wodurch Italien jedoch derart »heruntergewirtschaftet« wurde, dass es zu einer (fast nur mit ehemaligen Ostblockstaaten vergleichbaren) Arbeitsmigration kam. Die Paradoxie all dessen besteht nun jedoch darin, dass gleichsam wegen Berlusconis Erbe Salvini gewählt wird.
Es war einmal … »America«
Nicht von ungefähr widmet sich Ther dabei der Situation in den USA sehr ausführlich, sieht er sich doch selbst auch als jemanden, der durch Trump gerade dabei ist, seine Vorstellung von »America« (als trotz allem immer noch gerne imaginiertem Sehnsuchtsort) zu verlieren. Wobei die Gründe für Trump auch für Ther bei Fehlentscheidungen unter Clinton und Obama liegen.
Das begann bei Clintons Abkehr vom Zeitalter des »big government« (ausgerechnet zu einer Zeit, nachdem unter Reagan die Infrastruktur des Landes zu zerfallen begonnen hatte) und seinen massiven Kürzungen von (unter Nixon eingeführten) Sozialleistungen bei gleichzeitigem »Schulterschluss mit den Börsen«, der als »Öffnung zur Mitte hin« verkauft wurde. Fatalerweise führte Obama diese Politik fort, was auch dazu führte, dass er sich angesichts der Krise von 2008 (als 4,3 Millionen US-Familien ihre Häuser verloren) auf Anraten seines damaligen Finanzministers dazu entschloss, die Banken zu retten, anstatt eine Stundung der Kredite in Angriff zu nehmen.
Genau solche Entscheidungen seien es aber, die den Zorn gegen Washington und das Gefühl, von »denen da oben« betrogen worden zu sein, speisen. Trump musste da (neben seiner rassistischen Agenda) nur den richtigen Knopf drücken. Es sind ja nicht die Banken, die Börse, die Finanzdienstleister, Hedgefonds, Steueroasen oder was es sonst noch an ökonomischen Ursachen für das Crashjahr 2008 gibt, die Trump angreift, sondern »die Politik« und »die Eliten« (und zwar die politischen, nicht die wirtschaftlichen).
Für die Rechten ergibt sich daraus eine andauernde »Win-Win-Situation«: Schließen sie sich mit den Börsen kurz liegt das quasi in der Sache, tun das hingegen die anderen, kann dies (von den Rechten!) zum Verrat am »Volk« (oder der »working class«) hochgejazzt werden, wofür sich nun Milliardäre (indem sie gegen »die Eliten« wettern) »im Namen des Volkes« rächen werden.
Möglich wurde dies jedoch erst durch die Einschnitte in staatliche Dienstleistungen durch die Neoliberalisierung links-liberaler bzw. sozialdemokratischer Positionen, wodurch es zu jenen neuen »working poors« kam, die weder alte noch ehemalige »working class« (inkl. Klassenbewusstsein) sind, sondern eigentlich nur noch »wütend«, »besorgt« und »ängstlich«.
Die nicht mitspielen dürfen
Noch komplexer gestaltet sich jedoch das Verhältnis »des Westens« zu Russland und der Türkei, wobei Ther hier wohl am gründlichsten »vor der eigenen Haustür« kehrt. Und das nicht ohne Grund, etwa wenn er gleich zu Beginn seiner Analysen bezogen auf die Türkei schreibt: »Wiederholte Zurücksetzung und der Bruch von Versprechungen sind (…) eine erste Antwort auf die Frage, warum der Westen die Türkei verloren hat und dies vermutlich auch so wäre, wenn dort ein anderer Präsident (…) regieren würde.«
Es geht um historische Versäumnisse und das Leugnen von Verantwortungen. Dies zeigt sich für Ther nicht zuletzt auch bei der Bewertung des Genozids an den Armeniern. Denn was 1923 vom Völkerbund als »Austausch von Völkern« abgesegnet wurde, entstammte ja der mittel- und westeuropäischen Idee von religiös wie ethnisch homogenen Staaten (als quasi idealer Staat), was zwangsläufig zu ethnischen Säuberungen führen muss (die Rede vom »Bevölkerungsaustausch« meint nichts anderes).
Was hier scheinbar seit jeher (bzw. seit dem Ende des Ersten Weltkriegs) schiefläuft, ist eine europäische (Außen-)Politik, die statt auf (Eigen-)Verantwortung (z. B. als »Bekenntnis zu den Fehlern der Europäischen Moderne«) auf moralisches Besserwissen gebürstet ist. Wenn dann noch 2016 während der EU-Aufnahme von Rumänien und Bulgarien der damalige französische Präsident Sarkozy davon spricht, »die Türkei gehöre nicht zu Europa«, dann entsteht (erneut) eine rechts-nationalistische Win-Win-Situation für beide Seiten. Die Erkenntnis, »dass man sich noch so sehr westlichen Vorgaben und Werten anpassen kann, aber doch nie zum exklusiven Club gehören wird« ist ja auch eine migrantische (etwa wenn davon gesprochen wird, dass ein deutscher/österreichischer Pass kein Garant für eine »Zugehörigkeit« darstellt). Erst dieses »Mitspielen verboten«, in dem Sinne, dass der (unter ungleichen Machtpositionen jedoch beidseitig propagierte) Neoliberalismus weder »wirtschaftliche Integration« noch »politische Annäherung« nach sich zieht, machte es, so Ther, möglich, die Idee einer Türkei als »Islamische Republik« wirkungsmächtig werden zu lassen.
Dieses Gefühl der Benachteiligung hat in den Beziehungen zu Russland noch einen weiteren (nicht zu unterschätzenden) Spin: Nicht nur weil es scheinbar an jeglichem Verständnis dafür fehlt, was es bedeutet, das Ende der UdSSR als Niederlage empfunden zu haben, sondern weil sich auch keine Gedanken darüber gemacht werden, wie die westlichen Liberalisierungs- und Privatisierungs-To-do-Listen und das daraufhin entstandene Oligarchentum unter post-sowjetischen Verhältnissen auch gelesen werden können – nämlich als (westliche) »Bevorzugung der Diebe«, in Form einer »Bestätigung der kommunistischen Propaganda über den Raubtierkapitalismus«.
Exemplarisch weist Ther hier auf Gorbatschows (kleines) »window of opportunity« hin, aus welchem vor allem deshalb nichts wurde, weil sich NATO und EU zu sehr als »Sieger des Kalten Kriegs empfanden«. Für Ther markiert die Abgrenzung von Putin und Erdogan daher gleichzeitig eine »politische Selbstvergewisserung« im Westen wie eine Steigerung des »aggressiven Nationalismus« in Russland und der Türkei nach innen und außen (Annexion der Krim, Einmarsch in Nordsyrien, Überfall auf Rojava), wobei Putin und Erdogan nicht zufälligerweise »Energieversorgung und Migrationsströme« (also genau jene Bereiche, wo die EU sich selber desavouiert) als Druckmittel einsetzen.
Was schief gehen kann …
Bei alldem stellt sich auch für Ther die Frage, wieso »in der Konkurrenz unter den Populisten der Antikapitalismus weniger zieht als der Rechtsnationalismus«. Eine mögliche Antwort findet er dabei beim (großteils) ausbleibenden Erfolg diverser »Occupy«-Bewegungen. Könnte dies vielleicht an der Unsichtbarkeit des Gegenübers (»Das Kapital bleibt anonym«) liegen?
Und ist diese Unsichtbarkeit nicht auch kennzeichnend für einen Staat, den sich jene ausdenken, die vom »Sparen im System« sprechen (etwa Sebastian Kurz)? Und lenkt diese sichtbare Abwesenheit des Staates nicht den Blick auf die sichtbare Anwesenheit des/der Anderen/Fremden (die offensichtlich etwas kriegen)? Nicht umsonst verweist Ther immer wieder auf die Selbststilisierung als von und vor der Geschichte Gekränkten und Gedemütigten (die US-amerikanischen Südstaaten, Polen, Ungarn, Türkei, Russland, Deutschland).
Es wird aber auch klar, was das Fehlen des Ostblocks bzw. der UdSSR in der Funktion einer »Systemkonkurrenz als Korrektiv« bedeutet. Eben nicht »das Ende der Geschichte«, sondern das Ende von Demokratie und (solidarischem) Wohlfahrtstaat. Ther geht zwar nicht so weit, zu sagen, dass es den »Goldenen Westen« ohne die UdSSR so nie gegeben hätte (was bis zu anti-rassistischen Gesetzgebungen der US-Regierung aus Angst vor »dem Kommunismus« zugeneigten afrikanischen Staaten reichte), aber es schwingt mit. Vor allem, weil dadurch (schmerzlich) klar wird, dass das, was »der Westen« zwischen den 1950ern und 1990ern dargestellt hat, nicht wirklich auf Freiwilligkeit gebaut war.
Thers Buch reiht sich damit in ähnliche, heuer erschienene Rückblicke unter dem Motto »Was ist damals schiefgelaufen« ein wie Frank Böschs »Zeitenwende 1979: Als die Welt von heute begann«, Michael Laczynskis »Das letzte Jahr der Zukunft: Wie 1999 die Welt veränderte« oder »Gegenrevolution. Der Kampf der Regierungen gegen die eigenen Bürger« von Bernard E. Harcourt und leistet dabei beim Entwirren ähnliche Grundlagenarbeit wie Berthold Seliger 2013 mit »Das Geschäft mit der Musik«.
Ther merkt aber auch an, dass seine Beispiele nur Teilausschnitte viel komplexerer Zusammenhänge sind (so wurde etwa das Thema »Klima« bewusst ausgespart). Vor allem zeigt aber sein Zugang, wie persönliche Beobachtungen als Ausgangspunkte/Quelle auf dem Weg zu faktenbasiertem Wissen (im Gegensatz zu »Meinungen«) fungieren können.