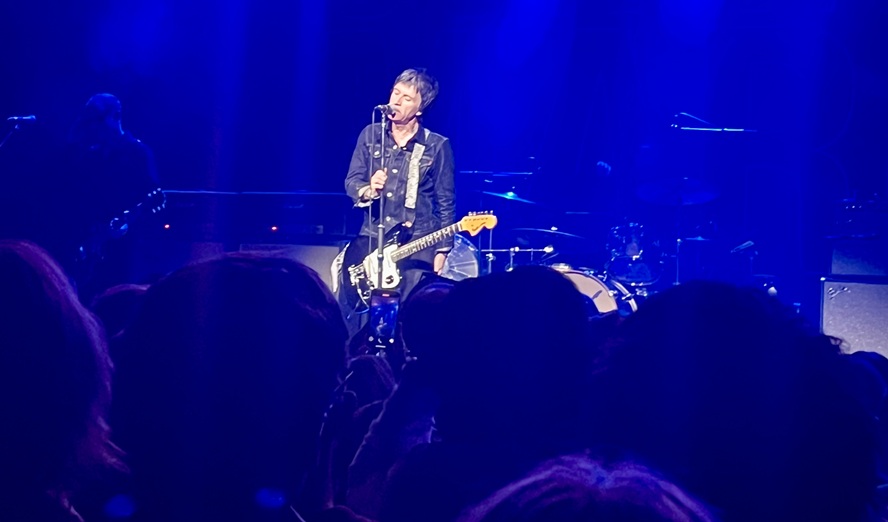skug: Was war der Anlass, die Thematik des Films »The Sound Of Music« wieder aufzugreifen?
Vitus Weh: Einerseits das Festival Summer of Sounds im Wiener Museumsquartier, andererseits das aktuelle Programmpapier der österreichischen Regierung. In diesem wird das sogenannte »Nation Branding Austria« für sehr wichtig erklärt. In der zugrundeliegenden Studie steht, dass man sich politisch als internationaler Brückenbauer positionieren und als kulturellen Leuchtturm »The Sound Of Music« neu verfilmen sollte. Da dachte ich mir, solch eine schöne Koinzidenz müsste man doch aufgreifen und in einem zentralen Kulturareal diesen politischen Auftrag als große Kooperationsaktion erfüllen. Als Spielort schlug ich den barocken Dachboden vor, der bietet fantastische Raumfluchten.
Wie wichtig ist Ihnen das Image des »Musiklandes« Österreich und der »Musikstadt« Wien, welche Bedeutung hat es für Ihr Schaffen?  Austrofred: Es ist in meinem Grundkonzept als Austrofred schon angelegt, dass ich Queen-Nummern und vor allem Queen-Gesten – eine größere, internationalere Geste als die von Freddy Mercury gibt’s ja fast nicht – mit österreichischen Gesten und Texten kreuze. Die Erzählhaltung eines Austropop-Songs ist klassischerweise die von einem Wirtshaustisch aus. Irgendjemand erzählt dir eine Geschichte von sich daheim: vom Großvater oder die »Gezeichnet-fürs-Leben«-Geschichte. Dieser Bruch zwischen großem Entertainment und der engen Grenze ist immer sehr wichtig für mich gewesen. »The Sound of Music« war für mich aber noch ein weißer Punkt auf der Landkarte, der noch nicht erkundet war. Die Trapp-Filme waren Lieblingsfilme meiner Mutter, die habe ich im Kopf gehabt, aber »The Sound of Music« habe ich mir erst jetzt ein paar Mal angesehen. Faszinierend finde ich die Figur des Kapitäns Trapp. Eine tolle Märchenfigur eigentlich, ein hochdekorierter Kapitän, in einem Land, in dem es – zu der Zeit, in der der Film spielt – gar kein Meer mehr gibt. Im Film ein nobler, smarter aber tougher Herr, visuell erinnert er mich mit seinen stahlblauen Augen leicht an H. C. Strache, leider Gottes. Wobei: Noch interessanter finde ich in der deutschen Verfilmung den Hans Holt. Der ist doch als Kriegsheld eigentlich nicht tragbar. So eine Sanftmut, die der Mensch verströmt. Und der soll im Alleingang im ersten Weltkrieg die italienische Küste mit seiner U-Boot Flotte vom Feind gereinigt haben? Das finde ich schon interessant, wie die wirkliche Geschichte sich den Mitteln, den Erfordernissen der Fiktion unterwirft. Aber schon die historische Geschichte der Trapps ist Märchen genug. Ich war baff, wie viel von den wahren Begebenheiten noch drinnen ist. Sicher: Es ist zeitlich und dramaturgisch einiges gestrafft und gerichtet worden. Trotzdem eine arge Geschichte.
Austrofred: Es ist in meinem Grundkonzept als Austrofred schon angelegt, dass ich Queen-Nummern und vor allem Queen-Gesten – eine größere, internationalere Geste als die von Freddy Mercury gibt’s ja fast nicht – mit österreichischen Gesten und Texten kreuze. Die Erzählhaltung eines Austropop-Songs ist klassischerweise die von einem Wirtshaustisch aus. Irgendjemand erzählt dir eine Geschichte von sich daheim: vom Großvater oder die »Gezeichnet-fürs-Leben«-Geschichte. Dieser Bruch zwischen großem Entertainment und der engen Grenze ist immer sehr wichtig für mich gewesen. »The Sound of Music« war für mich aber noch ein weißer Punkt auf der Landkarte, der noch nicht erkundet war. Die Trapp-Filme waren Lieblingsfilme meiner Mutter, die habe ich im Kopf gehabt, aber »The Sound of Music« habe ich mir erst jetzt ein paar Mal angesehen. Faszinierend finde ich die Figur des Kapitäns Trapp. Eine tolle Märchenfigur eigentlich, ein hochdekorierter Kapitän, in einem Land, in dem es – zu der Zeit, in der der Film spielt – gar kein Meer mehr gibt. Im Film ein nobler, smarter aber tougher Herr, visuell erinnert er mich mit seinen stahlblauen Augen leicht an H. C. Strache, leider Gottes. Wobei: Noch interessanter finde ich in der deutschen Verfilmung den Hans Holt. Der ist doch als Kriegsheld eigentlich nicht tragbar. So eine Sanftmut, die der Mensch verströmt. Und der soll im Alleingang im ersten Weltkrieg die italienische Küste mit seiner U-Boot Flotte vom Feind gereinigt haben? Das finde ich schon interessant, wie die wirkliche Geschichte sich den Mitteln, den Erfordernissen der Fiktion unterwirft. Aber schon die historische Geschichte der Trapps ist Märchen genug. Ich war baff, wie viel von den wahren Begebenheiten noch drinnen ist. Sicher: Es ist zeitlich und dramaturgisch einiges gestrafft und gerichtet worden. Trotzdem eine arge Geschichte.
Haben Sie sich davor auch schon mit Musicals beschäftigt, etwa um für die Rolle des Austrofred Anleihen zu nehmen?
Austrofred: Nicht wirklich. Ich bin ja mehr der Rock-Typ. Als eine Form von Entertainment, um des Entertainments willen, hat es mich aber schon immer interessiert. Egal was hinter der Bühne passiert, der »Smile stays on«. Dieses »The Show must go on«-Thema, natürlich auch bei Queen zu finden, fasziniert mich schon sehr. Mich hat es gewundert, dass ich mit »The Sound Of Music« bisher noch nichts gemacht habe. Wenn man sich zum Beispiel Falco ansieht, er hatte diesen großen Hit mit einer Mozart-Nummer. Und der nächste Hit-Versuch war dann »Sound of Musik«, die Lead-Single des Folgealbums. Der hat etwas Gleichstarkes gesucht, das man auch in Amerika kennt, aber das Konzept ist ihm damals leider nicht ganz aufgegangen.
Yosi Wanunu: Für mich ist das Musical eine zulässige künstlerische Ausdrucksweise. Ich habe viele Jahre in Amerika gelebt und anfangs hasste ich Musicals. Als ich dort Regie studierte, musste ich ein klassisches Musical konzipieren. Als ich zu recherchieren begann, fand ich diese Struktur und Form wirklich brauchbar. Und was ich von der Musical-Szene lernte, war, dass es dort schwule und schwarze Tänzer und Performer gab und diese dort Arbeit fanden. Nicht bezüglich der Themen, aber bezüglich der Leute, die im Musical-Bereich arbeiteten, war es einer der liberalsten und offensten Szenen in New York. Dort hat sich alles vermischt. Als ich dort lebte, starteten sie auch mit Musicals, die sich mit sozialen Themen wie Aids beschäftigten, wie zum Beispiel in »Rent« (Jonathan Larson, 1994). Ich realisierte, dass man Musicals auch intelligent einsetzen konnte, um wichtige Themen aufzugreifen. Und dieses spezifische Format »Musical« wurde nun einmal in Amerika erfunden und sie wissen wirklich, wie man es macht. Man muss das Potential erkennen. Es ist einfach nett, wenn Menschen unvermittelt während des Gehens, ohne unmittelbaren Anlass, zu singen beginnen.
Austrofred: Auch viele Elemente, die wir aus der Popmusik kennen, wie Verfremdungen und Spiegelungen, fand man bereits in Musicals oder auch in der Operette.[1]
Yosi Wanunu, Sie haben schon in Amerika gelebt. Was war Ihre Wahrnehmung bezüglich dieses Images von Wien als Musikstadt bzw. Österreich als Musikland?
Yosi Wanunu: »The Sound Of Music« ist sehr bekannt in Amerika. Vor ein paar Monaten haben sie die Idee, Live-Musicals fürs Fernsehen zu machen, wieder aufgegriffen. Das erste Musical, das sie dafür auswählten, war »The Sound Of Music« mit der Country-Sängerin Carrie Underwood. Das fand ich lustig – eine Country-Sängerin für die Figur der Maria von Trapp einzusetzen, das gibt dem Musical eine ganz eigenartige Note. Bezüglich des Filmes waren meine Erfahrungen in New York, dass die meisten für viele Jahre dabei nicht zwischen Österreich und Deutschland unterschieden und für sie war »The Sound Of Music« nicht ein Film über Österreich, es war ein Film über Deutschland und den 2. Weltkrieg. Das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Menschen hier den Film nicht kennen. Die Leute, die ich aus dem Musicalbereich in Amerika kennengelernt habe, kennen die Songs und verbinden sie mit verklärten, pastoralen Kindheitserinnerungen. Die schöne Landschaft, die gute alte Zeit. Österreich ist bloß eine Metapher dafür. Die Natur, das Wiesengrün ist ein Äquivalent für den Himmel, das Paradies. Und dann gibt es Probleme im Himmel, weil die Bösewichte kommen. Die historischen Begebenheiten, die als ursprüngliches Ausgangsmaterial für den Film dienten, kennen sehr wenige Menschen.
Wie sieht der aktuelle Stand des Nation Branding aus, beziehungsweise welches City Branding-Image hat Wien?
Vitus Weh: Jedes Nation Branding zielt auf ein langfristiges Image. Österreich positioniert sich z. B. seit dem 1. Weltkrieg durchgängig als traditionell: als die Alpenrepublik zum Skifahren, mit urigen Berghütten und klaren Seen, mit einem alten Kaiser und einer jungen Sissy, und in den Flugzeugen spielt man zur Erkennung Walzer. Nun, mit dem gewonnenen Eurovisionscontest, wird man wahrscheinlich die Musiktradition von Mozart bis Falco wieder stärker betonen. Die beiden sind international kompatible Währungen. Das gleiche gilt für den Downbeat von Kruder und Dorfmeister, oder die Melodie von »Stille Nacht, heilige Nacht«.
Das City Branding von Wien hingegen reagiert immer wieder auch auf Trends. Da wird man den Eurovisionscontest wahrscheinlich nutzen, um Wien noch stärker als Gay City zu positionieren. Die Gay-Community reist sehr gerne, sie ist ein extremer Wirtschaftsfaktor im Städtetourismus. Viele Städte schauen darauf, diese Gruppe zu gewinnen, und Wien hat für diese Ausrichtung mit dem Lifeball schon einen Anker.
Aber prinzipiell kann man sich für ein Branding auch neu erfinden: Für mich ist es zum Beispiel faszinierend, dass Aserbaidschan bei Atlético Madrid die Fußballleiberl branded mit: Aserbaidschan – Land of Fire. Das sollte sich Österreich als Vorbild nehmen und bei Real Madrid nachfragen, ob sie nicht draufschreiben wollen, Austria: Land der Bärte.
Austrofred: Da hätte ich noch eine bessere Idee. Man sollte die österreichischen Dressen grasgrün machen. Wenn am nächsten Tag dann die Leute auf YouTube gehen und sich über die Nationalmannschaft lustig machen wollen, dann sieht man sie nicht mehr. Man denkt sich, Schweinsteiger und Co. gewinnen 6:1 gegen den Rasen? Da bin ich aber neugierig, wer dann lacht.
Yosi Wanunu: Bayern München wäre auch gut für diese Leiberl-Kampagne. Sie haben ja diesen ultimativen Österreicher in ihrem Team.
Ab zirka 1860 wurde bewusst an dem Image Wiens als Musikstadt gearbeitet, es wurden Musikgebäude errichtet und Denkmäler für bedeutende Komponisten im öffentlichen Raum aufgestellt, auch um auf politische und wirtschaftliche Machtverluste in Europa zu reagieren. Wie sieht’s mit Wien zur Zeit aus?
Vitus Weh: Wien war vor fünfzehn Jahren beispielsweise die Hauptstadt der elektronischen Musik. Es gab von 1995-1999 das phonoTAKTIK-Festival, es gab eine lebendige Szene, die international reüssierte. Dann aber wurde verabsäumt, diesem Sound einen Ort zu geben, und heute ist er kaum mehr präsent. Es ist also wichtig, auch für flüchtige und imaginäre Dinge etwas Bleibendes wie einen Tempel zu schaffen. Gut zu sehen ist das bei der katholischen Kirche: da können die Leute noch lange austreten, aber der Stephansdom verbleibt in der Mitte der Stadt. Für die aktuelle Musikszene sind daher das alljährliche Popfest am Karlsplatz und das Donauinselfestival sehr wichtig.
Wie sieht die Situation, das Interesse, beim Theater aus? Spielt es eine Rolle beim Branding?
Yosi Wanunu: In Bezug auf das Branding war beim Theater folgendes interessant: Durch die deutsche Sprache gab es Limitierungen. Ich glaube auch, dass das österreichische Theater außerhalb von Wien nicht so bekannt ist. Die Musik ist da viel bekannter und ein viel wichtigerer Selling-Point. Man kann einen Ort auch nicht gänzlich neu erfinden, um ihn zu re-branden. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Theater ist brandingtechnisch also nicht zentral. Und diese Gerede bezüglich: Das Theater stirbt: Das Theater ist einfach das Wesen mit dem längsten Sterbeprozess.
Vitus Weh: Gleich danach kommt noch die Malerei … Aber nehmen wir wieder dieses Stück hier am Dachboden. Es werden nur dreißig Personen pro Vorstellung die Gelegenheit haben, ganz nahe an den Szenen und der Präsenz der PerformerInnen dran zu sein. Für mich ist Theater in dieser Form unglaublich stark, weil da einfach jemand ist, der etwas performt. Diese Nähe und Intimität in diesem Rahmen ist etwas ganz wichtiges.
Yosi Wanunu: Ein Dachboden ist ja oft ein Ort, wo du Sachen, die du nicht mehr brauchst, wegstellst. Für die Off-Szene war so ein Dachboden die klassische Musik, sie war nicht modern. Wir leben nun in einer Zeit, wo man all diese Truhen und Boxen am Dachboden wieder öffnen kann. »The Sound Of Music« ist auch so eine Material-Schachtel, die man nun wieder öffnen und damit spielen darf.
Es gab 2009 in Linz im Rahmen der Kulturhauptstadt Linz die Initiative Hörstadt Linz. Würde das auch für Wien funktionieren, eine Hörstadt Wien?
Vitus Weh: Die Linzer Hörstadt ist sehr subtil mit Situationen umgegangen. Ihr Initiator, Peter Androsch, ist wahnsinnig profund und engagiert und hat es in der Stadt verankern können. Sein Anliegen ist extrem wichtig und muss in die Architekturdebatte eindringen. Die akustische Vermüllung ist tatsächlich ein drängendes Problem! Aber für eine höhere Sensibilisierung sind weder Linz noch Wien geschaffen. Man könnte eher in den Bergen oder am Neusiedlersee eine besondere Hörerlebnis-Erfahrung, eine Hörsensibilisierung anstreben als in so einer pushigen Stadt wie Wien, wo ständig Leute rein und wieder rausströmen. Da geht es viel stärker um das Visuelle. Und für dieses Trubelige sind vor allem Höfe wichtig, wie zum Beispiel auch der Hof im Museumsquartier, wo sich Leute treffen können, wo man sich hinlegen kann und auch Leute beobachten kann. Das war ja anfangs gar nicht so geplant gewesen, bis man erkannte, dass die Höfe mit ihren Möbeln und Schanigärten die Haupt-Attraktoren dieses Areals sind.
Yosi Wanunu, arbeiten Sie gerne auf ungewöhnlichen bez. mit unterschiedlichen Aufführungsorten?
Yosi Wanunu: Am liebsten arbeite ich mit einer Art Black Box-Situation. Ich mag neutrale Umgebungen, aber von Zeit zu Zeit arbeite ich auch gerne mit unterschiedlichen Orten und Arrangements. Ich arbeite auch gerne mit der von Vitus erwähnten Intimität, aber nicht immer. Ich mag auch die Distanz eines sitzenden Publikums. Ich habe gemischte Gefühle in Bezug zu den Versuchen, jedes Format zu verändern, um sich dem Tempo unserer Zeit anzupassen. In diesem Projekt finde ich es auch spannend, mit deutschen, österreichischen und schweizer Musical-StudentInnen zu arbeiten. Ich habe das schon in New York gemacht, aber hier in Österreich ist es das erste Mal, dass ich mit Leuten mit musical-basiertem Performance-Training arbeite.
Wie würden Sie den Begriff einer Revue erklären?
Austrofred: Der Vorteil einer Revue ist, dass man keine Geschichte erzählen muss, sondern man arbeitet mit einzelnen Bildern. Das Publikum kann sich die Geschichte dann quasi selber zusammenbauen. Das hat außerdem diese Räumlichkeit, der Dachboden, nahegelegt. Auch das Arbeiten mit Szenen aus »The Sound Of Music«, mit österreichischen Klischees, hat eine Fraktalisierung von Ideen nahegelegt.
Yosi Wanunu: Revue wird zunehmend als modernes Format wiederentdeckt. Es gibt diese Reality-TV-Formate wie »Amercia’s Got Talent«, »Idol«, »Exfactor« und so weiter. Bei der Recherche stieß ich auf eine Familie mit zwölf Kindern, die eine Band geformt haben. In »America’s Got Talent« sangen sie einen Song aus »The Sound Of Music«.
Austrofred: Die Trapp-Familie war ja auch ein Revue-Akt, eine Freak-Show: eine Familie in Trachtenkleidung in New York. Sie haben ihre Trachtenkleidung an und sind nicht glücklich, bis sie einen Ort in Vermont finden, der so wie Österreich ist und wo sie dann ihre Trapp Family Lodge bauen. Sie haben sich aber insofern assimiliert, als sie sehr schnell das Business gecheckt haben, wie das so in Amerika läuft. Sie waren sozusagen stur im guten wie im unguten Sinne.
Haben Sie auch versucht, mit den Machern des ursprünglichen Musicals oder Films Kontakt aufzunehmen?
Vitus Weh: Wir wollten das eigenständig entwickeln und auch mit unserem Dilletantismus und Nicht-Wissen an diese Sache herangehen. Ich bin kein musical-erfahrener Mensch, wir alle kannten diesen Dachboden nicht, wir alle haben noch nie zuvor zusammengearbeitet. Wir haben mit so vielen Unwägbarkeiten und Partnern zu tun. Das ist vielleicht auch die Quintessenz einer Revue, dass sie einen Weg und eine Brücke zwischen unzusammenhängenden Dingen darstellt. Wir gehen hier ständig über Stege, die auch wie Brücken funktionieren. Das passt auch ganz gut.
Austrofred: Wir sind ja auch Künstler und keine Wissenschafter oder Politiker. Bei denen müssen die Zahlen stimmen. Wir hätten zum Beispiel auch das Recht, etwas zu diesem Thema zu machen, ohne uns überhaupt den Film vorher anzusehen.
Sozusagen einen unscharfen Blick darauf zu werfen?
Austrofred: Ja, weil der unscharfe Blick ja auch einer ist, den man mit sehr vielen Menschen teilt.
War dieses Aus-dem-Nichts-etwas-Machen, diese American Dream-Symbolik auch entscheidend für den Erfolg des Filmes in Amerika in den 1960er Jahren?
Yosi Wanunu: Ja und nein. Es repräsentierte auch diese Art von Familie, die zu dieser Zeit in Amerika nicht mehr existierte. Vergessen wir nicht, es war die Zeit, als das Fernsehen die Haushalte eroberte. Die Zeit, als das gemeinsame Familienleben auseinander zu brechen begann. Die Menschen hörten auf, gemeinsam ein Dinner einzunehmen und so weiter. Dann kam diese semi-österreichische Familie und alle Kinder können singen, jeder spielt ein Instrument und kann tanzen. Der Traum einer Familie, die sich gemeinsam einen ganzen Abend lang unterhält und erfreut. Eine Version von Österreichern, die alle an klassischen Instrumenten ausgebildet sind, in jedem Haus findet man ein Klavier. Es ist die amerikanische Idee von Europa vor dem 2. Weltkrieg. Und dieses Klischee lässt sich brandingtechnisch ja immer noch gut vermarkten.
Die Revue »The Making Of Österreich« ist also keine Persiflage auf »The Sound of Music«?
Austrofred:  Auf keinen Fall. Es ist eher eine Hommage. Es werden schon Kuriosa und Schräglagen in der Vorlage herausgearbeitet. Aber das ist etwas anderes als sich darüber lustig zu machen. Das würde so auch nicht funktionieren. Ich mache mich ja auch nicht über Freddie Mercury lustig. Die Art wie »The Sound Of Music« geschrieben und aufgebaut wurde hat eine hohe Qualität: die Musik, die Texte, die Dramaturgie, die Bildsprache im Film. Wir arbeiten ja vor allem mit dem Film als Vorlage. Die Landschaft von Salzburg ist ein ganz wichtiger Darsteller in diesem Film.
Auf keinen Fall. Es ist eher eine Hommage. Es werden schon Kuriosa und Schräglagen in der Vorlage herausgearbeitet. Aber das ist etwas anderes als sich darüber lustig zu machen. Das würde so auch nicht funktionieren. Ich mache mich ja auch nicht über Freddie Mercury lustig. Die Art wie »The Sound Of Music« geschrieben und aufgebaut wurde hat eine hohe Qualität: die Musik, die Texte, die Dramaturgie, die Bildsprache im Film. Wir arbeiten ja vor allem mit dem Film als Vorlage. Die Landschaft von Salzburg ist ein ganz wichtiger Darsteller in diesem Film.
Yosi Wanunu: Ich finde man würde es sich zu leicht machen, einfach eine Parodie zu entwickeln. Es würde in diesem Kontext auch nicht funktionieren, weil viele Leute die Referenzen nicht verstehen würden. Um die Witze verstehen zu können, müsste man das Original kennen. Für uns war es interessanter, in diese Thematik einzutauchen und die Reibungspunkte zu eruieren. Wir arbeiten mit einem historischen Dokument. Wie verfrachten wir die Inhalte in die Gegenwart? Schaffen wir es, die Leute mit einem »schmalzy« Song wie »Edelweiß« zu berühren – ein »very sophisticated 21st century«- Publikum, das auf der Suche nach Off-Kultur hier am Dachboden landet? Das ist ein bisschen so, wie wenn du allein daheim sitzt und dir ein Drama ansiehst und du dir erlaubst, gerührt zu sein und zu weinen, weil dich niemand beobachtet. Du würdest wahrscheinlich niemand davon später erzählen.
Vitus Weh: Es war am Anfang nicht ganz klar, ob sich unser Stück lustig machen sollte, alles ins Komische gezogen werden sollte. Aber je länger wir daran arbeiteten, umso stärker merkten wir, dass so ein Lied wie »Edelweiß« eine unfassbare Kraft hat, obwohl es praktisch ein erfundenes Volkslied ist. Darüber haben sich ja auch viele Volksliedforscher wie ich glaube immer wieder aufgeregt. Aber es ist einfach unglaublich gut gemacht und wenn man sich das geschichtlich einmal näher ansieht, so ist jedes Volkslied eigentlich ein Kunstlied. Auch »Stille Nacht« wurde einmal von einer Einzelperson komponiert. Alle Lieder haben einen Komponisten und die Vorstellung, dass ein Lied aus einer Volksseele heraus entsteht, das ist nun mal nicht so. Insofern hat ein Lied einfach eine Machart. Somit muss es auch ernst genommen werden und man dem nachgehen. Wenn man diese Lieder nicht ernst nimmt, auch in ihrer Süßlichkeit und Emotionalität, dann verfehlt man sie.
Was sind oder waren die größeren Herausforderungen bei der Arbeit an dieser Produktion?
Austrofred: Wir haben noch nie zuvor zusammengearbeitet. Auch die Musiker vom Kollegium Kalksburg sind ja mit dabei. Jeder hatte andere Ideen. Die dann zu kombinieren und herauszufinden, wo man in den eigenen Vorstellungen Streichungen vornehmen kann, war sicher eine Hauptaufgabe. Ich bin ja eher gewohnt, alleine zu arbeiten bzw. zu schreiben, zu improvisieren. Wie kann ich das einbauen, so dass es dem großen Ganzen zuträglich ist und das keine reine Austrofred-Show wird. Das, was ich als Austrofred bieten kann, die Dynamik und den Umgang mit österreichischen Dialekt-Wörtern, wie kann ich das gut einbringen.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, mit dem Kollegium Kalksburg zu arbeiten?
Vitus Weh: Zuerst habe ich Patrick Pulsinger angefragt und er hat dann wiederum das Kollegium Kalksburg vorgeschlagen, weil er sie als eine ideale Ergänzung gesehen hat. Sie haben, ähnlich wie der Austrofred, eine sehr starke Identität, die sie einbringen können: ihr Wien, den Grant, das Trinken.
Ist das für Sie nun ein Ausgangspunkt, um Themen wie diese, also die Adaption des Genres Musical, neu zu überdenken?
Vitus Weh: Ich habe die Hoffnung, dass man diesen Dachboden hier als eine Erweiterung der Spielmöglichkeiten im Museumsquartier und in der Stadt sieht.
Yosi Wanunu: Schwer zu sagen. Wir experimentieren hier und befinden uns gerade im Vorbereitungsprozess. Was das dann für Effekte und Weiterführungen erzeugt, lässt sich schwer vorhersehen. Ich will jetzt auch nicht jeden davon überzeugen, dass das Musical ein großartiges Format ist. Das ist auch wieder nicht meine Arbeit, dafür ist mein Leben zu kurz. Aber ich finde, es ist manchmal wirklich befreiend, einfach plötzlich und ohne Grund drauf los zu singen.
Vitus Weh: Auch dieses Springen zwischen dem ganz normalen Sprechen und dem Singen ist spannend. Das finde ich alleine schon großartig.
Austrofred: Was ich auch vermisse, sind diese zehnminütigen Tanz- und Traumsequenzen, wie man sie in Filmen ab den 1920ern findet, auch in Fred Astaire-Filmen usw. Das würde sich heute wohl niemand mehr ansehen, dabei wurde der Raum quasi richtig modern aufgemacht.
Vitus Weh: Oder Jacques Demy! Wo sie tanzen und singen, diese Filme sind mittlerweile wieder richtig zeitgenössisch.
Austrofred: Dagegen finde ich es wahnsinnig banal, wie realitätssüchtig heutige Filme oft sind. Sogar die Fähigkeiten von Action-Helden müssen wissenschaftlich begründet sein. Der Batman muss sich so abseilen, wie das auch technisch möglich sein könnte. Dabei ist doch viel besser, wenn er Sachen macht, die kein Mensch sonst kann. Sonst bräuchte man ja auch keinen Fledermausmenschen zum Verbrechenbekämpfen, sondern es täte ein einfacher »Tatort«-Kommissar. Aber die »Tatort«-Kommissare wiederum müssen sich in erster Linie um ihr Privatleben kümmern, damit sie real sind. Das ist ja fast ein Teufelskreis.
[1] Apropos war die Operette im skug schon öfters Thema. Erhellendes dazu hat besonders Didi Neidhart geliefert, vgl. skug #66 (2006), skug #67 (2006), skug #68 (2006), skug #70 (2007) und in skug #76 ging es um die »schwule Operette«.
The Making of Österreich. Eine Revue durch den barocken MQ Dachboden
Datum: Do 18. bis So 21.09., Do bis Sa 18h, 19h, 20h, 21h & So 10h, 11h, 12h
Ort: MQ Dachboden
Eintrittskarten: erhältlich im DSCHUNGEL WIEN
tickets(at)dschungelwien.at
01/522 07 20-20
Vorverkauf: €12,- / ermäßigt: €10,-
Abendkasse: €15,- / ermäßigt: €12,-