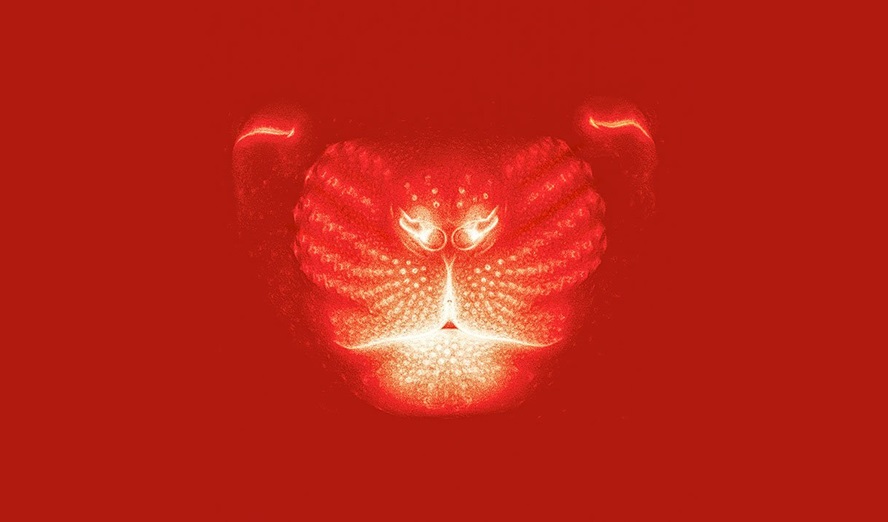Warum sich überhaupt mit diesem schmierigen Quatsch beschäftigen? Ist nicht jeder/m klar, dass die Oscarverleihung ein völlig überpromoteter Unsinn ist, bei dem der Öffentlichkeit eingeredet werden soll, es würden gesellschaftliche Themen verhandelt, dabei geht es letztlich nur um den Verkauf? Der seit Langem ehrlichste Satz auf dem Red Carpet kam letztes Jahr vom Rapper/Schauspieler Keith Stanfield, der, gefragt nach den Siegeschancen von »Get Out«, wenig enthusiasmiert mit den Schultern zuckte und meinte »I’m here to promote my brand«. Die Stars werden genötigt, zum Grinsen zu erscheinen, und kassieren dafür enorme Summen, erhalten Einladungen zum Essen und bekommen für ihre Mühen von den Sponsoren ein Geschenkpaket überreicht, dessen Wert im fünfstelligen Bereich liegt. Jeder Kontakt mit Stars, die selbst Marken sind, ist eben für andere Marken Gold wert. Im Geschenksackerl befand sich dieses Jahr übrigens ein Klopümperl in Form eines grinsenden Scheißhaufens, das im Dunkeln leuchtet. Das Leben liefert die besten Metaphern. Zu hoffen, solcher Aberwitz würde sich selbst entlarven, hieße allerdings, die Filmkritik bei den Hollywoodprodukten ganz der werbehörigen Anpreisungsmaschinerie zu übergeben. Außerdem werden ja tatsächlich gesellschaftspolitisch wichtige Themen verhandelt, nur eben im Zerrspiegel.
Es war zu weiß
Nachdem die Diversitätsbemühungen ganz groß angepriesen wurden, gab es nun im Jahr 2019 mit viel allseitigem Lob zahlreiche afro-amerikanische Gewinner*innen, die in mehreren technischen Kategorien sogar erstmals gewinnen konnten, und zum ersten Mal gewann auch ein arabischstämmiger Schauspieler (Rami Malek) den besten Darsteller-Award für seinen Freddy im Queen-Biopic. (Weitere Kommentare zu diesem Film nur unter Folter.) Also alles wunderbar, oder? Den beteiligten Künstler*innen ist dies fraglos zu gönnen und sie können nun jene Jobs machen, die bislang Weißen vorbehalten waren. Das ist natürlich eine gute Entwicklung. Die Politik allerdings, die in den prämierten Werken ausgestellt wird, ist eher gruselig und riecht nach dem Morast unbeendeter Kolonialisierung.

Den »Besten Film« errang der Crowd-Pleaser »Green Book«, der die Geschichte des weißen Chauffeurs Tony Lip, dargestellt von Viggo Mortensen, und seinem Auftraggeber, dem großartigen, farbigen Jazzpianisten Don Shirley, dargestellt von Mahershala Ali, erzählt. Die beiden machen eine Tour durch die amerikanischen Südstaaten, bei der der grobschlächtige Gorilla Lip den feinsinnigen Künstler Shirley mit Körperkraft und Ganovenschläue durchboxt und am Ende haben beide was gelernt. Die Familie und die Nachlassverwalter*innen von Don Shirley haben sich dann allerdings erlaubt, anzumerken, dass das alles so nie passiert ist und die beiden, anders als im Film dargestellt, nie Freunde geworden sind. Aber wen interessieren solche Details, wenn man dem weißen Publikum die Möglichkeit geben kann, sich einmal so richtig schön gut zu fühlen, weil man ja oberfleißig Vorurteile abgelegt hat?
The world according to the mob
Was der Film »Green Book« vielmehr belegt, ist die Obsession Hollywoods, amerikanische Geschichte durch den Filter der italienischen Mafia darzustellen. Den original Tony Lip kennt ein größeres Publikum bereits aus den »Sopranos«, wo er jenen Mafiosi spielte, der er selbst im Leben nur zur Hälfte gewesen ist. Der New Yorker Mob bildet seit vielen Jahren ein Story-Kartell, das ihm ermöglichte, in Werken wie eben »The Sopranos«, »Goodfellas« oder »The Godfather« ihre G’schichterln auszuwalzen. Die Filmindustrie, selbst mafiös strukturiert, macht immer wieder gerne mit, liefert die ewig gleichen Klischees von Familienzusammenhalt, Treue und Verrat und übersieht dabei geflissentlich, dass sie aus dem mörderischen Systemversagen eine putzige Fabel macht.
Tatsächlich ist die geltende Wirtschaftsordnung gut durch den Mafiabetrieb zu fassen, schließlich ähneln sich die Methoden frappant. Nur ist die ewige Täter*innenperspektive irgendwann zu einem Instrument der Repression geworden. Wie oft sollen wir noch mit den Erpresser*innen, Mörder*innen und Betrüger*innen mitfiebern? Immer werden wir eingeladen, Verständnis zu haben, dass wenn der Familienbetrieb laufen soll, auch einmal »Späne« fallen müssen. Zwar werden Gewalt und Unterdrückung als falsch dargestellt und zuweilen auch als abscheulich, sie werden aber zugleich durch die Filmhandlung als notwendig charakterisiert. Dadurch entsteht eine ähnlich widersprüchliche Wirkung wie beim Anti-Kriegsfilm, der durch die Hintertür die Notwendigkeit des Krieges propagiert. Die Mafia hilft somit tatkräftig mit, eine Versöhnung mit den herrschenden Verhältnissen zu inszenieren, an der sie zufällig auch noch kräftig mitverdient. Gut gemacht!
Der Autor von »Green Book«, Nick Vallelonga, ist der Sohn von Tony Lip und im Geschichtenkartell der New Yorker Mafia aufgewachsen. Geschickt erschnüffelte er Hollywoods Gier nach Emanzipationsgeschichten für Farbige und lieferte diese bereitwillig. (Die Frauen- und Homosexuellen-Emanzipation gab es noch obendrauf, alles in sauberem Scherenschnitt.) Vallelonga erzählte somit die Geschichte seines Vaters und dessen farbigen Bosses so, wie er und seine weißen Auftraggeber*innen sie gerne gehabt hätten – und nicht, wie die Schwarzen sie erlebt haben. Das kuriose und höchst unbefriedigende, aber mit Oscar gewürdigte Ergebnis ist somit wieder einmal, dass die Geschichte der Diskriminierung der Farbigen (und deren Überwindung) von Weißen erzählt wird. Diesem Makel wollte sich der neunmalschlaue Walt-Disney/Marvel-Konzern nicht aussetzen und »wagte« die erste Blockbuster-Produktion in weitgehend farbigen Händen. Heraus kam »Black Panther«, der, wiewohl als Oscarfavorit gehandelt, sich mit drei »Nebenoscars« (Kostüme, Bühne und Originalscore) zufriedengeben musste und die Vermutung erneut bestätigt, dass eben Fantasy-Storys für die Juror*innen nicht als Kunstfilme durchgehen. Die emanzipatorische Ermächtigung, die diese riesige Filmproduktion darstellen mag, ist für die Beteiligten ja gut und schön, der Film hat nur einen bedeutenden Makel: er ist komplette Kacke.
Schwarzer Panther, graue Katze
Was den Film »Black Panther« ungenießbar macht, ist zunächst einmal dieses kaum erträgliche, lobende Bild der Aristokratie. In der Fantasy-Fabel wird eine hochtechnisierte Untergrundkultur in Afrika dargestellt, die ihren Tribalismus und ihre Führerverehrung trotz sonstigem avanciertem Wesen nie hat ablegen können. Der Film behandelt somit das Drama einer Königsfamilie. Stellen wir uns dies einmal kurz in einer historisch fundierten Version vor: Otto von Habsburg ist gestorben, nach seinem Tod hat er sich in einen Delphin verwandelt (im Film sind es natürlich Panther, aber, you know, Austrian aristocracy is more like dolphins) und erscheint seinem Sohn im Schlaf. Im Hintergrund wackeln die anderen Kaiser*innen mit ihren Köpfen und klatschen mit den Flossen, Maria Theresia, die Ferdinands und der Franzl mit seiner Sissi, und in den Fischgesichtern zeigt sich die mörderische Verblödung, die jahrhundertelang in Mitteleuropa Menschen geschunden und bevormundet hat. Plötzlich verwandelt sich Delphin Otto in Menschengestalt und gibt seinem Sohn ein paar schwülstig-abgehobene Tipps, wie man ein guter Kaiser ist. Wer an dieser Stelle den Finger noch nicht tief im Hals hat, verfügt über keinerlei historisches Wissen. Die ganze Chose könnte auch mit den Windsors durchgespielt werden. Queen Elizabeth und Prinz Charles vielleicht als Corgis? An diesen Beispielen dürfte deutlich werden, Aristokratie ist immer Mist und es ist gut, dass sie überwunden wurde. Dies hat auch Gültigkeit eingedenk einer besonderen historischen Lage, die darin besteht, dass die afrikanische Kultur ihrer Traditionen von imperialistischen Ausbeutern beraubt wurde und sich später (wie beispielsweise bei Sun Ra) die Wiedererweckung dieser aristokratischen Strukturen ersehnte. Dies geschah aber innerhalb künstlerisch utopischer Konzeptionen, an denen dieser Science-Fiction-Film komplett scheitert und stattdessen nur in unreflektierter Weise autoritäre Hierarchien anbietet.
Aber mit dem aristokratischen Heiapopeia fängt die ungeschickte Malaise erst an. Richtig schlimm wird das Ganze durch das Bild Afrikas. Der Film kreist dramaturgisch um verschiedene Königsduelle, bei denen Herrscher und Herausforderer einander mit Speeren bekämpfen. Dabei wird ein Bild des tribalistischen Afrikas gezeichnet, bei dem sich die einzelnen, fantasievoll gekleideten und dadurch leicht zu unterscheidenden Stämme aufreihen, rhythmisch mit den Füßen stampfen und »Huga-Huga« rufen. Im Film erscheint afrikanische Kultur etwa so, wie sie sich Opa Wackelzahn vorstellt. Die schlimme Deko, die dauernd befürchten lässt, irgendwo tauche gleich einer dieser selbstgeschnitzten CD-Ständer auf, tut das ihre. (Nicht vergessen: Für die Ethno-Deko gab es den Kostüm- und Szenebild-Oscar.)
Je mehr man der Story folgt, desto schlimmer wird es. Die Angebetete des jungen, guten Königs sorgt sich um die armen Schweine, die nicht teilhaben dürfen an der enormen Macht des geheimen afrikanischen Königreiches, das diesem durch das Auffinden einer blau-schimmernden Supersubstanz verliehen wurde. Die Gute will den Menschen da draußen helfen und arbeitet deswegen in einer Art Friedenschor, das ausströmt und im Geheimen hilft, wo es helfen kann. Der König gerät nun in den moralischen Konflikt, ob er das Geheimnis der Superkräfte – so wie es sein Vater tat – vor der Welt geheim hält, um das eigene Volk zu schützen, oder ob er die Tarnung des angeblichen »Drittweltlandes« aufgibt, um allen Menschen zu helfen. Weitere Erwägungen kann er sich dann allerdings sparen, weil die Bösewichte das Land entdecken und es angreifen. Die übliche Action-Dramaturgie mit lustigen Achterbahnfahrten darf beginnen.
Das wahre Afrika liegt unter der Erde
Der Blockbuster-Stuss »Black Panther« wiederholt das ästhetisch-moralische Elend, das bereits umfassend von farbigen und afrikanisch-stämmigen Intellektuellen diagnostiziert worden ist. Es ist das Gewicht der weißen Blicke, wie es Frantz Fanon ausdrückt, das jede schwarze Authentizität erstickt, weil die afrikanische Kultur nie in ihrer Selbstverständlichkeit von den imperialistischen europäischen Beobachter*innen wahrgenommen werden kann. Auch nicht von den wohlmeinenden. Die wahre afrikanische Identität bleibt verborgen hinter jener afrikanischen Identität, die Europäer von Afrika erwarten. Um Akzeptanz zu finden muss diese zunächst auch von den Afrikaner*innen bedient werden. Keine Frage, den Macher*innen des Filmes ist dies vollauf bewusst, deswegen haben sie ja auch die fantastische Konzeption gewählt, die suggeriert, das wahre Afrika läge unter der Erde verborgen und verheimliche seine Stärke. Nur schießen sie damit ein Eigentor, indem sie in eine Konstellation geraten, die von Friedrich Nietzsche als »Sklaventraum« verspottet wurde.

Das besiegte Volk Israel imaginiert sich dabei in seiner faktischen Unterwerfung den weltlichen Herrschern als überweltlich überlegen. Das Problem, das Nietzsche hier diagnostizierte, liegt darin, dass die Herrschenden mit dieser Art »Sklavenmoral« sehr zufrieden sind und sie sogar fördern. Die Unterdrückten beruhigen sich selbst und warten seelenruhig auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Perfekt. Dass nun der Film diese unendliche Vertröstung darstellt, mittels der Anlehnung an die Black-Panther-Bewegung (Filmtitel!), die genau diesen Sachverhalt in den 1960er-Jahren analysierte und sich programmatisch zu echter Militanz entschloss, ist dann kaum mehr aushaltbar. So viel hinterhältige Mache ist selten. Weiße und schwarze Zuseher*innen werden übrigens gemeinsam hinters Licht geführt nach dem Motto: Glotzt ihr Kinderlein ruhig auf die bunten Bilder, die Erwachsenen machen im Hintergrund die wahre Weltgeschichte.
Doppeltes Bewusstsein
Die miese Heimtücke des Filmes soll noch kurz »tiefenpsychologisch« analysiert werden. Das von dem Soziologen W. E. B. Du Bois analysierte »doppelte Bewusstsein« verlegt nämlich den Konflikt zwischen den Erwartungen der dominierenden Kultur und dem So-Sein der dominierten Kultur in das Innere der dominierten Individuen. Sie müssen immer abwägen zwischen ihrer Authentizität und dem Bedienen der Erwartungen anderer. Wer sein Leben im Brennglas der Erforschungen, Erwartungen und auch Begierden (»black magic woman«) anderer lebt, wird irgendwann die Rolle spielen, die er oder sie anscheinend spielen soll. Damit gerät das Individuum aber in Widerspruch zu sich selbst, weil es es plötzlich zwei Mal gibt, als das Bild, das die dominierende Kultur von ihm verlangt und als das, was es eigentlich fühlt. Keine Frage, dies geht allen Menschen so, aber das macht die Situation für dominierte Minderheiten nicht besser, weil bei ihnen dieser Effekt des doppelten Bewusstseins ungleich stärker ist und sie kaum auf die Solidarität der »Weißen« hoffen dürfen, die ihre vergleichsweise geringen Diskriminierungserfahrungen traditionell anders deuten.
Weiße haben meist das Gefühl, ihre Familie hätte sie psychisch erledigt (was meistens auch stimmt), Schwarze hingegen spüren, es ist die ganze Gesellschaft, die in ihrem Bewusstsein herumgefummelt hat, weshalb man das Gefühl nicht los wird, »they fucked up my mind«. Ein doppeltes Bewusstsein kann nicht versöhnt werden. Genau dies versucht aber der Film »Black Panther«, indem er die Ausweglosigkeit der Verdopplung fantastisch überhöht. Was für eine Gemeinheit! Message: Eigentlich sind wir Schwarzen die Super-Duper-Helden, die im Keller diese blau-fluoreszierende Brühe haben, und damit könnten wir im Fingerstreich die (aristokratische?) Weltherrschaft erlangen, aber wir machen das halt nicht, weil … es einfach nur ein abgefucktes Hirngespinst ist! Das ist schon sehr deprimierend. Die Superheldenersatzreligion hat wieder zugeschlagen. Und sie tut dies in der übelsten Form, denn schließlich geht es in dem Film »Black Panther« letztlich nur um das faschistoide Thema des Erringens von Macht. Auf Ornette Coleman hat niemand gehört. Der betonte stets, wie sehr es ihn fuchse, wenn ihm Weiße vorwürfen, es ginge den Schwarzen doch nur darum, auch an die Macht zu kommen. Nein, meinte er, wir wollen eine bessere Welt.

Am Ende des Films, während bereits die Credits laufen, ist es dann soweit. Nach dem schönen, nur leider komplett falschen Motto: »Nicht der Kapitalismus (und sein Streben nach Monopolrendite) ist schlecht, sondern nur das, was die bösen Menschen aus ihm machen«, kommt endlich einer, der gut ist – der König Schwarzer Panther eben – hält eine Rede vor den Vereinten Nationen und verteilt brav die Ressourcen des blauen Supersaftes unter alle Menschen, die dann happily-ever-after leben dürfen. Eine letzte Frage: Dürfen wir jetzt von dem Ast steigen, von dem die Macher*innen des Films glauben, wir säßen drauf? »Black Panther« erweist sich, wie im Jahr zuvor der Fantasy-Schmuh »The Shape of Water«, als ein schwaches Machwerk und gewinnt damit den diesjährigen Oscar in der von skug gestifteten Kategorie »Schwachwerk«.