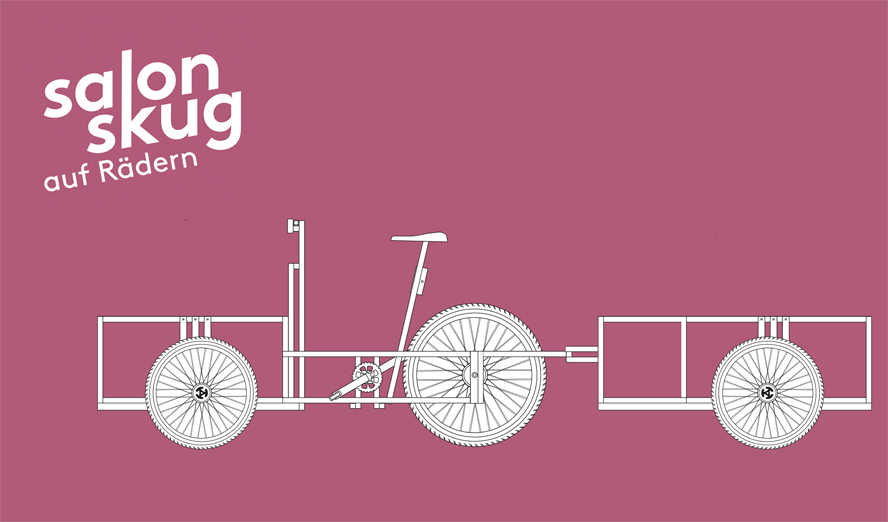Es ist einer dieser Begriffe, die schnell bei der Hand sind, wenn es darum geht, urbane Prozesse zu erklären. Er ist aufgeladen mit allerhand ungebührlicher Bedeutung und sorgt aus dem Stegreif für fixe Empörung, denn offenbar weiß jeder ganz genau, worum es dabei geht. Es gab sogar Zeiten, da musste man in Berlin regelrecht aufpassen, dass man nicht verhaftet wurde, wenn man dieses Wort im Munde führte, so wie es dem Soziologen Andrej Holm vor ein paar Jahren passierte. Derlei Dinge sind glücklicherweise vorbei, und doch ist der Begriff der Gentrifizierung alles andere als entschärft. Das stadtsoziologische Konzept, das Ruth Glass in den 1960er Jahren als Aufwertungsprozess eines Wohngebiets in physischer (Bausubstanz) wie in sozialer Hinsicht (Bewohnerschaft) mit Gentrifizierung beschrieb, floriert heute als Negativslogan mehr denn je. Vom linken Ufer aus wird der Prozess allzu oft und leider auch allzu pauschal als hehre Auseinandersetzung um Wohnraum und Stadtgebiete zwischen gesellschaftlichem Oben und Unten erklärt, welche Oben gewinnt und Unten schließlich ins Elend reißt. Vom rechten Ufer aus dagegen wird Gentrifizierung gern etwas genugtuerisch als ökonomisch unausweichlicher Umstand ausgegeben, der in ganz marktnatürlicher Wesensart zwischen Nachfrage und Angebot den Preis und damit auch die potenziellen Käuferschichten von Wohnraum reguliert: eine ganz einfache Sache der Investition also, ?Modernisierung? oder ?Stadtteilveredelung? wären die dazu passenden Euphemismen.
Empfindliche Grundstimmung
Doch beide Perspektiven greifen zu kurz und lassen die Ambivalenz vermissen, denn nimmt man die Zeit als Komponente hinzu, wird schnell klar, dass der Prozess verschiedene Phasen kennt und nicht nur von Außen, sondern auch von Innen heraus vorangetrieben wird: anfangs sind es nur angeranzte Altbauten in Innenstadtnähe, die mit hohem Leerstand und niedrigen Mieten Studenten, Künstler und andere Freigeister anlocken. Risikobereite, eher ungebundene Menschen also, die allenfalls den Bildungsgrad im Gesamt erhöhen, doch wegen des Leerstands niemanden verdrängen. Nach diesen Pionieren kommen die ersten Gentrifier, schon etwas älteres, eher status- und leistungsorientiertes Volk mit Tendenz zu Familie, Beständigkeit und Eigentumswohnung. Investoren und Stadtpolitiker werden ebenfalls aufmerksam, Sanierungen folgen, Mieten ziehen allmählich an. In der heißen Phase schließlich entstehen Treffpunkte wie Boutiquen, Kneipen und Clubs, welche wiederum Medienaufmerksamkeit erregen und dem ganzen Gebiet ein angesagtes Image angedeihen lassen. Dies wiederum lockt wohlhabende Personengruppen mit Kapital aus In- und Ausland an, die für die ersten richtigen Verdrängungseffekte sorgen und Geld in die städtischen Kassen spülen. Und so weiter und so fort… Zwischenzeitlich sind unsere Freigeister vom Anfang etwa zehn Jahre älter und viele davon spießiger geworden und gentrifizieren ihrerseits ordentlich mit. In Berlin findet man übrigens passend für jede Phase einen eigenen Stadtteil und dementsprechend empfindlich ist die Grundstimmung bezüglich dieses Themas.
„Stadtentwicklungspläne á la ?Mediaspree?, derentwegen in absehbarer Zeit mindestens zwei Clubs (das Yaam und die Maria am Ostbahnhof) weichen müssen, tragen natürlich nicht gerade zur Deeskalation bei und ließen manchen Beobachter schon vom allmählichen ?Clubsterben? in Berlin phantasieren. Derlei Formulierungen sind natürlich tendenziös, zeigen aber auch deutlich die Angst vor einer Verdrängung der Clubkultur in Berlin. Die Nachricht von der angeblichen Schließung des Icon durch die öffentliche Hand schlug dementsprechend tief in jene Kerbe, wuchs doch das im Keller einer ehemaligen Brauerei gelegene Icon im Laufe seines vierzehnjährigen Bestehens zu einer der tragenden Säulen für den Berliner Dubstep und Drum’n’Bass heran. In direkter Nachbarschaft wuchs ebenfalls etwas heran, ein eleganter Neubau mit schicken Eigentumswohnungen ließ die bösesten Vorahnungen bestätigen: es sollte Ärger geben. Zwar sind die Räume des Icon Schall isoliert, so dass selbst bei den heftigsten Feiern kein Pieps nach Außen dringt, einer der neuen Nachbarn fühlte sich aber von den lauten Gesprächen vor dem Club gestört. Nach einer Beschwerde überschlugen sich die Ereignisse, es gab ganz plötzlich planungsrechtliche Unklarheiten, was den zuständigen Sachbearbeiter dazu bewog, vollkommen übereilt und mit sofortiger Wirkung die Konzession zu entziehen. Durch Zugeständnisse der Icon-Betreiber wurde die Genehmigung für den Club immerhin bis Ende des Jahres verlängert, doch professionelle öffentliche Handhabe einer solchen Angelegenheit sieht sicher anders aus. Wie wir alle wissen, konnte dank bürgerlichem Engagements die Sache letztlich zu einem glücklichen Ende finden und das Icon erfreut sich nach wie vor bester Verfassung, doch falls es wirklich hätte schließen müssen, wär’s das endgültig mit den Clubs in Prenzlauer Berg gewesen: die Kollegen der Clubs Magnet, Knaack und Duncker mussten schon aus ähnlichen Gründen ihre Sachen packen, so dass die Ausgehkultur in Prenzlauer Berg auf Kurz oder Lang von der eigenen sozialräumlichen Segregation aufgegessen worden wäre. Trotzdem hat der Fall Icon mit Gentrifizierung erstmal wenig zu tun, allenfalls mit einer rein behördlich verbockten Lightvariante davon, die auf Voreiligkeit und seltsamen Planungsgewohnheiten beruht. Ein Schlag ins Gesicht auch für diejenigen, welche die Schuld gleich durch den allseits verhassten Overtake der Schwaben im Prenzlauer Berg zu ergründen suchten und dies auch breitmundig zum Besten gaben. Ein Vollhirni, wer seinen latenten Rassismus für Identifikation stiftend hält und seine Ressentiments gegenüber Zugezogenen für hinterfragt. Das ganze junge Berlin ist verliebt in seine selbsternannte Schokoladenseite des Vielfalt-Szene-Toleranz-Gewurschtels, aber nach den Konflikten um das Icon muss man sich einmal mehr am Kopf kratzen, und sich wundern, wie viel wirklich dahinter steckt.
Verblichener Charme
Gleiches gilt für’s Tacheles in Berlin-Mitte, das mit dem Icon nichts gemeinsam hat außer einen ähnlichen Zeitpunkt seiner Schließungsmeldungen aus dem Sommer 2010. Es ist nach wie vor bedroht von Investoren und soll, nachdem der symbolisch gemeinte Mietvertrag im Jahre 2008 ausgelaufen ist, zwangsgeräumt werden. Zugegeben, ich bin kein Freund des Tacheles‘, das ganze Prinzip ?Tacheles? kommt inmitten des Profits vom touristischen Schwemmholz aus der Oranienburger und Friedrichstraße längst nicht mehr rüber als kritische Distinktion vom Mitte-Schick sondern mehr wie ein abgestandener Zirkus voller bequem gewordener Gesellschaftsaussteiger. Vom einstigen rauen Charme der kritischen Subkultur und alternativer Selbstverwirklichungsromantik ist nichts zu spüren, allenfalls ein ständig über die Jahre warmgehaltener Sellout davon gepaart mit dem schimmligen Mief der Gemäuer. Kaum ein Berliner verirrt sich dorthin, was soll er auch dort; die beiden ?Clubs? im Tacheles sind gefüllt mit Touristen, die mit ?echt Berliner? Beats zu überteuerten Preisen bespaßt werden, als ob es fadenscheiniger nicht ginge. Mag ja sein, dass dort auch Künstler wohnen und arbeiten, aber als Beobachter man kommt einfach nicht umhin, das Ganze aufgesetzt zu finden, gerade weil sich doch der allgemein bekannte Leerstand in fast der ganzen Stadt für günstige Ateliers nutzen ließe. Stattdessen präsentiert man sich im Tacheles als alternativ-kritisches Filetstück der kreativen Mitte Berlins und lässt sich als letzte Bastion gegenüber dem Ausverkauf der Berliner Kultur beschmunzeln. Und merkt selbst nicht, dass man, nachdem sich die wirklich wichtigen Gefechte in andere Stadtteile verlagert haben, zwischen Brandenburger Tor und Checkpoint Charlie schon längst auf dem touristischen Grabbeltisch gelandet ist.