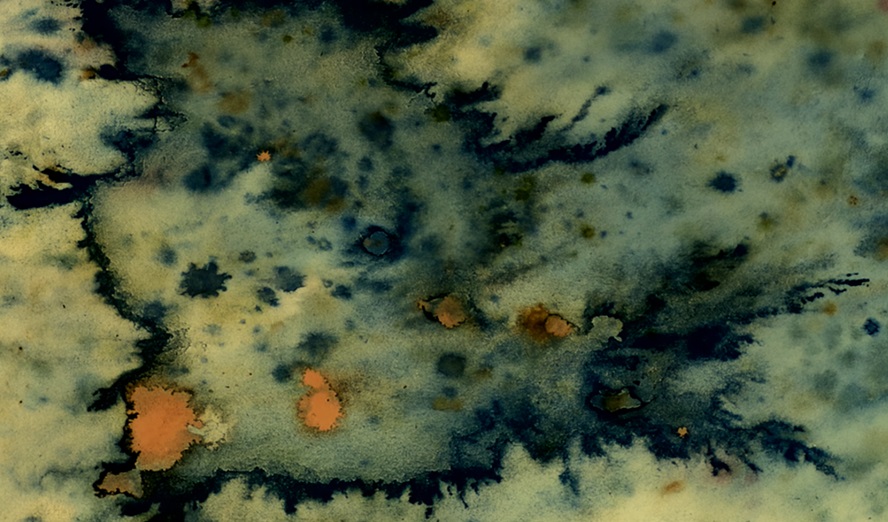Dieser Tage am Wiener Hauptbahnhof, auf dem ukrainische Geflüchtete direkt aus dem Krieg eintreffen und auf ihren internationalen Anschlusszug warten: »Machst du Musik?«, frage ich versuchsweise eine in einem Stuhl vor dem Caritas-Buffet hängende junge Frau mit rosa Haaren und vielen Ohrringen. Ein schiefes Lächeln. »Ich bin Sängerin …« »Punk?« Ein Grinsen breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Augen auf Halbmast, zwei große Becher Kaffee neben sich, die sie hinunterstürzt. »Die Hauptsache ist, dass ich meine drei kleinen Jungs nicht verliere«, sagt die übermüdete Frau und streicht einem von ihnen über den Kopf. Der Älteste der Brüderchen trägt einen braven Ausdruck wie eingraviert im Gesicht. Er versucht vor allem den Jüngsten in dessen Tatendrang einzubremsen.
Aller Voraussicht nach wird am 14. Mai 2022 die ukrainische Band Kalush Orchestra beim Eurovision Song Contest in Turin auftreten. Ihr Song »Stefania« ist eine Mischung aus HipHop und traditioneller Musik. Kann schon sein, dass angesichts der Weltenlage dieser Song über eine Mutter, für die ihr Junge immer ein Kind bleibt, siegen wird. Für eine TV-Show in Israel trat das Kalush Orchestra nun vor ukrainischen Flüchtlingen auf. »Viele Ukrainer vermissen gerade ihre Mutter«, sagte der Sänger im Fernsehen, und »wo immer ich bin, ich werde meine Heimat nicht vergessen.« Am Wiener Hauptbahnhof ist die Bedeutung von Müttern für die geflüchteten ukrainischen Kids nicht zu übersehen. Die 12-jährige Lisa ist mit einer Betreuerin unterwegs, die sie zur Oma in die Slowakei bringt. Das Mädchen will nichts essen und redet kein Wort. Blass schaut sie aus. Nur einen schrecklichen rosa Drink von Starbucks mit viel Schlagobers möchte sie haben. Mit Strohhalm.
Ausführlicher Kinder-Pogo
Als die Punk-Mutter in langer Warteschlange Zugtickets kaufen gehen muss, geht die Streiterei der Brüderchen los. Erst um eine Cola Light, die in gebückter Haltung verteidigt wird – bis eine zweite Flasche vom Caritas-Buffet auftaucht. Kurze Ruhepause. Dann möchte der fünfjährige Kleine unbedingt den Stoffpapagei, den der mittlere Junge geschenkt bekommen hat, gegen seinen neuen blauen Teddy eintauschen. Bequatscht eindringlich seinen Bruder und schubst ihn mehrmals auffordernd. Der weigert sich. Ausführlicher Kinder-Pogo. Als sich die Security-Damen – beide im Ramadan-Fastenmodus gerade ohne Wasser und Essen – einmischen, bricht der mittlere Junge plötzlich zusammen, fällt auf die Knie und heult verzweifelt. Augenscheinlich kommt ein großes Maß an Kriegs- und Fluchtstress lautstark heraus. Lange Zeit ist er nicht zu trösten. Irgendwie ist es auch gut, dass etwas Trauer und Verzweiflung herausbricht. Der Kleinste versteckt sich unter einem Stuhl – seine Rechnung, sich in all dem Chaos und der Katastrophe voll auf seinen Bruder zu fokussieren, ist nicht aufgegangen. Ein bisschen weint auch er, während die eine Ramadan-Security-Dame versucht, ihn unter dem Stuhl hervorzulocken. Der brave älteste Bruder weiß auch nicht, was tun. Als die Punk-Mutter eilig zurückkommt, versiegt der gewaltige Tränenstrom urplötzlich – die drei Kleinen springen auf und sind sofort wieder im Start- und Davonlaufmodus. Rucksäcke und Mützen haben sie sowieso nie abgenommen.
Tell them, that I come
Die Punk-Mutter möchte nach Cluj in Rumänien weiterfahren, dort gibt es Freunde, die die Familie erwarten. Ich erzähle ihr, dass ich mit dem Wiener Jüdischen Chor schon in Cluj war. Die Geschichte von Cluj ist eng mit dem Holocaust verbunden. Die Zeit bis zum Anschlusszug ist zu knapp, um ihr den Hintergrund zu erklären. »Es gibt einen jüdischen Chor in Cluj?«, versteht sie falsch. »Ich möchte mit ihnen singen. Tell them, that I come!«, sagt sie und lacht. Als ich etwas später in den noch immer am Gleis stehenden Zug nach Budapest klettere, um den Kindern noch schnell kleine Bureks und Pasteten-Törtchen zu bringen, ist die Frau gerade dabei, mit schwingendem Messer einen riesigen Berg an Schwarzbrot zu schmieren. Die Kleinen haben nach wie vor die Hauben auf und die Rucksäcke oben. Der Gang ist voll mit ukrainischen Geflüchteten, Plastiksackerln und Koffern und schwer schaffe ich es, wieder aus dem Zug auszusteigen.
Valeriya, ihre Tochter und ihre Mutter wollen am Abend nach Brüssel weiter, wohin sie ein Freund aus Kindertagen eingeladen hat. »Meine Tochter hatte Klavier- und Gesangsunterricht«, schüttelt Valeriya den Kopf, »außerdem Ballett. Die Musikschule ist bis auf die Grundmauern verschwunden.« Wieder und wieder spielt sie auf ihrem Handy den Film über ihre zerstörte Stadt ab. Die Kleine, die kein einziges Wort redet, steht plötzlich in Ballettposition da. Als alte Schlagzeugerin schlage ich vor, dass das Mädchen in Brüssel Schlagzeugunterricht erhält, um ein bisschen zu hauen und Krach zu erzeugen. Um nicht nur die typischen Melodieinstrumente für Mädchen zu lernen. Valeriya nickt, denn in ihrer Musikschule übten wirklich die Jungs die Rhythmusinstrumente ein, die Mädchen Melodieinstrumente. »Wir werden psychologische Hilfe brauchen«, stellt sie plötzlich fest. Wenigstens hat sie ihr Smartphone mittlerweile eingesteckt.