Frédéric Valin stammt aus dem Allgäu, studierte Deutsche Literatur und Romanistik und machte früh Erfahrungen als Arbeiter im Bereich der Pflege. Sieben Jahre lang war er hauptberuflich in der Pflege beschäftigt, ein weiteres Jahr in einer intensiven Einzelbetreuung. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher im Verbrecher Verlag, schreibt u. a. für »taz«, »Jungle World« und »Das Neue Deutschland« und spricht über Fußball, Frankreich und mit Autor*innen. Seine Texte entstehen in journalistischer oder literarischer Form oder auch irgendwo dazwischen. Hat er sich bei »Pflegeprotokolle« für die reine Wiedergabe von Gesprächen mit Care-Arbeiter*innen entschieden, so entstand sein als Roman bezeichnetes »Haus voller Wände« zwar mehr oder weniger zur selben Zeit, entwickelte sich letztendlich aber in einer literarischen Form. Dabei wurden verschiedene Episoden aus seiner Arbeit lose miteinander verbunden. Beginn und Ende seiner Beschäftigung als Pfleger markieren Start- und Endpunkt der Geschichte und entwickeln damit zwangsweise eine gewisse Dramatik im Aufbau. Jedoch, und das war ihm auch wichtig, verläuft die Zeit in den von ihm beschriebenen Räumen nicht derart linear, wie sie es in der Regel außerhalb zu tun pflegt. Der Erzähler springt, reminisziert, knüpft Querverbindungen und begibt sich in ausführliche, äußerst kenntnisreiche Auseinandersetzungen mit aufkommenden Thematiken wie beispielsweise Behinderung, Krankheit oder Tod. Seine Sprache ist explizit, äußerst exakt, seine Beobachtungen sind sensibel und sein Standpunkt ist ein kämpferischer, selbstkritischer und immerzu dem Individuum zugewandter. Das macht das Lesen so ungemein lehrreich und berührend. Und bei all den beschriebenen Missständen nicht zuletzt äußerst wütend. Frédéric Valin ging mit Freude auf unsere Interviewfragen ein.
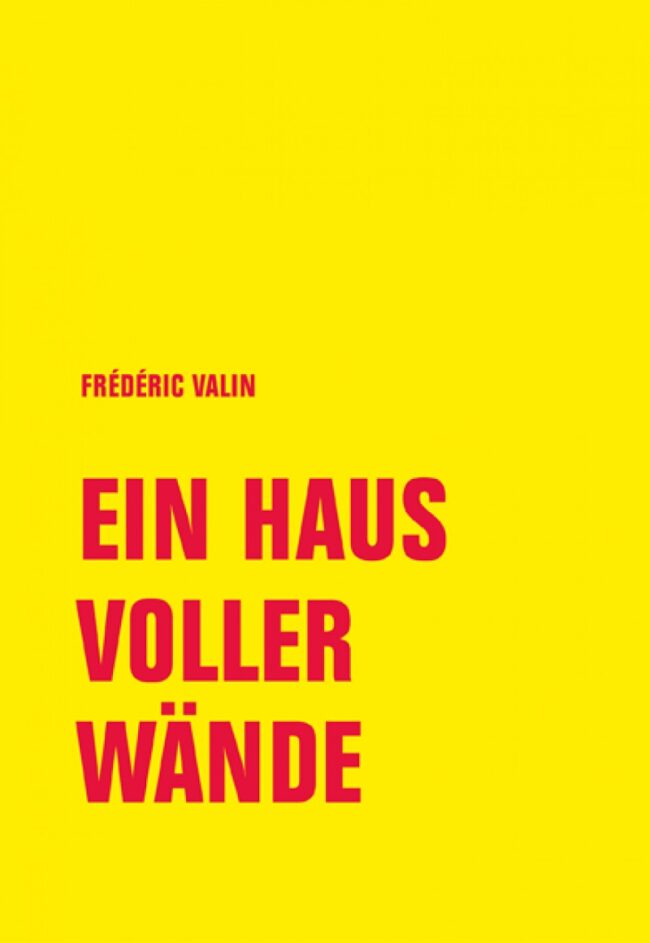
skug: Was war der Auslöser für die Arbeit an den Pflegeprotokollen zu Zeiten der Pandemie?
Frédéric Valin: Die Idee hatte ich schon länger. Ich habe damals selbst im siebten Jahr als Pfleger gearbeitet und auch Soziale Arbeit studiert und habe sehr viele für meine Begriffe existenzielle Geschichten gehört, die Maßgebliches über diese Gesellschaft erzählen. Mit Beginn der Pandemie kamen dann zwei Dinge zueinander, die das Projekt haben Fahrt aufnehmen lassen: Zum einen hatte ich Zeit, weil ich mich sehr früh schon komplett isoliert habe, und zum anderen gab es einen ganz konkreten Anlass, der bei allen gleich war und einen Rahmen bot, der natürlich immer schon so da war, aber einem unbeteiligten Publikum trotzdem mühsam hätte erklärt werden müssen.
Wie waren die Reaktionen auf die Veröffentlichung der »Pflegeprotokolle«? Und vor allem: Wer hat darauf wie reagiert?
Die Reaktionen waren größtenteils positiv. Es herrscht bei vielen ein enormer Wissensbedarf und den kann das Buch stillen. Das ging so weit, dass die Bundeszentrale für politische Bildung das mitaufgenommen hat. Die Reaktionen von Kolleg*innen waren dabei mit das Schönste, ich habe viele Mails und Nachrichten bekommen von Leuten, die sich freuten, dass sie auch mal gesehen werden. Die Feuilletons haben bis aufs Radio gar nicht reagiert, weil sie fanden, das sei keine Literatur. Sozial interessierte Bücher stehen in Deutschland schnell im Verdacht, keine Kunst zu sein. Auch einige vor allem jüngere Buchblogger*innen, die einen eher hehren Literaturbegriff pflegen, haben sich gefragt, wie sie das einordnen können. Denen war das Buch bisweilen auch zu rough, zu hart, zu wenig poetisiert. Glücklicherweise hat sich Jan Drees von Deutschlandradio Kultur die Mühe gemacht und sehr detailliert auf die Tradition der Protokoll-Literatur verwiesen. Das hat mir viele Fragen erspart. Es gab sehr viel Interesse über das Buch zu diskutieren, insbesondere von gewerkschaftlicher Seite. Nicht interessiert hat sich die Politik, was ich schon enttäuschend fand. Regelrecht geächtet wurde das Buch von Trägern aus dem Sozialen, die kommen da nicht unbedingt immer gut weg. Das ist beim »Haus voller Wände« noch schlimmer, da unterbinden Geschäftsleitungen Veranstaltungen, die Kolleg*innen mit mir machen wollen würden.
Warum ist die Pflege beispielsweise in den Niederlanden, der Schweiz oder Skandinavien so viel besser als in Deutschland? Kann man das pauschal beantworten?
Ich muss vorab sagen, dass ich keine Detailkenntnisse habe über die Pflege in anderen Ländern, Frankreich ausgenommen. Ich weiß, dass einige Kolleg*innen in die Schweiz gehen, weil sich da deutlich mehr Geld verdienen lässt; die sind aber auch nicht übermäßig begeistert vom Zustand der Pflege dort. Was Skandinavien anbelangt, gelten beispielsweise in Norwegen 33 Stunden im Schichtdienst als volle Arbeitswoche; das ist sehr sinnvoll, weil Schichtdienst enorm zehrend ist. Familie und Pflege unter einen Hut zu bekommen, ist mit einer Vollzeitstelle kaum dauerhaft zu schaffen. Was ich sagen kann, ist, warum ausländische Pflegekräfte nicht gern in Deutschland bleiben. Das sind im Grunde drei Gründe: der Rassismus hierzulande, und zwar auf allen Ebenen, also der von Gepflegten, der von Kolleg*innen, der der Leitungen und der auf politischer Ebene. Dann die Sprache und außerdem das Berufsbild der Pflege. Es kommen hier top ausgebildete Leute an, die in ihren Ländern arztähnliche Tätigkeiten ausgeübt haben, deren Ausbildung hier aber nicht anerkannt wird (das läuft in anderen Ländern, zum Beispiel Österreich, besser) und die machen hier in den Krankenhäusern dann Grundpflege: waschen, füttern, lagern, Tee kochen. Das frustriert sie natürlich, und Personalführung in der Pflege erschöpft sich obendrein größtenteils in den Anrufen Sonntag früh um halb fünf, wenn du dann angewiesen wirst, zum Dienst zu erscheinen, weil jemand ausgefallen ist. Es gibt hierzulande so eine generelle Geringschätzung aller Care-Berufe, es ist ein sehr kaltes Land.
Gab es denn Verbesserungen im Bereich der Pflege im Zuge der Pandemie?
In den meisten Pflegeberufen ist das Back-to-normal-Narrativ voll durchgeschlagen. Die Personalsituation hat sich weiter verschlechtert, weil manche tot sind und manche Long Covid haben und andere Burnout. Für die Gepflegten selbst sind das tödliche Zeiten, die werden jetzt einfach wegsegregiert, auch sowas geht ja nicht spurlos an den Beschäftigten vorbei. Aber strukturell hat die Pandemie in manchen Bereichen sogar leichte Verbesserungen gebracht.
Inwiefern? Kannst du Beispiele nennen?
Die wichtigste Verbesserung ist gar nicht pandemiebezogen, fällt aber zeitlich mit ihr zusammen. 24-Stunden-Kräfte in der häuslichen Pflege bekommen jetzt auch die Zeit bezahlt, die sie arbeiten. Ein anderer Erfolg waren die Streiks in Berlin und NRW, das waren aber keine Pflegestreiks, sondern Krankenhausstreiks. Allerdings sieht es gerade so aus, als würde zum Beispiel in Berlin der Tarifvertrag Entlastung, der beschlossen wurde, von der Klinikleitung verschleppt. Diese relativen Erfolge, von denen es noch ein paar mehr gibt, sollte man aber ins Verhältnis setzen: Die Pflege blutet trotzdem langsam aus. Viele reden ja immer von einem befürchteten Zusammenbruch, den wird es meiner Meinung nach nicht geben. Es wird eine schrittweise Verschlechterung geben, und es ist ja jetzt schon so, dass da dann Leute in der Notaufnahme sitzen, das Bein dick und heiß, und dann wieder nach Hause geschickt werden, weil man sich denkt, hm, ja, könnte schon sein, dass sich da ein Thrombus gelöst hat, aber ist jetzt eh zu spät und ich hab’ auch kein Bett, mal kucken, ob die morgen dann wiederkommen mit Schlaganfall oder Herzinfarkt. Da braucht man sich keine Illusionen machen, so läuft das gerade. Eine ganz grauenhafte Idee ist ja auch Lauterbachs Krankenhausreform, der denkt sich halt: Wenn ich die kleinen Kliniken zumache, dann hab’ ich wieder so und so viele Pfleger*innen frei, die sich dann wie bei einem Aufmarschplan hin- und herschieben lassen. Aber bezahl mal mit einem Pflegendengehalt eine Großstadtwohnung. Die Leute werden den Beruf einfach an den Nagel hängen oder 20 Stunden im örtlichen Altenheim machen. Man muss auch sagen, dass es die Leute im Großen und Ganzen nicht genug juckt, was da alles schief ist.
Wie schaust du auf die Zeit der Pandemie zurück, die für viele als überstanden gilt? Ich vermute, auch für dich ist das keineswegs so …
Magisches Denken ist das. Es heißt jetzt anders, also ist es vorbei. Als Karies endemisch wurde, hat man auch Maßnahmen dauerhaft übernehmen müssen, sonst hätten wir jetzt alle keine Zähne mehr. Das Problem ist halt, dass die meisten Leute einerseits überfordert sind von den vielen, vielen Krisen dieser Zeit und auch keinen Bock haben, sich von Realitäten infrage stellen zu lassen. Das Virus ist weiterhin da, es tötet und es macht krank, und zwar dauerhaft. 4,5 Prozent der Leute, die sich mit Omikron angesteckt haben, haben Long Covid bekommen, da sind so langfristige Folgeerkrankungen wie Diabetes, Alzheimer, Parkinson, Herzinfarktrisiko, Schlaganfälle und so weiter noch gar nicht mit drin. Und die Wahrscheinlichkeit steigt mit jeder Ansteckung. Das ist halt nicht irgendein Grippchen, das ist eine multisystemische Gefäßerkrankung. Weißt du, für wen Covid noch nicht vorbei ist? Für die Reichen. In diesem beschissenen Weltwirtschaftsforum in Davos siehst du auf jedem Foto irgendwo einen Luftfilter stehen und rein kamst du nur mit negativem PCR-Test. PCR, das ist das, was die Krankenkassen zwar noch bezahlen, aber kaum noch Ärzt*innen durchführen. Tja. Gesundbleiben muss man sich leisten können.

Das Nachfolgebuch »Ein Haus voller Wände« ist dann sozusagen dein eigenes, persönliches Protokoll. Was hat dich dazu bewogen, es als Roman zu veröffentlichen?
Ja, für die Verfechter*innen einer reinen Literatur ist auch das kein Roman. Ich habe dem Verlag aber erlaubt, es Roman zu nennen, um klarzumachen, dass es ein fiktionalisierter Bericht ist. Es war schwierig, das Buch zu schreiben, weil die darin abgebildeten Personen sich nicht wehren können. Ich hab’ ja sieben Jahre in einer Gruppe für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung gearbeitet, davon handelt das Buch. Sie werden das Buch aber nie lesen und öffentlich keine eigene Haltung dazu vertreten können. An dem Text saß ich schon vor den »Pflegeprotokollen«, aber die Protokolle haben sich dann in den Vordergrund gedrängt, so dass »Haus voller Wände« erst danach fertig wurde.
Wie war die Arbeit am Roman? Hattest du Referenzwerke?
Nicht so richtig. Ich hab’ irgendwann angefangen, darüber zu schreiben, was ich da so erlebe, erst auf Facebook, dann hat die »taz« gefragt, ob ich nicht eine vierteilige Serie über diese meine Tätigkeit verfassen wollen würde, und dann kam noch ein bisschen später die »Analyse & Kritik« und hat mir einen Kolumnenplatz angeboten. Ich hatte also einen Haufen Text und keine Form. Das Problem war dann, eine Form zu finden, die dem Gegenstand ansatzweise gerecht wird. Meine Theorie ist, dass Romane auch eine Darstellung von Zeit sind, also sehr stark von einer allgemein bekannten Zeitverlaufslogik durchdrungen sind. Aber das ist das Problem: Diese Logik existiert in totalen Institutionen wie einer Wohngruppe nicht. Die Zeit verläuft anders in Einrichtungen, die Ereignisse sind oft Wiederholungen, die obendrein einer Taktung unterliegen, es ist verwaltete Zeit. Das macht jeden größeren Spannungsbogen und damit Sinn kaputt und das ist auch der Grund, warum die prominentesten Erzählungen über Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung Roadmovies sind, also »Forrest Gump« etwa oder »Rain Man«, obwohl solche Plots vom Erleben so gut wie aller Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung absurd weit entfernt sind. Ich habe mir im Vorfeld Beckett angekuckt, »Texte und Erzählungen um Nichts«, aber mir dann gedacht, dass ich den metaphysischen Charakter, wie er bei Beckett auftritt, nicht diesem Thema überstülpen kann. Also habe ich mich dazu entschlossen, Miniaturen aneinanderzureihen, weil das für meine Begriffe am besten spiegelt, wie Zeit wahrgenommen wird in solchen Einrichtungen, und zwischendrin essayhafte Überlegungen einzustreuen, die aber nicht die Entwicklung des pflegenden Helden vorantreiben, sondern für sich stehen, als Beschreibung und Analyse der systemischen Gewalt, die durch diese Einrichtung aufrechterhalten wird.
Du sprichst mehrfach vom Einfluss der Kirche auf Verwaltung, aber auch Ethik in der Pflege. Kannst du das noch etwas ausführen?
Das ist eine große Frage. Meine Antwort wird flapsig klingen und das muss sie auch, weil dazu könnte man Bibliotheken vollschreiben.
Historisch hat sich die Kirche mit dem Caritas-Gedanken die Pflege einverleibt und gerade das Christentum hält auch große Stücke darauf, sich um die Verstoßenen gekümmert zu haben und zu kümmern. Die Infrastruktur der Trägerlandschaft ist in einigen Bereichen, gerade Alten- und Behindertenhilfe auch nach wie vor stark christlich dominiert. Das framed Care-Arbeit zu einer persönlichen Tätigkeit, die man aus Eigeninteresse macht, um in den Himmel zu kommen, also um integer zu sein. Das heißt, die Gepflegten sind Mittel zum Zweck des eigenen Seelenheils. Und das heißt auch, dass es ein gemeinsames politisches Interesse nicht gibt, es bleibt halt Elendsverwaltung. Aber immerhin interessiert sich die Kirche für die Leute, die pflegen und gepflegt werden. Der neoliberale Gegenvorschlag, die Pflegenden und Gepflegten zu reinen Kennzahlen zu machen, ist viel ungreifbarer. Was halt fehlt, ist eine linke, menschenfreundliche Perspektive und Infrastruktur. Das ist schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass viele Pflegende tendenziell eher links wählen. Wenn wir über die Kirche und das Christentum reden wollen, müssen wir also gleichzeitig über das Versagen der Linken reden, linke Versorgungsstrukturen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Es müsste einer Linken darum gehen, in diesen Bereichen – explizit Alten- und Behindertenhilfe – der Kirche das Wasser abzugraben und nicht nur Kritik an ihr zu üben.
Das Scheitern im Umgang mit Covid ist ja im ganzen politischen Spektrum offensichtlich geworden. Die Pandemie war da echt ernüchternd …
Wir sprechen ja hier von Linkem zu Linkem, würde ich mal unterstellen, und auch da gäb’s Fragen, die zu untersuchen wären: Wie kann das eigentlich sein, dass Teile der antiautoritären Linken derart verblendet waren, zu glauben, mit der Aufhebung der Schutzmaßnahmen wäre irgendeiner Arbeiter*innenschaft geholfen? Was jetzt halt passieren wird, ist, dass das Virus durchläuft, bis ein Gutteil der Bevölkerung kaputt ist, und das betrifft halt vor allem die unteren Schichten; die Mittelschicht sitzt im Homeoffice oder hat das Geld für Luftfilter, die Oberschicht leistet sich die PCR-Tests und all den Kram. Aber die Leute, die malochen gehen, die werden kaputt gehen, vor allem wenn sie Kinder haben. Da wäre eine intensive Selbstbefragung linksintellektueller Kreise, wie sie diesem Springer-Narrativ von der Freiheit aller vor der Maske und allem anderen aufsitzen konnten, unbedingt notwendig.
Würdest du den Eindruck teilen, dass die Pflegearbeit ein Bereich ist, in dem sich das Elend der gesellschaftlichen Verfassung und der Stellung des Menschen besonders gut zeigt?
Besonders gut weiß ich nicht. Wir lassen Kinder im Mittelmeer ersaufen, Familien in Kellerlöchern verrecken oder in Zeltstädten erfrieren. Ich denke, da zeigt sich besonders deutlich, was Europa ist. Meine These wäre: Diese Gewalt nach außen lässt eine Gesellschaft auch im Inneren nicht unangetastet, weil die Trennung von Innen und Außen freilich künstlich ist. Werden Menschenrechte an den Grenzen abgeschafft, erodieren sie auch im Inneren, allerdings subtiler. Insofern würde ich sagen: Das Elend zeigt sich nicht besonders gut, aber die Unmenschlichkeit unseres Systems zeigt sich auch da.
Was wäre jetzt zu tun? Planst du weitere Projekte zu diesen Thematiken?
Ich hab’ danach als 24-Stunden-Kraft in der häuslichen Pflege gearbeitet, aber nicht klassisch mit Arbeitsvertrag, sondern als Mitbewohner einer dementen Dichterin. Das waren die härtesten 12 Monate meines Lebens. Darüber habe ich hier ein halbfertiges Manuskript rumliegen, aber ich komme gerade nicht dazu, es fertigzustellen, weil ich zwischenzeitlich Vater wurde und ich in dieser Rolle gebraucht werde und auch in der Rolle gebraucht werden will. Prinzipiell glaube ich nicht, dass aus einer Innensicht der Pflege begriffen werden kann, was diese Pandemie bedeutet. Eine wichtige und sinnvolle Ergänzung wäre meiner Ansicht nach eher ein ähnliches Projekt aus Betroffenenperspektive, das aber vor sehr vielen praktischen Schwierigkeiten steht. Wie kommt man an die Leute, mit denen unbedingt gesprochen werden müsste, wie kriegt man Zugang? Das ist sehr viel Arbeit. Das schaff ich gerade nicht. Ein anderer Ansatz wäre, pflegende Angehörige zu befragen und sich anzukucken, was die machen. Pflegende Angehörige sind die Personen, die diese Pandemie wirklich in aller Breite erlebt haben. Das beinhaltet auch Schattenfamilien.



















