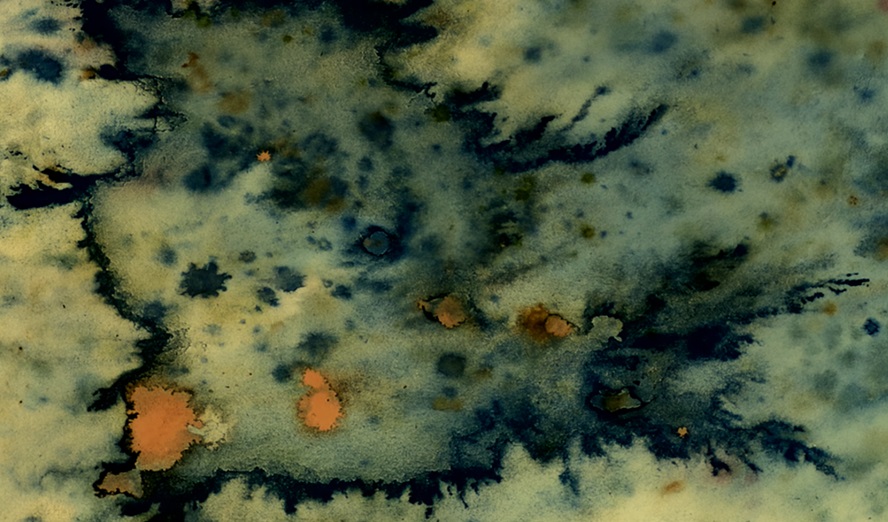Die Menschheit und ihre Musik leben seit Jahrhunderten untrennbar voneinander und gehen bis heute im Gleichklang weiter. Was verbindet aber uns mit diesem Phänomen? Die Hauptsache besteht darin, dass Musik und Sprache die vermittelnden Zeichensysteme darstellen, egal ob sie konstativ, performativ oder affektiv wirken. Mit anderen Worten gilt die Binarität bzw. Mehrdimensionalität des Zeichens als eines der Grundprinzipien und zugleich Ähnlichkeit(en) der zu besprechenden Erscheinungen. Dies veranschaulicht gegenseitige regelgemäße Verwandlung von Lauten, Geräuschen und Klängen in Zeichen, Wörter und syntaktische Strukturen (bzw. Noten, Notationen u. ä.). Existieren aber auch solche Konzepte bzw. Meinungen, die der Sprache und Musik entweder Angeborenheit (das heißt genetische Zugehörigkeit/Herkunft) oder Erlernbarkeit zuschreiben? Um Wiederholungen bezüglich des Themas zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Arbeiten von Manfred Bierwisch und Christian Grüny zu lesen (siehe Anhang). Die daraus folgenden Universalien und Differenzen zwischen Sprache und Musik ermöglichen es uns, uns an die Frage des Objektiven und Subjektiven, des Universellen und Lokalen anzunähern.
Bei den unten angeführten Erklärungen steht das folgende Interesse im Vordergrund: Wie nimmt das menschliche Ohr die modernen Lieder wahr und welche Rolle spielt dabei die jeweilige Sprache bzw. das Sprachsystem? Da sich die Wahrnehmung und das Schönheitsverständnis als gestalterische und kreative Prozesse nicht nur von Rezipienten, sondern auch von Produzenten definieren lassen, ergibt sich daraus, dass es keinesfalls einfache Abbildung der Wirklichkeit ist. Das heißt, wir richten uns nach den von uns gebildeten, subjektiven Regeln, persönlichen Deutungen, individuellen Bewertungen u. ä. Wenn es bei manchen nonverbalen Maßnahmen, die zum Ausdruck unserer Emotionen dienen können, zulässig ist, existieren aber in der Linguistik einige Kriterien, anhand derer man einen Versuch unternimmt, unseren sprach-musikalischen Geschmack und unsere Vorlieben objektiver zu begründen. Zu solchen gehören soziokulturelle, langfristige Faktoren (Trends beim Sprachenlernen), Persönlichkeitsfaktoren (Extraversion, Offenheit, Umgänglichkeit u. ä.), individuelle Lerngeschichte (die Bewegung/Entwicklung nur im Rahmen des Erlernten bzw. Erlernbaren) und selbst die linguistischen Faktoren (Vokalharmonie, Sprachmelodie, Laute u. ä.).
Zum sprachpolitischen Denken
Leider lebt die Menschheit seit jeher in historischen Kontexten, in denen einige Nationen bzw. Länder oder Kulturen die anderen zu dominieren versuchen. Das bedeutet aber nicht immer direkte Konfrontation untereinander, es kann auch wirtschaftliche, politische oder kulturelle Konkurrenz sein. Das Programm der zumindest nominalen Präsenz dieser Länder ist so gut ausgearbeitet, dass man heute über Phänomene wie Sprachpolitik, Popularisierung der Kultur und damit verbundene Maßnahmen spricht. Es bestimmt unsere teilweise ausweglose Lage z. B. bei der Wahl der Schule oder der erwünschten Fremdsprache. Welche Fremdsprachen lernt man heutzutage in staatlichen Schulen? Außer Englisch? Französisch? Überlegen wir einmal, ob und wie viele Schulen es z. B. in Wien mit (erweitertem) Portugiesisch-Unterricht gibt … Eine? Eineinhalb?
Noch trauriger ist die Situation dort, wo die Menschen aufgrund der politischen Gründe »stumm« werden. Das oben Geschriebene ist tief mit der individuellen Lerngeschichte verbunden, das heißt, wir finden solche Sprachen und ihre musikalische Verwirklichung am schönsten, weil wir einfach keine Erfahrung mit anderen Sprachen haben, weil wir sie wahrscheinlich nie gehört haben usw. Wie Johann Wolfgang von Goethe gesagt hat: Es hört doch jeder nur, was er versteht. Deshalb hört man oft Aussagen solcher Art: »Englisch ist meiner Meinung nach die beste, einfachste und schönste Sprache, die existiert« oder »Französisch ist sehr weich, romantisch, elegant und ästhetisch angenehm«.
Laut einiger psychologischer Studien bestimmen die Persönlichkeitsfaktoren unsere musikalischen Vorlieben und umgekehrt. Die Befriedigung der auditiven Bedürfnisse des Menschen finden aber nicht immer im Fluch aus dem Alltag oder in Erinnerungen ihre Realisierung … wie man es behauptet. Natürlich folgt ein Prozentanteil Prinzipien wie »Wir lieben, was wir wiedererkennen«, was wie gesagt mit der Spracherkennung korreliert. Die Persönlichkeitseigenschaften, unser kognitiver Stil, unsere Denkart prägen unseren Musikgeschmack und auch Sprachvorlieben. Es spiegelt sich z. B. in unserer Extra- und Introversion wider: Interesse an schnell vs. langsam gesprochenen Sprachen (wie z. B. Spanisch vs. Chinesisch) oder einfach der Faktor, dass extrovertierte Personen beim Sprachlernen (und der dazugehörigen Interaktion) erfolgreicher sind als introvertierte. Existiert aber eine kontroverse Meinung in Bezug darauf, dass (fast) alles sowohl musikalisch als auch sprachlich erlernbar sein kann? Die Suche nach der Antwort auf diese Bemerkung würde man an Pädagogen und Psychologen bzw. an weitere Studien übergeben.

Zusammenhang von Musik und Sprache: Exemplifizierung
Wenn man aber die Relation oder Verbindung zwischen Musik und Sprache und unsere darauf gerichteten Vorzüge mit rein linguistischen Faktoren erklärbar machen möchte, dann wäre es sinnvoller, in erster Linie die phonethisch-phonologische Besonderheiten bzw. lautlichen Seite des zu beobachtenden Phänomens zu erwähnen. Die semantische Ebene, mit anderen Worten die innerliche Seite, bleibt sehr oft, besonders bei fremdsprachigen musikalischen Werken und Fremdsprachen an sich, weit entfernt von unseren Vorstellungen und angewiesenen Kenntnissen. Es bleibt nichts mehr, als die Lautung bzw. Sangbarkeit zu bewerten. Seit Langem gelten für viele Menschen gerade die romanische bzw. italische Sprache als konsolidierte Prototypen der sprachlichen Musikalität und Schönheit. Die Wohllautung z. B. des Italienischen, Spanischen und Französischen bestimmen Vokale, die dabei eine entscheidende Rolle spielen. Die westliche(n) Gesellschaft(en) im Gesicht der Laienschaft lernen wenige oder fast keine Sprachen, für die Schnalzlaute oder Klacklaute typisch sind, und das nur, weil wir es nicht als musikalisch, das heißt nicht als wohllautend empfinden … zumindest die Mehrheit von uns.
Es ist sehr interessant, dass einige Sprachen nach so einem System aufgebaut wurden, das der Regel der Sangbarkeit folgt. Diese zauberhafte Eigenschaft heißt Vokalharmonie, die eine angemessene bzw. erwünschte Klangfarbe schafft. Solche Vokalangleichungsprozesse trifft man vor allem in finno-ugrischen und Turksprachen. Zu den Vorteilen des rezeptiv beobachteten Phänomens gehört auch die Vereinfachung der Produktionsvorgänge der Artikulationsbasis des Sprechenden bzw. Lernenden. Von Artikulierung der Worte in Sprachen (als einer verbalen Komponente) ausgegangen, folgt die Intonation bzw. Melodie (Akzentologie), noch einfacher die Stimme (als non-verbaler Komponente). Es wäre unvernünftig, zu sagen, dass sie nur eine schmückende Rolle für das menschliche Ohr spielen. Natürlich gibt es rein linguistische Funktionen dazu, wie die Erweiterung der Bedeutungen, des Wortschatzes, daraus folgt die Klassifizierung nach Intonationssprachen und Tonsprachen … In den meisten uns bekannten westlichen Sprachen lässt sich aber von einer einprägsamen Wirkung der Sprachmelodie wie Stimmung und Färbung sprechen. Im Fall der Sprachen, die sich nicht mit Vokalharmonie, Melodie oder anderen besonderen phonetischen Erscheinungen wie z. B. Nasalität (was von manchen auch als schön empfunden werden könnte) auszeichnen, spricht man über ihre relative Einfachheit, Kürze u. ä., was sich besser in Metrik bringen lässt.
Da das Sprachenlernen und die Wahrnehmung (das heißt die Schönheit bzw. Musikalität) von Sprache Geschmacksachen sind, steigt dabei die Bedeutung der Lehrenden als Vermittler, als metaphorische Brücke zwischen zwei Kulturen und Wirklichkeiten, als ob nur sie Ahnung, Richtigkeits-, Reinheits-, Wohllauts- und Schönheitsgefühle derjenigen Sprache erworben hätten. Je fließender die oberflächliche, subjektive Empfindung der sprachlichen Musikalität ist, desto flexibler muss der Übersetzende sein, um z. B. den Verlust von Romantik und Geschmeidigkeit einiger romanischer Sprachen durch die Ausdrucksstärke des Deutschen (in der Form der Komposita) zu kompensieren … oder zu versuchen, die Wohllautung und Eleganz zumindest durch die deutschen Varietäten und Dialekte zu erreichen. Die letzte Instanz ist aber stets unser Herz und unser Gefühl, was wieder extreme Subjektivität mit sich bringt. Wer diesen folgt, kommt nie aus dem Takt.
Literatur:
Manfred Bierwisch: »Musik und Sprache. Überlegungen zu ihrer Struktur und Funktionsweise«. In: Eberhardt Klemm (Hrsg.): »Jahrbuch Peters, 1. Jg, 1978«. Leipzig: Edition Peters 1979. S. 9–102.
Christian Grüny (Hrsg.): »Musik und Sprache: Dimensionen eines Schwierigen Verhältnisses«. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2012.