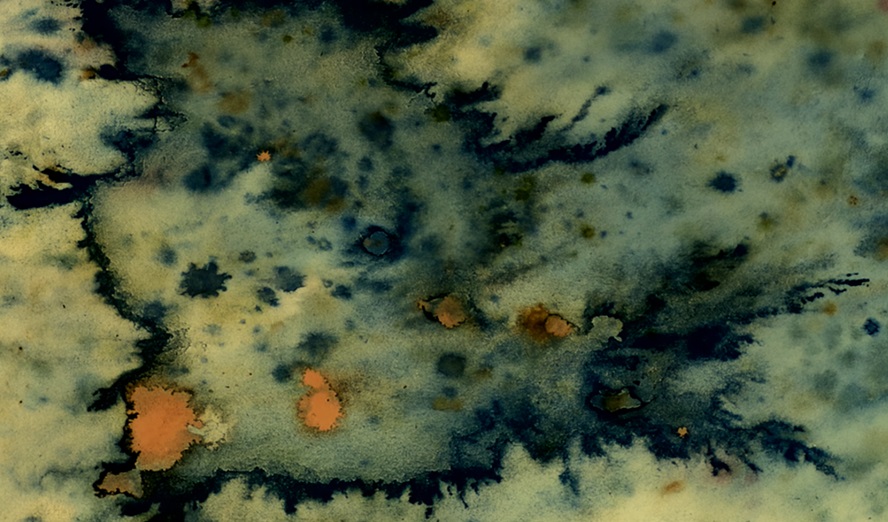»In manchen Gesellschaften werden die Menschen mit vorgehaltenem Maschinengewehr gezwungen, sich in bestimmter Weise zu verhalten. In unserer Gesellschaft wird dies durch scheinbare Freiheit erreicht.« (Paul Willis)
Die im Verlag Turia + Kant erschienene Textsammlung »Compared to What?« kreist um die Frage des Verhältnisses von Normativität und Subversion im Pop. Eine Frage, die gerade dank ihrer letztlichen Unbeantwortbarkeit längst zu einer Art Philosophia perennis der Cultural Studies aufgestiegen zu sein scheint. Dem Pop wird hierbei unterstellt, dass sich in ihm Normativität und Subversion in einem dialektischen Verhältnis befänden. Zunächst scheint dies plausibel und zahlreiche Beiträge in dem feinen, von Tobias Gerber und Katharina Hausladen herausgegebenen Bändchen bemühen sich redlich, diese Dialektik zu beschreiben. Die dabei gewonnenen Einsichten sind meist nicht ganz frei von einer gewissen schnoddrigen Distanzierung gegenüber der Grundfrage. Und tatsächlich, bei genauerer Betrachtung müssen – wie immer – gewisse Zweifel entstehen, ob der erste Blick, was das Verhältnis von Subversion und Normativität betrifft, nicht doch trübt. Deswegen ein philosophischer Klärungsversuch, der, trotz bester Intention, vielleicht sein Gegenteil bewirkt. Dennoch.
Normierende Subversion/subversive Norm?
Ketzerisch lautet die Frage an die Frage: Kann Subversion überhaupt neue Normen schaffen oder passiert das immer erst beim »Aufräumen«? Lösen sich Normen nicht zuweilen auf, ohne erkennbaren Akt der Subversion? Ist diese Dualität somit eine nachrangige Beschreibung lebendiger Verhältnisse, die in diesem Widerspruch verfehlt werden? Einerseits: Noch die konservativste Regelbefolgung ist als Handlung einzigartig und unwiederholbar. In moderater Abwandelung jenes bekannten Heraklit-Fragmentes darf gesagt werden: Kein Antragsformular kann ein zweites Mal gelocht und in den gleichen Ordner geheftet werden. Andererseits: Jede Subversion die nicht Raum und Zeit komplett und unwiederbringlich außer Kraft setzt, bleibt diesen verbunden. Nun ist aber der ganze Witz einer Revolution – ob in Kunst oder Politik – gerade der, dass sie genau dies versucht. Allerdings geschieht dies immer nur immanent und kann äußerlich, von einer historischen Betrachtung als ein Ereignis in einer Kontinuität von Ereignissen beschrieben werden. Solange Donald Trump die Finger vom Atombombenknopf lässt, gilt dies für alle Ereignisse der menschlichen Geschichte.
Eine wissenschaftliche, literarische oder essayistische Beschreibung gewinnt nun aber ihre Größe dadurch, dass sie die immanenten Unterschiede nicht leugnet und öde auf die Kontinuitäten verweist und den Truismus des »Immer-weiter« betont. Als existenzialistische Marxisten (falls es so etwas gibt) brauchen wir uns nicht darüber zu wundern, dass alle Revolutionen äußerlich zu scheitern scheinen, denn beim Blick auf sie sind sie ja schon längst »gegessen«, aber innerlich sind sie eben genau das, was die Lebenden von den Toten unterscheidet. Darin mag sich dialektische Entfaltung zeigen (oder nicht), zumindest muss die Möglichkeit eines Wandels bewahrt und gegenüber bürgerlichen AutorInnen geschützt werden, die diese gerne rundherum leugnen, weil sie »nichts Neues unter der Sonne« sehen. Letztlich muss wohl jeder Versuch, Normativität von Subversion kategorisch abzugrenzen, scheitern, denn ihr Wechselverhältnis zu beschreiben, führt in einen Ringelreigen, bei dem jedes Innehalten einen bereits durchlaufenen Punkt beschreibt. Und dennoch ändert sich etwas.
Subversionstheorien
Kein Wunder also, dass die AutorInnen das Bedürfnis haben, sich diese Frage ein bisschen zurechtzustutzen. Roger Behrens versucht die Frage zu entzünden, indem er tüchtig das Benzin der Nestbeschmutzung ins nur mehr glimmende Feuer gießt. Die SchreiberInnen stehen vor einem simplen Problem beim Schreiben: Wollen sie keine normative Erbauungsliteratur liefern, dann braucht ihre eigene Subversion Glauben. Davon ist nur mehr wenig vorhanden. Geistige Ûbungen, die sich daran weiden, Subjektlosigkeit zu diagnostizieren, verlieren das Subjekt der Schreibenden gleich mit. Dies scheint zunächst kein Problem zu sein, Betrieb braucht keine Menschen und warum nicht Gebirge aus unlesbaren Promotionstexten verfassen? Behrens wagt den Rückgriff auf Kantische Grundfragen, weil hier noch das »Ich« in lebendigem Bezug zur gestellten Frage steht. Die Fragen also im Bezug bleiben zu den Fragenden. Ein aus der Luft gegriffenes Beispiel: Wie halte ich diesen Mist eigentlich noch länger aus, der aus all meinem Tun und aus meinen theoretischen Einsichten ein Produkt macht? Wir hören gespannt. Ganz richtig betont Behrens, »ohne Erotik aber, ohne Lust am Text und ohne ein gewisses ›Müssen‹« verliert die Veranstaltung ihren Sinn. Folgenlos inszeniert ein Wissenschaftsbetrieb Variationen, die nicht mehr auf Veränderung zielen.
Diedrich Diederichsen nun schlüsselt die Chose in zehn Thesen auf, u. a.: Die allseits beliebte Subversion kann schlecht sein, wenn sie Auflösung ohne Aufklärung ist. Gleichzeitig kann Normativ als Versuch verstanden werden, Wünschenswertes zu installieren. Dies ist als Abwehr des Ancien régime notwendig, denn kann es eine Ablehnung der einengenden Heteronormativität geben, ohne diese selbst wiederum zur neuen Norm zu erheben? Der Satz »Jede/r soll leben und lieben was und wie er/sie will« ist normativ. Und bringt Spießer zuverlässig auf die Palme, weil damit jene (heilige) Familie in Gefahr gerate, die sie selbst abserviert haben. Knifflig wird es dann durch den Digitalkapitalismus, der die Subversion gerne in Dienst stellt, weil er keiner festen Ordnung mehr bedarf. Gelingt es einer Subversion nicht, neue Norm zu installieren, dann wird sie schnell sinnlos. Wer in seiner Subversion nur den kleinen Ausritt sucht, wird doppelt betrogen, weil weder die Beruhigung der Regelbefolgung genossen werden, noch eine »brave« Subversion je zu Änderungen führen kann. Wir können in der aktuellen Lage kaum je zufrieden sein, da sie zugleich Zerstören und Gutsein verlangt. Einzig in Umbau unserer kleinen »Gefängniskugeln« kann derweil etwas erreicht werden, indem Institutionen kooptiert werden, um sie langsam aufzulösen.
Und jetzt?
Okay, das klingt ein bisschen sehr unbefriedigend. Marcus Maida versetzt der Frage nach verbliebenen Subversionsgelegenheiten einen weiteren tüchtigen Schlag, indem er an das gewichtige Argument der angry young men erinnert. »Was immer du tust, du findest dich wieder im (Verwertungs-)Plan anderer.« Das stimmt leider und macht zu Recht wütend. Allerdings, jetzt reicht’s einmal an geballtem Defätismus – Gegenfrage: Glaubt irgendwer im Publikum, dass die spätkapitalistische Gesellschaft ewig währen wird? Im Guten oder Schlechten wird sie eines Tages enden. KünstlerInnen ahnen so etwas zuweilen, deswegen lohnt es sich, auf sie zu hören. Selbstverständlich gehen jeder richtigen Prognose zahlreiche falsche voraus. Künstlerpech.
Das Problem soll an dieser Stelle nicht kleiner gemacht werden, als es ist. Die Grundstimmung, die in dem Band an verschiedenen Stellen anklingt, stimmt. Geschichte scheint in gewissem Sinne zum Stillstand gekommen zu sein und viele verabschieden sich innerlich vom Mit- und Weitermachen. Sinnloser Wirbel macht die Empfindsameren depressiv. Ganz richtig betont Maida zudem, dass Organisation Vorhersehbarkeit schafft und der immer besser geölte Popbetrieb führt sich ad absurdum, wenn er seine Transgressiönchen periodisch organisiert. Auch irrt er nicht, wenn er betont, der Universalismus sei meist Illusion, da schließlich alles Kontext ist. Was an einem Ort/Zeitpunkt ausgelutscht ist, kann an einem anderen die Wogen hochtreiben. Also letztlich bleibt allen Versuchen ein »Compared to what?«
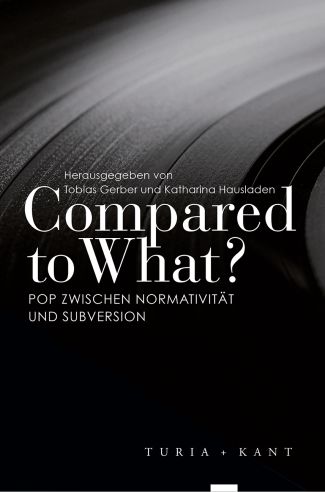 Nur, wie eingangs etwas holprig »meta-normativ« postuliert wurde, muss keine Flinte übereilt ins Korn geworfen werden, denn der Ringelreigen ist außen, das Leben aber außen und innen. Jede Revolte weiß um die vorherigen, kann diese also unmöglich wiederholen und muss neue Weg finden, die sich zumindest als solche erfahren lassen, durch eine anders geartete und vorbildlose innere Vermittlung der Welt mit dem Subjekt. Dass einstweilen viel Pop hier mehr abschreckend als anregend wirkt – keine Frage. Aber dass ein adeliger Herr aus England auch in diesem Sommer wieder über riesige Bühnen schwarteln und lauthals trällern wird, er bekäme einfach keine Befriedigung, wie er es seit 52 Jahren zu tun pflegt, ist seine persönliche Tragödie. Sokratisch gesehen bleibt jene doppelte Hinsicht, die zugleich wahr sein kann und Illusion. Wer zuweilen, vielleicht mit ein paar Bier in der Batterie, ergriffen wird von einer fünfzig Jahre alten Bob-Dylan-Platte, erahnt einen Strom der Möglichkeiten. Zwei Zeilen eines jener bräsigen Interviews mit dem Meister lassen diesen natürlich jäh versiegen. Nur von welcher Metaebene herab kann geurteilt werden, das eine sei falsch, das andere sei wahr? Wenn es einmal möglich war, das ganze Falsche einzufangen und anzuprangern, warum sollte es nicht wieder möglich sein? Wer eine Tür hinter dem eigenen Rücken ins Schloss fallen hört, soll ruhig versuchen, den ganzen Erdball zu umrunden, um zu schauen, ob sich das Ding von vorne nicht erneut öffnen lässt. Klar, ist das viel Gelatsche, aber einfach sitzen bleiben? Auch blöd. Subversion und Normativität beschreiben vermutlich lediglich unklare Endpunkte eines voreilig postulierten Dualismus, der eher äußerlich beschreibt als innerlich entschlüsselt. Bis einem etwas Besseres einfällt, lässt sich die Zeit zumindest sinnvoll nutzen, etwa mit skug lesen oder jenem gelungenen Reader »Compared to What?«.
Nur, wie eingangs etwas holprig »meta-normativ« postuliert wurde, muss keine Flinte übereilt ins Korn geworfen werden, denn der Ringelreigen ist außen, das Leben aber außen und innen. Jede Revolte weiß um die vorherigen, kann diese also unmöglich wiederholen und muss neue Weg finden, die sich zumindest als solche erfahren lassen, durch eine anders geartete und vorbildlose innere Vermittlung der Welt mit dem Subjekt. Dass einstweilen viel Pop hier mehr abschreckend als anregend wirkt – keine Frage. Aber dass ein adeliger Herr aus England auch in diesem Sommer wieder über riesige Bühnen schwarteln und lauthals trällern wird, er bekäme einfach keine Befriedigung, wie er es seit 52 Jahren zu tun pflegt, ist seine persönliche Tragödie. Sokratisch gesehen bleibt jene doppelte Hinsicht, die zugleich wahr sein kann und Illusion. Wer zuweilen, vielleicht mit ein paar Bier in der Batterie, ergriffen wird von einer fünfzig Jahre alten Bob-Dylan-Platte, erahnt einen Strom der Möglichkeiten. Zwei Zeilen eines jener bräsigen Interviews mit dem Meister lassen diesen natürlich jäh versiegen. Nur von welcher Metaebene herab kann geurteilt werden, das eine sei falsch, das andere sei wahr? Wenn es einmal möglich war, das ganze Falsche einzufangen und anzuprangern, warum sollte es nicht wieder möglich sein? Wer eine Tür hinter dem eigenen Rücken ins Schloss fallen hört, soll ruhig versuchen, den ganzen Erdball zu umrunden, um zu schauen, ob sich das Ding von vorne nicht erneut öffnen lässt. Klar, ist das viel Gelatsche, aber einfach sitzen bleiben? Auch blöd. Subversion und Normativität beschreiben vermutlich lediglich unklare Endpunkte eines voreilig postulierten Dualismus, der eher äußerlich beschreibt als innerlich entschlüsselt. Bis einem etwas Besseres einfällt, lässt sich die Zeit zumindest sinnvoll nutzen, etwa mit skug lesen oder jenem gelungenen Reader »Compared to What?«.
Bitte beachten, am Dienstag, 30. Mai 2017 findet im Depot eine Präsentation des Bandes statt: siehe hier
Links:
Roberta Flack: »Compared To What«
www.turia.at/titel/comparedtowhat.php