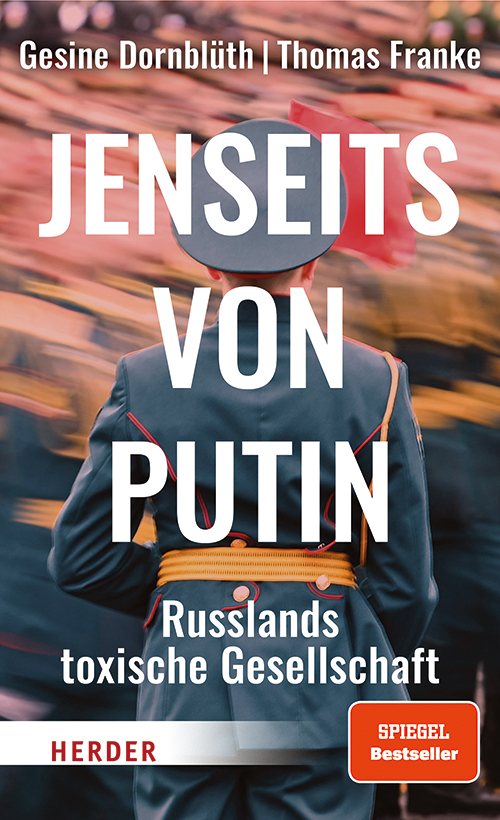Würde der russische Diktator Vladimir Putin über die Büchertische von großen Buchhandlungen wie Thalia oder Morawa blicken, er wäre sich mit jenem berühmten Stalin’schen Schmunzeln seiner weltgeschichtlichen Bedeutung sicher. Allein die deutschsprachigen Titel über »Die Motte« (Putins Spitzname beim KGB, seiner Unscheinbarkeit wegen) gehen jenseits der Marke Hundert. Kein Russland-Korrespondent wurde ausgelassen, der nicht eine Insider-Story zu erzählen hätte, keine Osteuropa-Expertin wurde vergessen, um die ganz großen kulturellen und historischen Zusammenhänge des 17-Millionen-Quadratkilometer-Landes zu erklären. Fiktional wie non-fiktional gibt der Stoff Putin + Geheimdienst + Oligarchen einiges her. Keine Frage. Aber was ist eigentlich mit dem russischen Volk? Und wie sieht es mit der Opposition aus? Die Fokussierung auf den »Einzeltäter« Putin lässt eine zu behauptende Kollektivschuld der russischen Bevölkerung in den Hintergrund treten. Seit zaristischen Zeiten wird es infantilisiert. Schwach und gutgläubig wie die »Bäuerchen« in den Geschichten der russischen Literaturklassiker weiß es, dass Politik die Sache eines gestrengen »Väterchens« ist. Wenn die Peitsche knallt, ist es gut und gerecht. Bleibt Russland in seiner eigenen Geschichte gefangen?
Gegenkultur in Russland
Nun sind zwei Bücher erschienen, die Russlands scheinbar toxische Passivität hinterfragen: Die Frankfurter Journalistin Norma Schneider zeigt schon am Buchcover, worum es ihr geht: Ein Gitarrero steht auf der Turmspitze der orthodoxen Basilius-Kathedrale vis-à-vis vom Kreml und rockt gegen Putin. So simpel, so klar: »Punk statt Putin« heißt das Buch, »Gegenkultur in Russland« lautet sein Untertitel. In acht fundiert recherchierten, locker geschriebenen Kapiteln geht Schneider der Frage auf den Grund, was Gegenkultur in Russland bedeuten kann. Schon auf den ersten Seiten stellt sie klar, dass ihre Definition weit über den Titel ihres Buches (»Punk«) hinaus geht. Jeder künstlerische Widerstand gegen das autoritäre System ist Teil der Gegen-Kultur. So schließt die Autorin die literarische Hochkultur, Internet-Memes oder kritischen Mainstream-Pop nicht aus. Sie vergisst nicht, darauf hinzuweisen, dass Gegenkultur in der Sowjetunion und später in Russland unter anderen Voraussetzungen geboren wurde als im Westen. Schon vergleichsweise harmloses, bürgerlich-liberales Schriftgut konnte eine längere Verbannung nach Sibirien nach sich ziehen. Auch die unendliche Größe des Landes machte die Herausbildung von vernetzten, subkulturellen Szenen nicht leichter. Dass Punk per se links ist, stellt in Russland auch keine Selbstverständlichkeit dar. Schneider rät dazu, genau auf die Lyrics der Bands zu hören. Wie im Falle von russischem Rap, der absurderweise nach Ansicht mancher Kulturpolitiker nichts mit der afroamerikanischen Kultur zu tun hätte, sondern auf die metrischen Gedichte von Wladimir Majakowski (1893–1930) zurückzuführen sei.
Songs wider den Krieg
In ihrem Hauptkapitel »Von Subkultur, viralen Hits und Liedern gegen den Krieg« geht Schneider dann tiefer in die Materie. Einige Protagonist*innen der Moskauer und Sankt Petersburger Szenen werden vorgestellt. Die Autorin begeht dabei nicht den Fehler, im widerständigen Obskuren zu grundeln, sondern liefert Beispiele von Click-Hits, die über Russlands Grenzen hinaus bekannt sind. Klarerweise spielen hier Musikvideos eine große Rolle. Das beeindruckende, mit Sowjet-Nostalgie spielende Artwork von Shortparis darf dabei genauso wenig fehlen wie eine Textpassage über Angel Ulyanow, der mit augenzwinkernder Homoerotik die Straßenschläger-Subkultur der »Gopniki« aufs Korn nimmt. Generell stellt die martialische Macho-Maskulinität der russländischen Gesellschaft eine brauchbare Angriffsfläche für die porträtierten Künstler*innen dar. IC3PEAK lassen Generäle ihre Körpersäfte austauschen. Und Schulhefte mutieren zu Handgranaten, von Kindersoldaten geworfen. Interessant ist dabei, dass einige der Bands es bislang geschafft haben, an der Zensur vorbeizuschrammen, während andere den Weg ins künstlerische Exil gehen mussten, wie die Gruppe Pornofilmy, die von Europa aus ihre kriegskritischen Musikvideos in die ehemalige Heimat schickt.
In einem Sonderkapitel widmet sich Schneider der queer-feministischen Szene, die spätestens seit Pussy Riot zu einer Säule des Widerstandes wurde. Die Ausdrucksformen reichen hier von Elektro-Punk bis zu Techno. Der Dancefloor als gender-egalitäres Utopia feiert in Russland seine Widergeburt. Umso erschreckender, dass rechtsradikale Subkulturen zu Gehilfen des Repressionsapparates werden, indem sie queere Partys mit Prügelorgien sprengen. Schneiders Fazit ist alles andere als überraschend: »Seien wir ehrlich, es sieht nicht gut aus«, schreibt sie im Schlusskapitel. Der Putinismus hat das Land fest in der Hand. Die Zivilgesellschaft ist schwach und die Subkultur hat zu wenig Power. In Wien und Berlin sind in den letzten Jahren die russischen Künstler-Communities gewachsen und sie werden noch größer werden. Aber wenn alle Oppositionellen in den Westen ausgewandert sind, was dann? Zwangsoptimistisch schließt die Autorin ihr Buch mit dem Satz »Россия будет свободной« – »Russland wird frei sein«.
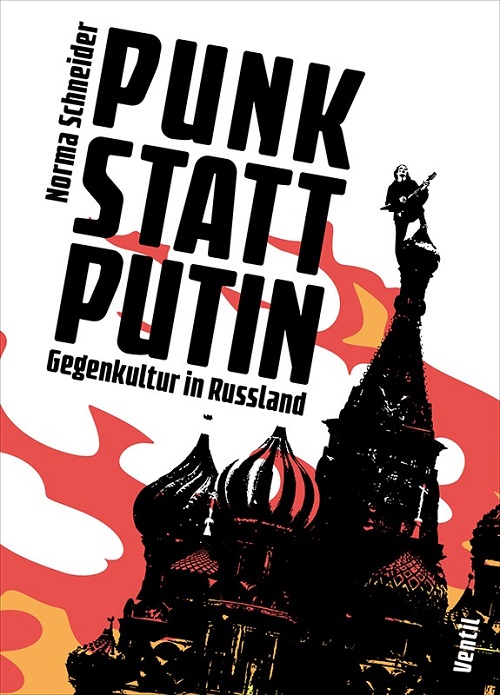
Wie Russlands toxische Gesellschaft tickt
»Selbst wenn Putin geht, bleibt die russische Gesellschaft«, ist das Resümee der Deutschlandfunk-Korrespondent*innen Gesine Dornblüth und Thomas Franke. Anders als Norma Schneider, die den Widerstand in den Ecken ausleuchtet, erkunden die Autor*innen, wie die russische Gesellschaft in ihrer Gesamtheit tickt. Erwartbarerweise gibt es hier viel zu erzählen. Vielleicht manchmal zu viel. Mit den Mitteln der Reportage – es ist anzunehmen, dass einige dieser Texte die Grundlage von Radio-Features waren – verfolgen Dornblüth und Franke die Protagonist*innen ihrer Recherche von den letzten Tagen der Sowjetunion bis in die Putin’sche Gegenwart. Die Kollektivschuld der russischen Apathie ist die Kernthese des Buches. Putin ist das Ergebnis einer Gesellschaft, die es nie schaffte, ein staatsbürgerschaftliches Bewusstsein zu erlangen. Das Machtvakuum, das der seit den 1990er-Jahren formal wahlberechtigte, aber real nicht existierende Volkssouverän hinterließ, war geradezu eine Einladung an die Staatsmafia, den Laden zu übernehmen. Auf die Frage, wie ein Ausweg aus dieser demokratiepolitischen Misere aussehen könnte, kommt man zu ähnlichen Antworten wie andere Russland-Buchautor*innen: Nur der Aufbau einer liberal-demokratischen Elite könnte den brain drain der letzten 20 Jahre stoppen. Eine schonungslose Aufarbeitung der totalitären Sowjet-Vergangenheit sei vorausgesetzt.
Auf 200 Seiten führen uns die Autor*innen durch ein Russland, das an sich selbst und seiner Geschichte scheitert. Dort leben, heißt überleben. Die Beschäftigung mit Demokratiepolitik erscheint vor diesem Hintergrund geradezu luxuriös. In manchen Regionen des weitläufigen Landes gibt es weder Strom noch einen Internetzugang. Die gängige Devise lautet daher: Wir schauen nicht so genau, was ihr da oben macht. Ihr schaut nicht so genau, was wir hier unten machen. Dieser »Deal« zwischen dem Staatsapparat und dem Volk lässt porträtierte Demokratiebewegungen wie »Oborona« oder »Smena« (»Wechsel«) an Grundlegendem scheitern. »Russlands toxische Gesellschaft«, so der Untertitel des Buches, lebt das System »Herr und Knecht« fort. Die Menschen haben die Peitsche internalisiert. Wie man ihr entkommt, ebenso. Der Marathonlauf durch dieses System lässt die Autor*innen an mancher Stelle einknicken. Wollen es die Russen wirklich nicht anders? Die Zahl an Begegnungen, Orten und historischen Details lässt auch die Leser*innen Verschnaufpausen einlegen. Klar, hier wollen zwei zeigen, dass sie ihre Arbeit gut gemacht haben. Haben sie auch. Nur die Wahl der Form hätte der Verlag überdenken können. Etwas Illustration, ein paar Fotos, längere Interviewpassagen, vielleicht eine historische Timeline zur besseren Einordnung der Ereignisse hätten »Jenseits von Putin« gut gestanden.