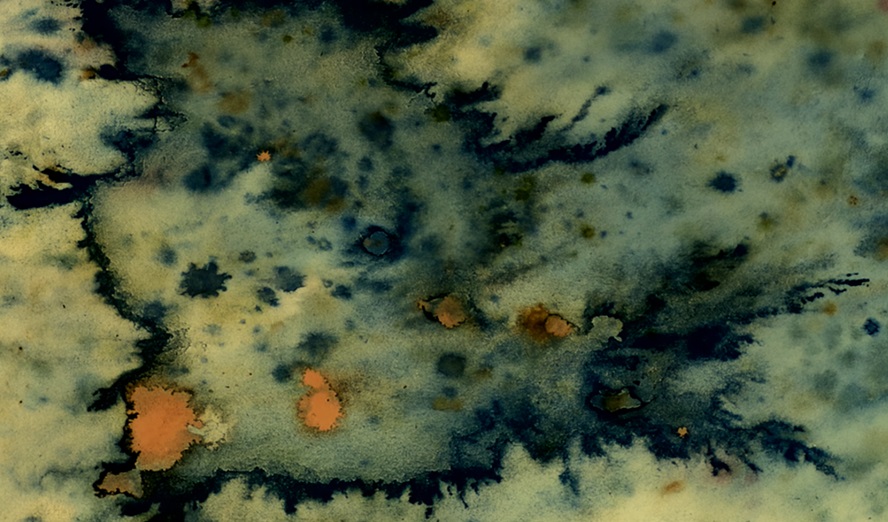Raum und Zeit sind die Bedingungen der Möglichkeit von Vorstellung. Man kann sich einen Raum ohne Inhalt vorstellen, nicht aber Räumliches ohne Raum. Der Raum ist gleichgestellt mit dem Nebeneinander im Ganzen des Kosmos, die Zeit ist gleichgestellt mit dem Nacheinander. Raum ist für den Menschen das Prinzip alles Äußeren, Zeit das Prinzip von Äußerem und Inneren. Die Wirklichkeit der Welt ist die Aktualisierung der Möglichkeit, die Aktualisierung der reinen Vorstellung. Ohne die Möglichkeit ist die Wirklichkeit nicht vorstellbar. Alles was vorstellbar ist, gibt es zumindest als Eigenschaften oder Teile auch notwendig, wirklich und umgekehrt. Zum Beispiel dieses Interview …
Leben wir in einer performativen Gesellschaft?
Konrad-Paul Liessmann: Wir leben in einer Gesellschaft in der Formen der Darstellung und Selbstdarstellung eine hohe Bedeutung gewonnen haben. Was allerdings jetzt auch nicht etwas Neues ist. Die Vorstellung, dass wir alle im Grunde Schauspieler sind, dass wir eine Rolle zu spielen haben, eine Rolle möglichst gut erfüllen müssen, das finden sie ja schon in der Barockzeit, in der barocken Philosophie. Wir erfahren das performative Moment in unserer Gesellschaft deshalb so stark, weil wir vorher, ich denke da vor allem an die 70er, 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, diesen Authentizitäts-Kult hatten. Da musste jeder echt sein, nur das sein was er ist, seine Gefühle rauslassen.
Diese Tendenz, dieser Trend zur Darstellung hat natürlich auch mit der Zunahme der Medien zu tun, die jetzt viel mehr Darstellungsmöglichkeiten offerieren. Früher hatte man nur sich selbst, seinen Körper, seine Sprache, seine Gestik. Heute kann man sich mit Medien ?aufpeppen?, Vorstellungsgespräche fangen mit einer PowerPoint-Präsentation an. Auf der anderen Seite sind die Medien selber neue Orte geworden, wo man sich darstellen kann. Fast jeder hat eine zweite Identität im Internet, wo er natürlich auch eine bestimmte Performance abzuliefern hat.
Wie würden Sie den Begriff Performance deuten?
KPL: Ich sehe ihn einerseits als einen ästhetischen Begriff, beziehe mich da auf die Kunst, auf das Theater. Ich sehe Performance als eine neue Kunstform: eine Mischung aus Tanz, Körperarbeit, theatralischen und skulpturalen Elementen. Dann können wir auch von Performance sprechen, als die Art und Weise, als Power, wie Organisationen, Institutionen und Unternehmen auftreten, auf einem Markt regieren – eine eher metaphorische Verwendung des Begriffes. Und dann als das darstellerische, theatralische Moment, das wir an den Tag legen müssen, um uns selbst zu präsentieren und uns durchzusetzen. Diese drei Ebenen fallen mir auf Anhieb ein.
Oder auch die Performance einer Regierung. Was meint man damit? Dass sie sich gut darstellen kann oder dass sie gut arbeitet. Der Begriff der Performance oszilliert immer zwischen Schein und Wirklichkeit. Er hat eine sehr starke ästhetische Komponente. Eine gute Performance in den Medien zu haben muss nicht heißen, dass man auch als Politiker gut ist. Nur vertrauenswürdig zu erscheinen bedeutet nicht, dass man auch vertrauenswürdig ist. Wir lernen alle unsere Lektionen.
Was kann die Philosophie vom Tanz, was kann der Tanz von der Philosophie lernen?
KPL: Wir haben hier an der Universität Wien einen Kollegen, Arno Böhler, der sich explizit mit dieser Thematik beschäftigt. Er hat jahrelang dazu geforscht, hat eine eigene Gattung Philosophy on Stage installiert, wo er nicht nur theoretisch sondern auch praktisch die Einheit von Philosophie und Tanz, das Denken mit und durch den Körper theatralisch darzustellen versucht.
Ich selber sehe die Verbindung zwischen Tanz und Philosophie eher metaphorisch. Man kann in der Philosophie von einer Denkbewegung sprechen, dass einem Gedanken im Kopf herumtanzen. Umgekehrt drückt sich im Tanz, durch die Körperbewegung, durch die Choreografie etwas aus, das man auch philosophisch benennen kann: Konstellationen, Emotionen, Beziehungen zwischen Menschen, Konfliktsituationen etc. Aber ich würde weder die Philosophie als Tanz, noch den Tanz als Philosophie bezeichnen.
Dann zur philosophischen Deutung von verschiedenen Raumbegriffen: zuerst der Freie Raum …
Der Raum ist philosophisch ein ehrwürdiger Begriff, das muss uns klar sein. Der Raum ist ja auf der einen Seite der erlebbare, ertastbare, begehbare Raum. Der Raum kann vor allem auch wenn er unbegrenzt erscheint auf der einen Seite dieses Symbol der Freiheit sein, auf der anderen Seite auch eine bedrohliche Dimension haben – diese Leere. Jeder Horrorfilm beginnt mit dem leeren Raum, dieses Bedrohliche, das, was man besetzen kann.
Bei Immanuel Kant und seinen Nachfolgern spielt der Raum als Anschauungs- und Vorstellungsform eine ganz große Rolle. Eine Vorstellung, die wir voraussetzen müssen, damit wir die Welt überhaupt wahrnehmen können. Wir können uns keine Welt denken, die wir uns nicht vorstellen können. Das sind jetzt zwei Ebenen, bezogen auf den physikalischen, erfahrbaren Raum.
Wenn man jetzt von den Freien Räumen spricht, kommt die metaphorische, symbolische Ebene dazu. Der Freiraum ist etwas, wo man sich auch geistig bewegen kann. Freiräume sind Räume, wo es gewisse Regeln nicht gibt. Wo bestimmte Regeln zu bestimmten Zeiten außer Kraft gesetzt sind. Freiräume können auch Utopien sein, die in den realen Räumen nicht passieren oder nicht passieren können. Also der Begriff des Freien Raumes lässt eine ganze Reihe von Assoziationen zu.
Möglichkeitsraum?
Der Begriff Möglichkeitsraum ist ja schon eine Form, um Möglichkeiten einzuschränken. Das muss man aber nicht, dank des Möglichkeitssinns des Menschen. Möglichkeiten sind ja noch etwas nicht realisiertes, gleichsam etwas, das noch antizipiert werden kann, was in der Phantasie sein kann, was nur gedacht ist, was nur erahnt sein kann, was Moment oder Resultat eines Durchspielens von Varianten sein kann. Das ist das Entscheidende, dass der Mensch einen Möglichkeitssinn hat, dass er nicht der Wirklichkeit verpflichtet ist. Und der Möglichkeitsraum ist eine Variante dieses Möglichkeitssinns, der sehr stark auf das Räumliche rekurriert. Auf der einen Seite wird ein Raum eröffnet, auf der anderen Seite wird durch das Eröffnen der Raum auch schon wieder begrenzt. Der Möglichkeitsraum deutet schon an: hier kannst du, aber woanders nicht.
Verkaufter Raum – die Stadt, der öffentliche Raum als verkaufter Raum?
Jetzt muss man natürlich aufpassen. Man kann mit verkauften Räumen Räume meinen, die privatisiert werden, die tatsächlich verkauft werden. Man kann damit meinen, dass Raum etwas ist, was man überhaupt nicht kaufen oder verkaufen kann. Da gibt es wenige Areale auf dieser Erde, wo das tatsächlich zutrifft. Zum Beispiel die Antarktis, da hat man sich international geeinigt, dass man sie nicht in Besitz nehmen darf. Ähnliches gilt für den Weltraum, wo es auch internationale Konventionen gibt, dass der Weltraum allen, die die Technologie beherrschen, offen stehen muss. Das gilt in eingeschränktem Maße für die Meeresoberfläche. Es gibt diese Hoheitsgewässer, wo Staaten Besitzansprüche stellen können, wo fremde Fischer nichts zu suchen haben und fremde Kriegsschiffe schon gar nichts zu suchen haben. Soweit ich informiert bin, ist der feste Boden auf dieser Erde entweder im öffentlichen oder privaten Besitz. Und dann kann man prinzipiell die Frage stellen, wann begann die Idee, Raum als Besitz aufzufassen. Das muss irgendwann einmal begonnen haben. Nomaden und Freibeutergesellschaften kannten nicht den Besitz an Grund und Boden. Das muss mit dem Ackerbau eingesetzt haben. Dann gab es verschiedene Formen von Gemeineigentum. Es gibt ja auch heute noch öffentliche Räume wie Parks und dergleichen mehr, die gehören der öffentlichen Hand, uns allen, aber sie gehören jemanden, der Gemeinde, der Stadt, der Republik. Und dann gibt es Privatbesitz an Grund und Boden, an Räumen. Wie jeder Besitz kann der ge- und verkauft werden. Es stellt sich die Frage, wenn etwa etwas im öffentlichen Besitz privatisiert wird, ob das tunlich ist, ob das gestattet ist, ob es im Dienst des Allgemeinwohls ist.
Wenn wir jetzt den Aspekt der Kommerzialisierung hernehmen, die Parzellierung des öffentlichen Raumes und an Unternehmen für Werbeflächen verkauft wird, der als Verkehrsfläche oder als Abstellplatz genutzt war. Wo ein Park war soll ein Parkplatz sein. Das sind Nutzungsveränderungen. Der öffentliche Raum bleibt zwar in öffentlicher Hand, aber wird für bestimmte Zwecke hergegeben, vermietet, verpachtet. Ich nehme an die Gewista macht gute Gewinne mit ihren Plakaten und Infoscreens. Zum anderen ist es auch eine zutiefst kommunalpolitische Frage, darüber nachzudenken, wie man den öffentlichen Raum gestaltet, damit auch sein Charakter als öffentlicher Raum wahrnehmbar bleibt. Es gibt ein ganz interessantes Phänomen in einer Stadt wie Wien, wenn man sie vergleicht mit anderen Großstädten ähnlicher Größenordnung: Wien hat von seiner Stadtarchitektur her keine richtige Platz-Kultur. Was hier Platz heißt, ist entweder ein Park wie der Heldenplatz, ist eine Straße wie der Schwarzenbergplatz. Kein Mensch, der am Schwarzenbergplatz geht, spaziert, fährt käme auf die Idee, dass es ein Platz ist. Oder ist überhaupt ein unwegsames, undurchschaubares Hügelgelände wie der Karlsplatz. Wenn sie in Berlin am Potsdamerplatz stehen oder in Paris am Place de la Condorde oder in Moskau auf dem Roten Platz stehen, dann wissen sie, was ein Platz ist. Dann wissen sie, was in einer Stadt ein Platz ist: ein durch Gebäude geschlossener, öffentlicher Raum, wo sie auch dieses Gefühl des freien Raumes, der Ebene haben und haben müssen. Städte, die diese Plätze haben, müssen natürlich schauen, dass diese Plätze nicht nur mit Parkplätzen zugepflastert werden. Weil der Parkplatz als solcher dieses Gefühl des freien Raumes wieder zurücknimmt. Warum hat man in Wien Plätze, die man ja hatte, als Plätze unmöglich gemacht? Wovor hat eine Politik Angst, wenn sie Angst vor Plätzen hat?
Oder der Rathausplatz, durch den Rathauspark schon mal eingeschränkt, das ist ja ein ?Schluff?. Dann muss da immer ein Event stattfinden. Die Angst vor der Leere eines Platzes ist virulent. In Wien bis zu einem gewissen Grad auch erklärlich, da große Plätze zur politischen Meinungsverführung missbraucht werden können. Die Ambivalenz des leeren Raumes: die Leere ist ja auch bedrohlich, da sie danach schreit, befüllt zu werden und man nie genau weiß, durch wen wird sie jetzt gefüllt. Oder ein leerer Raum in Form eines leeren Gebäudes. Sie kennen den Film ?Shining?. Ein Mann beaufsichtigt alleine mit seiner Familie ein riesiges Gebäude. Er bewegt sich durch unendliche Zimmerfluchten, und die sind alle leer. Allein diese Leere erzeugt dieses Grauen, dieses Alptraumhafte.
Auch dieses Ungewohnte des leeren Raumes erzeugt dieses beängstigende Gefühl …
Das Ungewohnte … wir versuchen natürlich, leere Räume uns vertraut zu machen. Wir suchen leere Räume mit Gegenständen unseres Vertrauens zu füllen, in einer Art und Weise, die nicht mehr funktional ist. So nach dem Motto: Da ist noch ein Eck frei, da kann man noch was hinstellen.
Was spielt Ritual zur Bewältigung des Alltags für eine Rolle?
Der Alltag besteht aus Gewohnheiten. Die Sensation, der Exzess, das Außergewöhnliche, der Urlaub, das Fest, das ist nicht Alltag. Alltag besteht aus Gewohnheiten und Gewohnheiten bekommen einen ritualisierten Charakter. Das Ritualisierte folgt einer bestimmten Vorgabe, einer gewissen Regelhaftigkeit, das ursprünglich eine sehr funktionale Bedeutung hatte. Auch bei religiösen Ritualen lässt sich jedes Opfer, jedes Schlachtritual historisch auf funktionale Dinge, Ereignisse oder Erinnerungen zurückführen und gewinnt dann bis zu einem gewissen Grad eine symbolische Bedeutung. Nicht zuletzt die, dass man mit einem Ritual dem Alltag eine Strukur gibt, einen Raster, an dem man sich festhalten kann. So hat jeder seine kleinen, individuellen Rituale. Wenn diese Rituale verletzt werden, fühlt man sich nicht gut. Wir kennen das. Die meisten Menschen haben bestimmte Aufstehrituale, Frühstücksrituale. Wenn da schon der Nachbar klopft, die Decke durchbrochen wird, irgendwas passiert, was das Ritual stört, ist das schlecht. Auch religiöse, politische Rituale dürfen nicht gestört werden. Man könnte ja auch sagen: Passiert ja nichts, unterbrechen wir kurz diese Rede oder diese heilige Handlung und machen dann später weiter. Nein! Ein Ritual ist deshalb ein Ritual, weil es bis zu einem gewissen Grad auch starr und unflexibel ist. Auch im Sport, der bis zu einem gewissen Grad zu einem Religionsersatz geworden ist, der ist durchsetzt von Ritualen, rituellen Gesten: dem Einmarsch der Mannschaft, Aufstellen der Mannschaft, Abspielen der Hymnen. Rituelle Gesten, die zwar niemand niedergeschrieben hat, die wir im Laufe der Zeit als Gewohnheiten entwickelt, standardisiert und festgelegt haben. Haben natürlich auch den Sinn, Sicherheit zu geben. Sie entheben uns des Problems, wir könnten den Alltag nicht bewerkstelligen, wenn ich in jeder Situation von neuem überlegen müsste, wie tut man das. Höflichkeitsrituale sind eine unglaubliche Erleichterung des Alltags. Ich weiß, wie ich jemanden, den ich nicht kenne aber kennenlerne, wie ich ihn zu begrüßen habe. Da gibt es ein Begrüßungsritual. Die können sich natürlich auch mit der Zeit ändern. Früher ist man einander vorgestellt worden, hat sich vorgestellt und die Hand geschüttelt. Heute greift man in die Tasche und zückt reflexartig eine Visitenkarte. Aber egal, es ist ein Ritual. Ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, ich weiß auch, was ich zu erwarten habe. Ich bin vor ?berraschungen sicher. Ohne diese Sicherheiten, ohne diese Gewohnheiten, ohne diese Verlässlichkeiten wäre der Alltag für uns nicht bewältigbar.