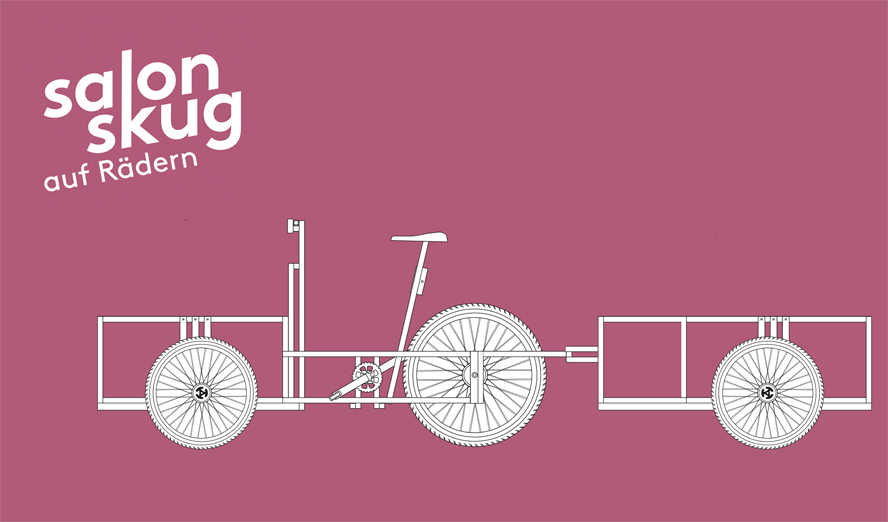Woody Allen ist todkomisch. Er hat ein paar dieser ausgezeichneten Witze gemacht, die mit einem durchs Leben gehen. Scherze, die regelrecht erheben und in schwierigen Situationen ein wenig befreien, wenn man an sie denkt. Er hat wunderschöne Filme geschaffen, die mehr sind als eine Spaßparade. Louis C.K. gilt zu Recht als einer der besten Comedians seiner Generation. »Louis« darf als Goldstandard einer komisch-tragischen Fernsehserie gelten. Beide sind Künstler, die für diejenigen, die neben dem teils lauten und krachigen Scherz eine gewisse – nennen wir es ruhig – existenzielle Tiefe in ihrer Unterhaltung suchen, als echte Empfehlung gelten dürfen. Diese Empfehlung kann aufrecht bleiben, trotz aktueller Erkenntnisse. Das bedarf allerdings einer Begründung.
Der autoritäre Charakter in der Kunstszene
Längst ist Woody Allen mehr wegen seiner ungesühnten Straftaten im Gespräch als aufgrund seiner künstlerischen Errungenschaften. Das hat er sich natürlich selbst zuzuschreiben. Wenn sich nun noch bewahrheiten sollte, was aktuell zu Tage kommt, dass er zumindest davon wusste, dass minderjährige Darstellerinnen am Filmset zum Sex gezwungen wurden, dann ist es jeder und jedem unbenommen, auszuspucken und zu sagen, keinen Meter Film schau ich mir von einem dieser Schweine mehr an. Stimmt schon. Eine nachvollziehbare Reaktion. Ebenso hat der in der US-amerikanischen Comedy-Welt sehr mächtige Louis C.K. Frauen genötigt, ihm beim Onanieren zuzusehen. Louis C.K. bestätigte mittlerweile diese Vorwürfe und gab sich zerknirscht. Er habe damals nicht richtig eingeschätzt, dass diese Frauen in ihren Karrieren von ihm abhängig waren und deswegen in seine Gewalt gerieten. Die ganze Institution der »Besetzungscouch« kocht gerade wieder hoch und Jahrzehnte nachdem Kenneth Anger dies ausführlich beschrieben und Julie Delpy sich mit dem Hinweis auf die Couch um einen Gutteil ihrer Karriere in den Staaten gebracht hat, wollen auf einmal viele von diesem Zusammenhang nichts gewusst haben. Wenig glaubwürdig.
Was hier immer stärker aufgedeckt wird (und dies ist in gewisser, trauriger Weise zu begrüßen), ist das Wirken eines autoritären Charakters in unserer Gesellschaft. Der wirkt dort umso stärker, wo sich Geld und Macht akkumulieren. Bedauerlicherweise unterwerfen sich auch die meisten KünstlerInnen im Kampf um (symbolisches) Kapital dieser Logik. Der Boulevard zeigt sich hier völlig überfordert, wenn er schmierig von »Sex-Skandalen« spricht. Mit Sexualität hat dies wenig zu tun, es geht den, fast immer männlichen, Akteuren darum, Schwächere zu erniedrigen, zu unterdrücken und zu missbrauchen. Daran haben sie ihre Lust. Gerade bricht die Eiterblase in Hollywood auf, in Rock und Pop sieht es aber nicht viel besser aus. Im Grunde müssten Berichte über Iggy Pop, David Bowie, Pete Townsend und noch vieler anderer mit dem Hinweis versehen werden, dass wir beim Diskutieren ihrer Werke sehr wohl wissen, welcher Straftaten sie sich schuldig gemacht haben.
Bigger than Life
Wie gesagt ist ein »nein, das war’s« angesichts all dieser Vorfälle gut nachvollziehbar. Es ist auch schwer erträglich, zu wissen, dass die Opfer der Gewalt oftmals als »gescheitert« gelten, seelisch krank werden und sich zuweilen sogar das Leben nehmen, während die Täter weiter abgefeiert werden. Erschwerend kommt aktuell bei Woody Allen und Louis C.K. hinzu, dass diese ihre ganze Laufbahn über mehr oder weniger nur eine einzige Figur gespielt haben: sich selbst. Woody Allen hat eine ganze Anzahl köstlicher Scherze darüber gemacht, dass er sein eigenes Leben in die Erzählung seines Lebens verwandelt. Und Louis C.K. spielt in seiner Serie »Louis« einen unglücklichen, geschiedenen New Yorker Witzeerzähler, der Vater zweier Töchter ist – wie auch in seiner außerfilmischen Realität. Und hier kommt der Unterschied: In keinem ihrer Werke propagieren sie die Gewalt gegen Frauen oder Kinder. Sie wussten sehr wohl, wie wenig komisch dies gewesen wäre und wie wenig unterhaltsam. Beide haben eben nur jene Teile ihres Lebens ausgestaltet und satirisch, künstlerisch übersteigert, von denen sie ahnten, dass diese, wenn auch zuweilen gewagt, so eben doch moralisch vertretbar sind. Die sich darin zeigende Spaltung zwischen Werk und Künstler ist menschlich gesehen eine Schande und macht ihre Schöpfer zu ziemlich miesen Zeitgenossen, nur hat aber eben auch der ein Kunstwerk nicht verstanden, der glaubt, er begegne darin dem Künstler oder der Künstlerin in der simplen Realität seines oder ihres Daseins.
Wer das Glück – heute müssen wir wohl eher sagen Pech – hatte, mit einem der beiden Stars einmal auf ein Bier oder auf einen Happen Essen gegangen zu sein, der wird ganz sicherlich die Beobachtung gemacht haben, dass diese Begegnung nicht so vollendet komponiert, durchwegs lustig und geistreich verlaufen ist wie etwa die legendären Gespräche im Dinner in der Serie »Louis« oder die Dialoge Woody Allens mit Diane Keaton als Allens Filme ihre künstlerische Höchstform erreichten. Die beiden Herren waren im Alltag wohl auch nur so Typen, die mal wacher, mal abgespannter einem Gespräch gefolgt sind, und vielleicht waren sie manchmal richtig langweilig. Der Umkehrschluss macht hier sicher: Keiner der beiden hätte je einen Film gedreht, wenn es in diesem um einen gelangweilten, müden Comedian gegangen wäre, der irgendwann die Frau an seinem Tisch zu betatschen beginnt und sie später zu Dingen zwingt, die ihn ins Gefängnis bringen müssten. In einfachster Auslegung darf gesagt werden: So ist das eben mit der Kunst, sie greift zwar aus dem (eigenen) Leben, aber überhöht dieses. Macht es besser in dem Sinne, dass es klarer, verständlicher, strukturierter, größer und schöner wird. Auch wenn sich KünstlerInnen darin schonungslos in ihren Schwächen bespiegeln, tun sie das aber eben so, dass die Niedrigkeiten ihrer Person trotzdem künstlerisch überhöht werden. Niedrigkeit als Niedrigkeit ist keine Kunst, sondern Scheiße.
Kunst und Würde
Ja, ein Kunstwerk ist ein schöner Schein. Und dieser Schein ist erhebend, kann menschlich erweitern, befreien und zu Sichtweisen einladen, die selbst aus dem Alltag zu filtrieren entweder kaum möglich ist oder wiederum eigene künstlerische Fähigkeiten voraussetzen würde. Louis C.K. ist dies beispielsweise in seiner 2016er-Serie »Horace and Pete« vorzüglich gelungen, in der er einmal nicht einen Comedian spielt, sondern einen Barbesitzer, der einer sich immer mehr zum Schlechten wandelnden Gesellschaft letztlich tragisch unterliegt. Ein Stück Fernsehen voll Humanität und Anteilnahme für Schwache und Außenseiter, voll Witz und kreativer Gestaltung, das seinesgleichen sucht – dies kann genossen werden (für die oder den, der will), auch im Wissen darum, dass der Schöpfer der Serie Louis C.K. ein widerwärtiger Gewalttäter ist.
Die bürgerlich verblödete Frage, ob Werke der beiden Künstler (und vieler anderer, wie etwa Kevin Spacey und Dustin Hoffman) noch weiterhin betrachtet werden »dürfen«, ist ästhetisch-moralisch unter dem Niveau von skug-LeserInnen. Klar darf man das. Es ist legitim, Kunstwerke als Kunstwerke zu rezipieren, genauso wie es legitim ist, die DVDs in die Tonne zu stopfen, weil man – aus gutem Grund – ihre Produzenten mittlerweile einfach für viel zu ekelerregend hält. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Sollen die Gewalttäter bestraft werden und soll das von ihnen gestützte verbrecherische Unterdrückungssystem aufgelöst und folglich auf zahlreiche möglicherweise hochwertige Produktionen verzichtet werden? Teufel, ja, unbedingt! Die Unversehrtheit und Würde eines menschlichen Lebens wiegt kein Kunstwerk auf, das spürt, außer vielleicht einer Handvoll nietzscheanischer Snobs, jeder Mensch. Sollen mit den Tätern aber auch ihre Werke verbannt werden? Nein. Denn an dieser Stelle hat die Kunst ihre Freiheit. Kunst und Realität ist nicht eins. Kunst ist frei und mehrdeutig. KünstlerInnen, denen es gelingt, auf dieser Grundlage zu kreieren, schaffen etwas, das für sich selbst stehen kann und muss. Die Rückbeziehung auf die vermeintliche Identität mit dem Täter, der die Kunst schuf, ist unsinnig und totalitär. Deswegen ist es auch sinnvoll, die Kunst jener Täter gerade in jenem Moment zu loben, in dem diese – hoffentlich – die Bühne für immer verlassen oder es schaffen, sich glaubwürdig tiefgehend zu ändern.
Eine der besten Szenen aus »Horace and Pete« ohne den Arsch C.K. auf YouTube.com