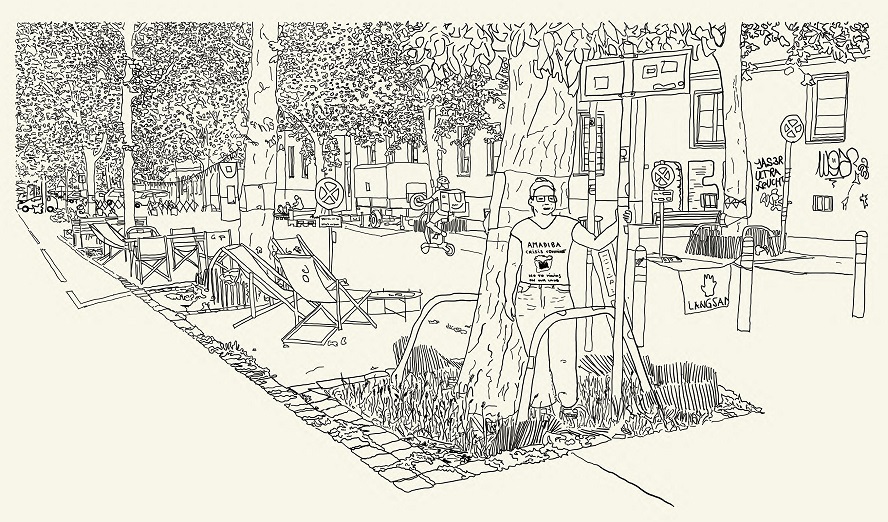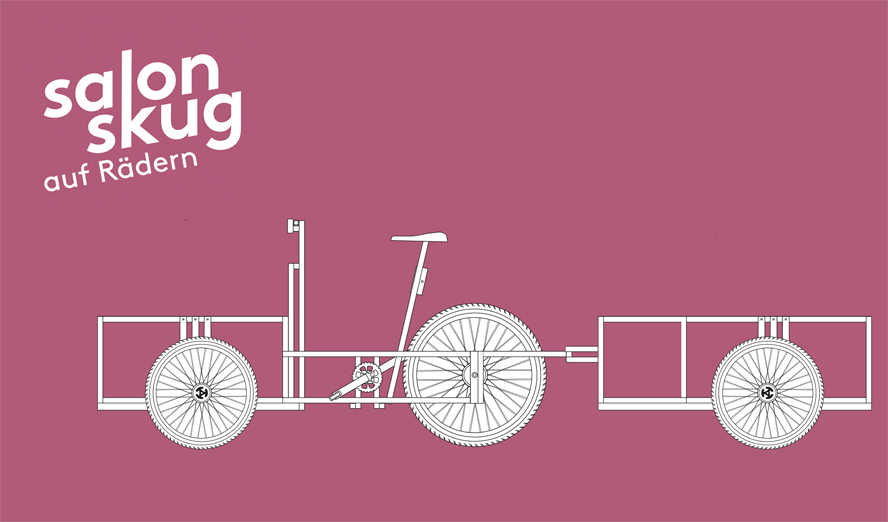Die journalistische Methode der »Liveticker« bringt sicher eine Gleichzeitigkeit von kollektivem Erleben, wie in einem Kommentar stand, was sie aber vor allem bietet, ist eine Bilderproduktion in einem Medium, das ansonsten eher textlastig angelegt ist. Liveticker sind aber derzeit noch oft unausgereift, was die dazu gehörige Textproduktion betrifft. Abgesehen davon, dass »wir psychotechnologisch verbunden sind«, wenn in Medien über Kriege, Katastrophen oder gewalttätige Auseinandersetzungen berichtet wird, »während wir geopolitisch weit voneinander entfernt sind«, wie Hal Forster in dem Buch »The Return of the Real. The Avant-Garde of the End of the Century« schreibt.
Der Abgrund in der medialen Präsentation zeigte sich in der zeitgleichen Präsentation von Filmen über das brutale Vorgehen der Polizei in Istanbul im Online-Newsroom einer Tageszeitung und, auf der anderen Seite, Print-Kommentaren, die bereits nicht mehr aktuell waren. Dazwischen klaffte eine gewaltige Lücke, die aber indirekt die große Bandbreite an journalistischen Möglichkeiten aufzeigte. Die als »Galerie« publizierten Istanbul-Fotos ließen die LeserInnen sprachlich allein – der Wucht der starken Bilder wurde nichts entgegengestellt. Zum Teil wollten die PosterInnen dann auch Erklärungen zu den schrecklichen Vorfällen auf den Fotos erhalten.

Foto: Internet
Distanz mittels Bilderklärung
Dabei könnten Texte eine Fülle an sprachlichen Bildern bringen und hätten eine wichtige Funktion. Der »Literaturkritiker« Walter Benjamin meinte, in den »Metaphern«, Wort-Bildern in Texten, werden Fragmente aus der Vergangenheit geholt und Bruchstücke geborgen. Sprachliche Bilder sind auch für den Journalismus wichtig. Denn beschriebene Bilder lassen Assoziationen offen, bewirken Platz und Raum im Kopf, eine Qualität, die reale Fotos nicht immer haben. Sie zeigen Distanz auf, die ein Fotograf im Getümmel nicht hat. Liveticker bringen derzeit Fotos, ohne diese in Frage zu stellen oder zu begleiten.  Siehe zum Beispiel das Ûbergewicht medial veröffentlichter Bilder zu der kleinen Gruppe von fünf Molotowcocktails werfenden Männern in Istanbul, die von vielen Demonstranten als Provokateure – egal welcher Herkunft oder Beruf – eingeschätzt wurden. Solche Bilder können politisches Handeln beeinflussen und gingen der Räumung des Taksim-Platzes voraus. Sie wurden von vielen Medien unhinterfragt aufgenommen und direkt den LeserInnen weiter gegeben.
Siehe zum Beispiel das Ûbergewicht medial veröffentlichter Bilder zu der kleinen Gruppe von fünf Molotowcocktails werfenden Männern in Istanbul, die von vielen Demonstranten als Provokateure – egal welcher Herkunft oder Beruf – eingeschätzt wurden. Solche Bilder können politisches Handeln beeinflussen und gingen der Räumung des Taksim-Platzes voraus. Sie wurden von vielen Medien unhinterfragt aufgenommen und direkt den LeserInnen weiter gegeben.
Liveticker sollten »ticklen«, sprich Leserinteresse hervor kitzeln, aber auch zum »tackeln« aufrufen, also sprachlich zu handeln und nicht nur bildmäßig zu reagieren. Bilder wirken ganz anders als Texte oder Sprache, besonders wenn es um gewalttätige Konflikte oder Krieg geht. Sie fahren viel mehr ein. Deswegen zeigten die Künstler Maja Bajevic und Emanuel Licha in ihrem Film »Green, green Grass of Home« (2002) über den Krieg in Sarajevo nur eine grüne Wiese, auf der das verloren gegangene Zuhause stand, und wählten allein die akustische Erzählung als mediales Mittel.
Es könnte sich um Provokateure handeln, die das Erdogan-Regime einschleuste, um einen Grund zu haben, die friedliche Demonstration mit Gewalt aufzulösen. Nachweisen kann man es ja wohl nicht, wegen der Vermummung und weil die Demonstranten zwar medial hochgerüstet sind, nicht jedoch staatspolizeilich, um herauszufinden, welche Person den Molotowcocktail warf.
Foto: Internet