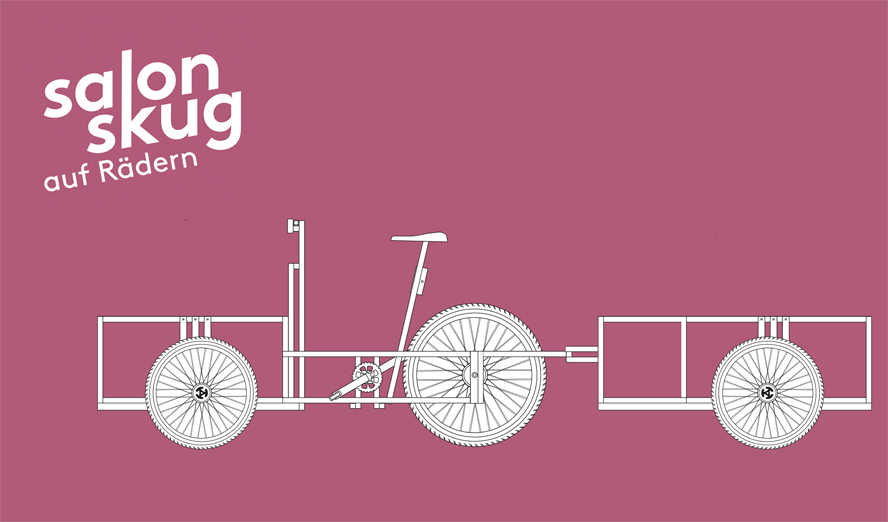»Ich sitze jeden Tag in meinem Sessel und ich blicke aus dem Fenster«, sagt der ältere Herr im Rollstuhl, der gerade mit dem Flugzeug aus New York gelandet ist und versucht, einer Fremden seinen Alltag zu vermitteln. »Ich blicke aus dem Fenster und die Straße ist sehr interessant, weil gegenüber ist ein Haus und das wird immer an jemand anderen vermietet. Meistens Studenten.« Kurt L., 89 Jahre alt, Doktor der Medizin und ehemaliger Herzspezialist, spricht Deutsch wie ein Zehnjähriger, denn der Wiener musste als Schulbub vor den Nazis flüchten. Sein Deutsch klingt »vergangen« und wie Lyrik, und das nicht nur durch in der Zwischenzeit »gestorbene« Wörter. Auch die deklamatorische Sprechweise und die Betonung erzeugen diesen Eindruck. »Ich sitze jeden Tag in meinem Sessel und ich blicke aus dem Fenster«, sagt L. noch einmal laut und es klingt wie der Anfang eines Gedichts. Mühsam ist es, ihm die schwarzen, klobigen orthopädischen Schuhe anzuziehen, die wie kleine Berge aussehen. Da das Schuhlöffel-Prinzip nicht funktioniert, hilft nur ein Kletzeln der eingedrückten Schuhränder in die Höhe. »Ausgezeichnet!« ruft er und betrachtet seine Schuhe wie Kunstwerke, als seine Füße endlich in den »Trümmern« stecken. »Er betrachtet die Welt nur noch durch das Fenster«, schreibt eine Freundin, die Kurt L. seit ihrer Jugendzeit aus New York kennt. »Selbst bei seinem ehemaligen Wiener Wohnhaus will er nur von außen durch die Fenster hineinsehen. Er will nicht einmal hineingehen.«
Der gelbe Bierwagen
»Diese Studenten sitzen an der Ecke in der Nacht«, sagt Herr L., der alte Österreicher in New York. »Ich habe jetzt ein Buch gelesen über die New Yorker Polizei. Ein Polizist wurde verhaftet, weil er so viel Geld genommen hat. Es ist irgendwie herausgekommen, aber ich weiß nicht wie. Ich sitze beim Fenster den ganzen Tag. Ich lese die Zeitung ›New Yorker‹, dann schlafe ich ein. Wir haben eine Bedienerin, ein Fräulein, die serviert mir Lunch.« Als wir aus dem Wiener Hotel hinaus über den Platz mit dem Springbrunnen gehen, bleibt er plötzlich tief in Gedanken versunken mit seinem Gehwagerl mitten auf der Straße stehen. Ein gelber Ottakringer Bierwagen. Er schaut ihn an wie ein Alien. Der hellgelbe Wagen mit der seitlichen Aufschrift »Ottakringer Brauerei« leuchtet in der Sonne. »Mein Vater war Rechtsanwalt und verteidigte die jüdische Familie, der die Ottakringer Brauerei gehörte*«, erklärt er später in der Konditorei Oberlaa. »Aber ich weiß nicht, wie es ausging. Mein Vater präparierte für Polen, Rumänen und Serben gewisse Dokumente. Er vertrat verschiedene Schreibfeder-Firmen. Sein Büro war nicht weit von hier, in der Dorotheergasse.« Dann bleibt der Bissen Marillenknödel auf halben Weg in der Luft hängen und Kurt L. starrt in eine Richtung: Der gelbe Bierwagen biegt gerade um die Ecke. Vorher habe ich im ersten Wiener Bezirk noch nie einen Ottakringer Lastwagen gesehen. Irgendwie scheint er uns zu verfolgen. »Die frühere Sekretärin meines Vaters hat dann bei den Nazis gearbeitet und alles mit der Schreibmaschine aufgeschrieben. Sie bat ihn, zurückzukommen, sie würde ihm seine Kunden zurückgeben, aber mein Vater wollte das nicht tun.«

Kurt L. als Bub. Foto: Familie L.
Tiergarten Schönbrunn
Seine Mutter starb in Amerika schon mit fünfzig Lebensjahren. Woran, ist nicht herauszukriegen. »Man hat sie bald erledigt«, sagt er. Und: »Mein Vater hat sie zu einem Arzt genommen, der hat sie getötet.« Auf den Einwand, dass ein Arzt ja die Trauma-Schäden einer Person oft nicht kenne, meint er, dass er als Herzspezialist selbst einige Patienten »gerettet, andere aber getötet« habe. Ursprünglich wollte er nicht in Amerika bleiben, es gefiel ihm überhaupt nicht. Aber sein älterer Bruder wollte absolut nicht zurück. »In Wien legt man einen Toten auf den anderen«, sagt er über das Grab seiner Großeltern Gusta und Solomon L., gestorben im Jahre 1934 bzw. 1936, die im jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofes liegen. Dann macht er mir ein Stegreif-Gedicht über den Zoo in Schönbrunn, in dem ihn seine Tochter mit dem Rollstuhl herumkutschierte, bis sie wehe Arme bekam: »Sie öffnen die Türe mit dem Schnabel – die Adler. Die halten sich mit einem Arm und rutschen von einem Baum auf den anderen – die Affen am Baum. Die Giraffen haben einen sehr langen Hals und stehen sehr hoch.« Es folgt wie ein Anflug der seltsame Satz: »Ich war schon in Israel. Ich war schon in sehr vielen Ländern und habe dort gar keine Fenster gesehen.« Er hatte wohl keine Zeit, aus dem Fenster zu »blicken«.
Sonnenhut vom Riesenrad
Im Wiener Wurstelprater amüsiert sich Herr L. prächtig. Er winkt seiner Enkelin zu, die wilde Fahrten wagt. Im Riesenrad-Shop kauft er sich einen Sonnenhut und trägt ihn fröhlich. Im Schweizer Haus futtert er voll Genuss ein Wiener Schnitzel und schaut zu, wie der Wind den Sonnenschirm davonträgt. Dann liest er auf dem Parkplatz an der Hauptallee ein sehr schwieriges und langes Gedicht der Auschwitz-Ûberlebenden Ruth Klüger aus ihrem Buch »Zerreißproben« vor. Seine Enkelin filmt ihn, ohne irgendein Wort Deutsch zu verstehen. Kurt L. hat nach wie vor eine sehr nahe Beziehung zu Wörtern. Zur Satzmelodie. Niemand aus seiner Familie spricht Deutsch, es hat sich trotzdem in seinem Inneren eine Sprachinsel erhalten. Er muss ein sehr wortgewandter Zehnjähriger gewesen sein. Und gute LehrerInnen gehabt haben. Im Wien der 1930er-Jahre, in dem schon 1933 arme Kinder aus Heiligenstadt stachelige Kastanien nach jüdischen Kindern aus Döbling warfen.
Erstes Gedicht:
»Ist das Heimweh?«
(in Memoriam Dorrit Cohn)
Zwei Professorinnen
reiferen Alters
erinnerungssüchtig mit verdrängtem Ortssinn
verwechseln im Volksgarten den Standort der Statuen
(den Grillparzer und die Sisi, ich bitt’ Sie!)
stehn horchend in der kitzelnden Stille der Durchhäuser
und wie angenagelt bei der steinernen Mythologie vor der Burg.
Bestellen mit schlechtem Gewissen Kastanienreis.
Am Akzent erkennbar als Einheimische,
aber am Ausdruck erkennbar als Fremde,
kommen sie bei schnellgesprochenem Nestroy gerade noch mit,
finden sie das Kopfsteinpflaster der Innenstadt
zu hart für die Damenschuhe von drüben,
treten sie in zu dünnen Mänteln
nach Museumsbesuch aus der Berggasse 19,
laufen sie mit roten Ohren und Nasen
gegen den schneidenden Wind im April.
Zweites Gedicht:
»Esterhazypark«
Auf verlassenem Spielplatz wirbelt der Sand.
Balken torkeln.
Sengende Sonne über den Schaukeln
blendet: blinde
Stadt, die ein Kind
sandigen Auges verbannte,
Menschenleere:
was soll mir dieser Wind
von einem anderen Meer?
Ruth Klüger: »Zerreißproben« (Paul Zsolnay Verlag, Wien 2013, dtv 2016)
* Anm.: Familie Kuffner