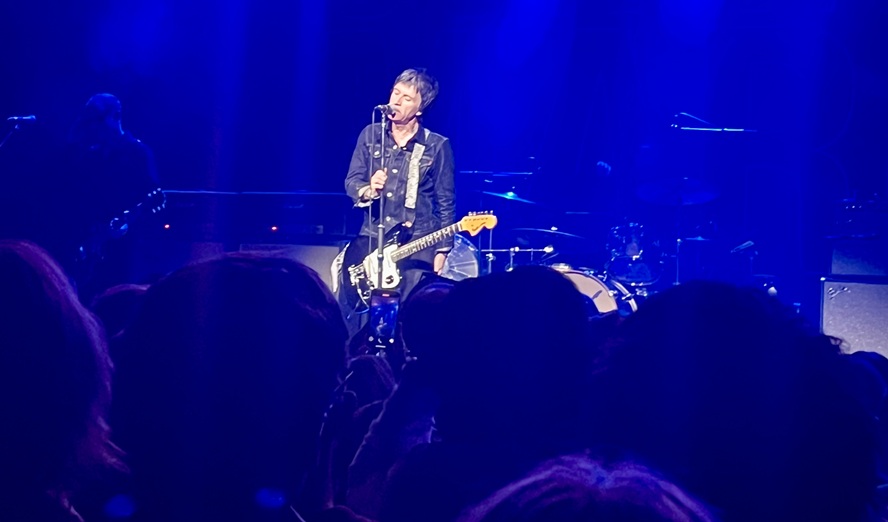In der Höranleitung zum aktuellen Bohren-Opus »Geisterfaust« ist neben allerlei abgehobenem Eso-Geschawafel und Konzeptionellem auch vom seditativen, psychomotorisch stabilisierenden Effekt langsamer Musik die Rede. Dieser soll zu den verlässlichsten Fakten der musiktherapeutischen Praxis gehören. Nach 80 Minuten bohrender Langsamkeit, versunken in einen kuscheligen Polstersitz, wird dieser »stabilisierende Effekt« plausibler. Manche haben sich am Ende so stabil festgeknotzt, dass sie von ihren Sitznachbarn sanft geweckt werden müssen. Der Kuppelsaal des Planetariums ist für die Veranstaltung von »Fluc im Exil« perfekt: Schon im Eingangsbereich ist nichts vom sonst oft penetranten Merchandisinggetue, nicht einmal Minimalgastronomie gegen die Mundtrockenheit gibt es. Das Ambiente entspricht eher einer wissenschaftlichen Vortragsreihe, als einem U-Musik-Konzert (am Beispiel von Bohren ließe sich übrigens trefflich die obsolete strikte Trennung von E und U diskutieren, der mit Sicherheit andere Kriterien zu Grunde liegen als die Materialästhetik der Musik). Im Saal funkelt hoch über den Erdlingen das Firmament – ein kosmisch-akustisches Schauspiel, bei dem die Band unsichtbar bleibt, um nicht von der Konzentration auf den reinen Klang abzulenken.
Natürlich sind Bohren mit ihren Metal-Wurzeln und ihrem jetzigen Doom-Jazz (Eigendefinition) nur mehr peripher Popmusik, und adäquat eröffnet ein Redner der Band den Abend launig mit einer Einführung über den weiteren Verlauf der »therapeutischen Sitzung«. Schrullig – wie die Mitglieder des Club of Gore scheinbar sind – bleibt dabei die geplante Zugabe nicht unerwähnt. Es folgen bis aufs Gerüst abgemagerte Kompositionen aus der jüngeren Vergangenheit der Bohren-Produktion, deren Sensationen sich eher in der Stille, als im Hörbaren ereignen. »Bohren werfen den Zuhörer auf den Schrecken der eigenen Vorstellungskraft zurück« steht in den Liner Notes zum »Black Earth«-Album. Dieser Effekt ist sicher von der Band erwünscht, hängt dann aber doch stark von der Bereitschaft der Zuhörer ab, sich auf das Experiment einzulassen. Die oft bemühten Bladerunner/David Lynch/Badalamenti-Vergleiche sind nicht ganz verkehrt, werden aber auch durch ein ausgeklügeltes Cover-Art-Konzept der Band unterstützt.
Was wirklich zu hören ist, ist nicht unbedingt düster oder bedrohlich, sondern hauptsächlich slow-slower-slowest! Diese Nicht-Synchronizität mit der Geschwindigkeit unseres Alltagserlebens kann Unbehagen evozieren. Mit jedem lang hinausgezögerten Anschlag eines bassdominierten Grundakkords kann der geneigte Hörer eine Mikro-Katharsis erleben. Dieser Mechanismus erklärt eventuell ansatzweise den therapeutischen Effekt langsamer Musik. Lose verbunden sind diese Basiskoordinaten durch kaschmirweiche Tupfer aus dem Fender-Rhodes, ein geschliffenes Saxofon jenseits von VOX-Erotik, ein spartanisch eingesetztes Beserl-Schlagzeug, und seltener durch Gitarre und Mellotron. Alles in allem eine eher überraschungsfreie – die Stücke werden exakt eins zu eins wie auf Tonträger interpretiert – aber trotzdem mächtige Performance des Ruhrpott-Quartetts, das seit 1993 wie ein erratischer Block in der Musikszene herumschwimmt, und trotzdem seinen Lebensunterhalt in normalen Zivilberufen bestreiten muss. Aus der Zeit gefallen, jenseits von Gut und Böse.