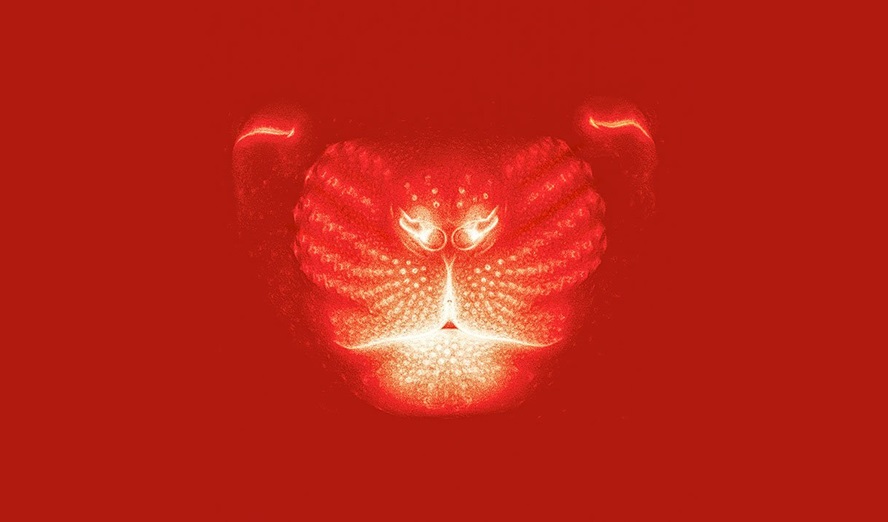Im Gegensatz zum Mythos der sogenannten »Trümmerfrauen« waren die deutschen Gastarbeiter*innen aus Griechenland, Jugoslawien, Italien und der Türkei, die in den 1950er- und 1960er-Jahren angeworben wurden, Realität. Sie trugen maßgeblich zum sogenannten »Wirtschaftswunder« bei, der bitteren Erfolgsgeschichte des Post-Nazi-Deutschlands. Was dabei oft vergessen wird: Zugezogen kamen Menschen, deren Kultur auf die der vormaligen Nazis traf. Bis heute sind die Auswirkungen zu spüren und nur langsam scheint es stellenweise eine Art Normalität zu geben (was auch immer das zu bedeuten hat). Das größte Problem war und ist die deutsche Blut-und-Boden-Ideologie, die Integration anfangs gar nicht erwünschte und deren Erbe diese bis heute erschwert.

Es wurden Arbeiter gerufen, es kamen Menschen
Das erste Abkommen mit der Türkei begann 1961. Der Traum vieler Menschen war eine rosige Zukunft, es erwartete sie jedoch mieser Lohn bei gleichzeitig schwerer Arbeit an den Fließbändern oder unter Tage. Willkommen waren sie bloß als billige Arbeitskräfte. Aus Angst vor Kündigung dauerte es auch lange, bis gewerkschaftliche Strukturen entstanden. Regisseur Cem Kaya zeigt in seiner inhaltlich dichten und arg fesselnden Doku »Aşk, Mark ve Ölüm – Liebe, D-Mark und Tod« ebendiese Hintergründe und Sorgen, die zum Verständnis der Musikkultur unerlässlich sind. Parallel dazu lässt er Protagonist*innen sprechen, Arbeiter*innen ebenso wie Musiker*innen, die noch heute große Verehrung genießen. Songs, die vom Alltagsrassismus erzählen, freche Schmählieder über die dummen Deutschen, die nie auch nur den Anschein erweckten, jemals ein Wort der neuen Sprache zu erlernen, und demnach auch nichts verstanden. Viel Musik, die die Einwanderer*innen aus der Türkei mitgebracht hatten, aber auch kämpferische Lieder, die das Bild des hilflosen Migranten konterkarieren. In diesem Zusammenhang zeigt Kaya beeindruckende Impressionen eines Streiks von türkischen Arbeiter*innen, wie er selten in der Erzählung auftaucht.
Nur wenige Künstler*innen schafften es überhaupt, von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Ein Auftritt des im deutschen Exil lebenden Cem Karaca & die Kanaken in einer von Alfred Biolek moderierten Sendung ist eine überraschende Ausnahme in der deutschen Fernsehlandschaft. Doch was sonst aus den Lautsprechern oder in den Bars der Türk*innen lief, sei es auch Allgemeingut wie Selda oder Ahmet Kaya, wurde bloß mit Kopfschütteln wahrgenommen. Absolut traurig, denn – Vorsicht, Allgemeinplatz – die türkische Musik ist so vielfältig wie lebendig. Neben eher traditionellen Sänger*innen, wie der genannten Selda, gab es eine Welle psychedelischer Musik, wie die von Erkin Koray, Moğollar oder Derdiyoklar, die zum Teil noch bis heute aktiv sind. Doch diese Welt blieb den meisten – bis heute – verborgen und fand nur zu Hause oder in türkisch geführten Clubs statt. Auch einige wenige auf türkische Musik spezialisierte Läden gab es, zum Beispiel in Berlin.

Mit der Wende kam die Wende
Erst mit der Wende wurden die Gastarbeiter*innen und deren Nachkommen dann langsam als »real« und fester Bestandteil Deutschlands wahrgenommen. In der Musik war es besonders der HipHop, allen voran vermutlich Kool Savas, der seinen Teil dazu beitrug, die Lebensrealitäten darzustellen und abzubilden. Auch der finanzielle Erfolg einzelner Künstler*innen dürfte bis heute dazu beigetragen haben. Neben einem Revival des Anatolian Rock mit Vorzeigebands wie den niederländischen Altın Gün, die sich auf eine türkische Tradition berufen, gibt es auch Formationen, die eher klassische, traditionelle Musik auf die Bühne bringen. Allen voran ist da die Hamburgerin Derya Yıldırım mit der Grup Şimşek, die in ihrem Crossover zeitgenössische, aber der Tradition verbundene, wunderschöne Musik fabriziert und mit zum Besten gehört, was musikalisch derzeit überhaupt passiert. All das bildet Kaya in seiner Doku ab. Der Film ist daher eine unfassbar wichtige Nachhilfeeinheit in Sachen deutscher Nachkriegsgeschichte und trägt zum Verständnis des gesellschaftlichen und politischen Status quo, aber auch einer kaum besprochenen musikalischen Parallelwelt bei.
Link: https://www.berlinale.de/de/programm/programm/detail.html?film_id=202208694