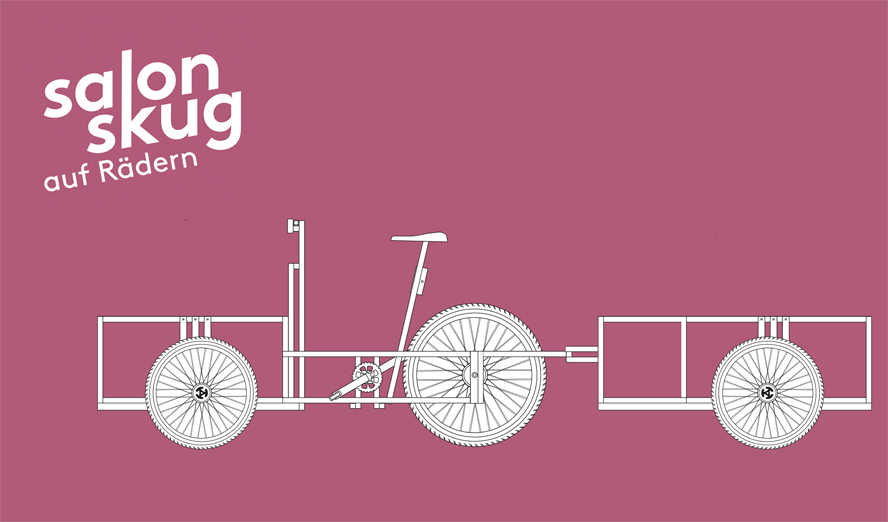Deine Tante war eine unauffällige, unpolitische Frau und Bäuerin, die trotzdem von den Nazis verfolgt wurde, hast du erzählt. Wie kam das?
 Meine Tante hatte eine Tochter zu Hause, die in eine Lungenheilanstalt gehört hätte. Sie pflegte das Kind. Zweimal sind irgendwelche Nazis daher gekommen und meinten, sie soll zur Partei gehen. »Ich habe keine Zeit und verstehe von Politik nichts«, verteidigte sie sich, »und ich will mein Kind nicht allein lassen«. Sie muss ledig gewesen sein, vielleicht war das auch ein Grund. Beim zweiten Mal wollten die Nazis sie überreden, sie solle doch wenigstens zum BDM gehen. »Wenn du nicht gehst, nehmen wir dir die Kinder weg«, drohten die.
Meine Tante hatte eine Tochter zu Hause, die in eine Lungenheilanstalt gehört hätte. Sie pflegte das Kind. Zweimal sind irgendwelche Nazis daher gekommen und meinten, sie soll zur Partei gehen. »Ich habe keine Zeit und verstehe von Politik nichts«, verteidigte sie sich, »und ich will mein Kind nicht allein lassen«. Sie muss ledig gewesen sein, vielleicht war das auch ein Grund. Beim zweiten Mal wollten die Nazis sie überreden, sie solle doch wenigstens zum BDM gehen. »Wenn du nicht gehst, nehmen wir dir die Kinder weg«, drohten die.
Diese Nazis haben ihr dann wirklich die Kinder weggenommen?
Weil sie weder bei der Partei noch beim BDF Mitglied wurde, kamen die eines Tages zurück und wollten ihr die Kinder wegnehmen. Wobei sie dann in die Küche gelaufen ist, ein Küchenmesser holte und ihre Kinder verteidigt hat. Was ihr nichts genutzt hat. Ob sie meine Tante an dem Tag gleich mitgenommen haben oder später, weiß ich nicht.
Und dein Vater erfuhr komplett zufällig vom Tod seiner Schwester?
Mein Vater war Magazinmeister in Bad Gastein, am Bahnhof. Er war verantwortlich für alles, was aus dem Zug aus- und eingeladen und verschickt wurde. Einmal wartete er gerade draußen, als ein sehr langer Zug eingefahren ist. Ganz vorne ist eine alte Frau ausgestiegen, die ist sehr schlecht gegangen. Das Wetter schlug um, es hat genieselt, gegrießelt und der Boden war gefroren. Der Weg war vereist. Mein Vater ist über drei oder vier Gleise beim Verschubbahnhof drüber und bot sich als Begleitung an. Sie hat abgewehrt. Er war ein bisschen ein G’schaftlhuber, hat sich wichtig gemacht. Jeder glaubte, er ist der Bahnhofsvorstand. Als der Bundespräsident Jonas gekommen ist, war er der Erste, der ihm die Hand gegeben hat, der hat gelaubt, er ist der Bürgermeister (lacht).  Mein Vater war der Meinung, er habe die Eisenbahner-Gewerkschaft aufgezogen und habe jedes Recht. Er hat also die alte Frau begleitet und bei der Ûbergabe ihrer Tasche ist ihr Mantelärmel zurück gerutscht und sie stellte ganz erschrocken fest, dass er gesehen hat, dass sie eine Nummer eingraviert hat. Sie war der Meinung, sie muss sich rechtfertigen und mein Vater sagte: »um Gottes willen, es sind so viele Leute zur Wiedergutmachung auf Kur im Radon-Heilstollen in Gastein – ich weiß doch Bescheid.« Im Bahnhof bedankte sie sich Hundertmal. Sie fragte beim Fahrkartenschalter, wie der Mann heißt, der ihr half. Das ist der G.-Sigi, war die Antwort. Sie kaufte in der Trafik ein Packerl Zigaretten und drückte es ihm in die Hand. Und bei der Gelegenheit fragte sie: »Kennen Sie eine Frau namens Maria G.?« Er schüttelte den Kopf und sagte, »meine Frau heißt Maria, aber die werden Sie nicht meinen. »Kennen Sie sonst noch jemanden? Von früher?« Er schüttelt immer mehr den Kopf. »Ganz von früher, haben Sie Geschwister?« »Geschwister habe ich genug« – neun hatte er. »Gibt es da eine Maria?« Er druckste herum und meinte dann, »ja, früher einmal.« Ja, wann früher? Im Krieg.« »Was war da?« »Es hat einmal eine Schwester gegeben, die ist verschwunden, es war Krieg.» »Wissen Sie, was mit ihr passiert ist?« Nach langem Herumdrucksen hat er halt heraus gerückt, dass er nicht weiß, was passiert ist. »Wie hat sie ausgeschaut?« Und er beschrieb sie ungefähr: »Kurze, braune Haare, ovales Gesicht«, er sah ihr vielleicht ähnlich. Auf jeden Fall sagt die alte Frau plötzlich: »Ihre Schwester war mit mir in Auschwitz im gleichen Zimmer, die ist dann und dann ins Gas gegangen.«
Mein Vater war der Meinung, er habe die Eisenbahner-Gewerkschaft aufgezogen und habe jedes Recht. Er hat also die alte Frau begleitet und bei der Ûbergabe ihrer Tasche ist ihr Mantelärmel zurück gerutscht und sie stellte ganz erschrocken fest, dass er gesehen hat, dass sie eine Nummer eingraviert hat. Sie war der Meinung, sie muss sich rechtfertigen und mein Vater sagte: »um Gottes willen, es sind so viele Leute zur Wiedergutmachung auf Kur im Radon-Heilstollen in Gastein – ich weiß doch Bescheid.« Im Bahnhof bedankte sie sich Hundertmal. Sie fragte beim Fahrkartenschalter, wie der Mann heißt, der ihr half. Das ist der G.-Sigi, war die Antwort. Sie kaufte in der Trafik ein Packerl Zigaretten und drückte es ihm in die Hand. Und bei der Gelegenheit fragte sie: »Kennen Sie eine Frau namens Maria G.?« Er schüttelte den Kopf und sagte, »meine Frau heißt Maria, aber die werden Sie nicht meinen. »Kennen Sie sonst noch jemanden? Von früher?« Er schüttelt immer mehr den Kopf. »Ganz von früher, haben Sie Geschwister?« »Geschwister habe ich genug« – neun hatte er. »Gibt es da eine Maria?« Er druckste herum und meinte dann, »ja, früher einmal.« Ja, wann früher? Im Krieg.« »Was war da?« »Es hat einmal eine Schwester gegeben, die ist verschwunden, es war Krieg.» »Wissen Sie, was mit ihr passiert ist?« Nach langem Herumdrucksen hat er halt heraus gerückt, dass er nicht weiß, was passiert ist. »Wie hat sie ausgeschaut?« Und er beschrieb sie ungefähr: »Kurze, braune Haare, ovales Gesicht«, er sah ihr vielleicht ähnlich. Auf jeden Fall sagt die alte Frau plötzlich: »Ihre Schwester war mit mir in Auschwitz im gleichen Zimmer, die ist dann und dann ins Gas gegangen.«
Nach dem, was sie ihm erzählte, war Maria eine ganz, ganz freundliche, hilfsbereite Person, die sich immer um alle gekümmert hat und um sich selber am wenigsten. Sie hat ihm die Todesnachricht gegeben, hat ihm verbal den Partezettel in die Hand gedrückt. Irgendetwas an meinem Vater kann die Frau erinnert haben. Oder seine Schwester hat erzählt, dass zu Hause keiner was weiß von ihr, dass sie dann nicht mehr lebt. Und falls einer überlebt, dass man Bescheid sagen könnte. Oder die haben sich das gegenseitig versprochen. Damit die Verwandten nicht ewig warten.
Hat die Frau ihren Namen gesagt?
Mein Vater wusste ihren Namen nicht, er muss ziemlich schnell abgehauen sein. Wie die Frau heißt, wissen wir nicht. Was in so einem Menschen in so einem Moment vorgeht, das war Trauma genug. Das musst auch erst einmal verarbeiten. Uns hat er es auch nicht gleich erzählt.
Wir Geschwister hörten das nebenbei, einmal, als mehrere Leute am Tisch waren, hat er Worte über den Tod seiner Schwester fallen gelassen. Wir haben wenig geredet. Furchtbar. Unter dem leiden wir alle noch heute. Die jüngste Schwester schaute immer ganz genau, wenn im Fernsehen kurze Ausschnitte von Originalfilmen über das Konzentrationslager Auschwitz gezeigt werden. »Einmal noch meine Schwester sehen«, sagte sie immer.
Was für ein Gefühl ist es für Dich, in Sandleiten zu leben?
Ich habe lange überlegt, wo ich in Wien einmal alt werden will, im 23. Wiener Gemeindebezirk zum Beispiel. Jetzt ist es aber so, dass ich aus dem 16. Bezirk absichtlich nicht mehr wegziehe. Als ich das erste Mal im Sandleitenhof die Rosa-Luxemburg-Gasse und die Liebknecht-Gasse und den Matteotti-Platz gesehen habe, dachte ich mir, wenn in dieser Gegend kein Widerstandsnest war, dann fresse ich einen Besen. Das hat garantiert einen Grund. Den Ottakringer Widerstandskämpfer Paul Vodicka fragte ich bei der Veranstaltung zu seinen Erinnerungen an die Nazi-Zeit: »War in Sandleiten ein Widerstandsnest?« Und er sagte: »Natürlich war in Sandleiten ein Widerstandsnest«. Auf dem Eck, an dem die Waffenabgabe der Nazis war, gehört eine Tafel her. Im Keller von der Bibliothek haben wir in der Nazizeit politisiert. So eine Möglichkeit sollte es heute auch noch irgendwo geben.
Du hattest so eine schöne Mahnmal-Idee für die jüdischen Vertriebenen vom Sandleitenhof.
Ich merke, dass manche Mahnmale die Leute erschrecken und abstoßen oder ihnen auf die Nerven gehen, wenn sie immer an der gleichen Stelle sind. Wenn man will und sich erkundigen möchte, kann man sehen, das ist passiert, so war das, aber man sollte die Erinnerung an die Nazizeit den Leuten nicht aufs Auge drücken und sie dann mit ihrem Schock alleine lassen. Deswegen wollte ich Bäume am Matteotti-Platz haben, in Erinnerung an jeden einzelnen jüdischen Vertriebenen einen Baum.
*Name geändert
In Kooperation mit SOHO IN OTTAKRING