Die Texte des Musikjournalisten Martin Büsser sind wie kleine Schatzkästchen. Hat man den glänzenden Tand (etwa »Oh, ein Interview mit Dave Grohl«, oder »Ah, ein Bericht über Tocotronic«) beiseite geräumt, dann stößt man jedes Mal auf eine kleine oder große, zeitlose Weisheit. »Große Rockmusik ist infantil und pubertär, denn solange Erwachsensein bedeutet, sämtliche Natürlichkeit zu bekämpfen und zu erdrosseln, bleibt Pubertät der einzige Zustand von Menschlichkeit.« Oder diese: »Diese Gesellschaft, die sich verboten hat, frei herauszureden, fürchtet sich so vor dem, was sie Unsinn nennt, dass sie lieber im eisigen Schweigen erstarrt. Ein Schweigen, das wir täglich in den leeren Phrasen der Zeitungen, im Gewäsch von RTL-Serien und auf Partys mitverfolgen können: abgetötete Sprache, der Kadavergeruch von Verstorbenen.« Wo sonst noch findet man solche Sätze in einer Plattenrezension? Ein Hochgenuss sind auch seine glasklaren Analysen, bei denen man sich immer auch ein bisschen ertappt fühlt: »Das Indie-Publikum will MusikerInnen, die süß aussehen, aber auch Pickel haben, will MusikerInnen, die das Leben meistern, aber auch darunter leiden, MusikerInnen, die Liebe brauchen und Liebe geben und immer kurz davor sind, an einem Mangel an Liebe einzugehen.« Also ehrlich, besser könnte man meine Zuneigung zu den frühen Tocotronic kaum beschreiben. Die »Kinderzimmerband«, die »nicht müde wird, vom eigenen Scheitern zu berichten.«
»Mehr als« Musikjournalismus
Die Musikpresse der Gegenwart ergeht sich entweder in Nostalgie (»Good Times«), Schleichwerbung oder Boulevard (»Musikexpress«, »Rolling Stone«). Der Tod von Stars wird hemmungslos für Klicks ausgeschlachtet. Der 2010 verstorbene Martin Büsser war anders. Er formulierte sein Programm als Musikjournalist so: Musikjournalismus könne gelingen als »… Miteinander von selbst Erlebtem (Biographie, History, ein bisschen Exhibitionismus) und Reflexion, als Einzelphänomen Band und deren kulturell-politischem Kontext – all das zusammengedrängt, anstatt die Dinge atomisieren zu lassen. Denn nur mittendrin, im Kern (Core), wo sich die Stränge zusammenfinden, wo sich Helmut Kohl, Irmgard Möller, Michael Jackson, Anselm Kiefer, Jello Biafra, mein Freundin und mein letztes Wochenende mit Franz Schütze die Hand geben – nur da findet das Leben statt. Das Leben fordert ein ›Mehr als‹«.
Ein Glück, dass Jonas Engelmann diese Text-Perlen in dem Buch »Für immer in Pop« gesammelt hat. Engelmann ist ebenfalls profilierter Musikjournalist, aber auch Lektor und Verleger beim hervorragenden Ventil Verlag, der beispielsweise die Bücher von Simon Reynolds auf Deutsch herausbringt. Ich habe Martin Büsser 2006 bei einem Popworkshop kennengelernt. Ein schlanker, ruhiger Typ mit Intellektuellenbrille und selbstgedrehter Zigarette, der ruhig und immer ein bisschen zynisch diskutieren konnte. Keiner, der sich in den Vordergrund drängt. Ich war nicht mit allem einverstanden, was er damals vertreten hat. Das ging mir auch jetzt bei der Lektüre von »Für immer in Pop« so. Aber er war ein Gesprächspartner, der meinen Horizont erweitert hat. Ich hatte Gelegenheit, Jonas Engelmann Fragen zu stellen. Engelmanns Antworten haben meinen Horizont ebenfalls erweitert und mir klar gemacht, dass ich Büsser damals unterschätzt habe.
Ens Oeser: Für jemanden, der keine Ahnung hat: Wer war Martin Büsser?
Jonas Engelmann: Martin Büsser auf einen Nenner zu bringen, ist schwierig, er war ein wichtiger Autor der deutschen Punk- und Hardcore-Szene und gleichzeitig einer ihrer schärfsten Kritiker, er war Poptheoretiker, der sich aber der akademischen Lehre weitestgehend entzogen hat, er hat einen Comic gezeichnet, Musik mit seiner Band Pechsaftha gemacht, Compilations zusammengestellt, die »testcard« und den Ventil Verlag mitgegründet, als Musikjournalist gearbeitet, zahlreiche Bücher über verschiedene Aspekte der Popkultur geschrieben, aber auch über Kunst, Literatur und Film. Und trotz aller Schwierigkeiten, sich als freier Autor und Journalist durchzuschlagen, hat er sich nie zu Kompromissen hinreißen lassen, sondern ist immer kritisch in seinem Denken geblieben – auch auf Kosten einer Professur oder ähnlichem.
Was verbindet Sie mit Martin Büsser?
Ich habe Martin sozusagen dreimal kennengelernt: Zum ersten Mal Anfang der Neunziger als Autor des »ZAP«-Magazins, in dem er mir meinen engen Punk-Horizont geöffnet hat, dann zum zweiten Mal Anfang der Nullerjahre als Praktikant im Ventil Verlag, wo ich ihn als Kollegen kennengelernt habe und viel von ihm darüber gelernt habe, wie man über Musik schreibt bzw. über Musik nachdenkt. Und dann noch einmal ein paar Jahre später, als ich bei Ventil ins Kollektiv eingestiegen bin und er mir spätestens ab dann zum engen Freund wurde. Aus allen Phasen dieser Bekanntschaft bzw. Freundschaft habe ich viel mitgenommen, das mich bis heute prägt und auch bis heute mit Martin verbindet.
Martin Büsser war Journalist und Musiker. Sie haben zwei Bücher mit seinen Texten veröffentlicht. Was ist denn das Alleinstellungsmerkmal an dem Journalisten Martin Büsser?
Martin hat auch in seinen Rezensionen für z. B. »Intro« sein Schreiben nie als Dienstleistung verstanden und seinen Texten einen Mehrwert zu geben versucht, der über den alltäglichen Gebrauch im Wegwerfmagazin hinausgeht. Das ist ihm meistens gelungen; legendär z. B. seine Rezension einer Xavier-Naidoo-CD in der »Intro« Anfang der Nullerjahre, in der er Naidoo in einem Close Reading seiner Texte genau die reaktionäre Gesinnung nachweist, für die er ein Jahrzehnt später berüchtigt war. Martin hat einen Popjournalismus betrieben, der sich zunächst einmal ohne Blick auf eigene Vorteile, Interessen und Geschmack mit dem soziokulturellen Gehalt all dessen auseinandersetzt, was Pop produziert. Also ein Popjournalismus mit Haltung. Gleichzeitig hat Martin immer aber auch nach Musik gesucht, die ihn persönlich begeistert, also doch seinen eigenen Geschmack bedient, und diese Begeisterung dann mit anderen geteilt.
»Für immer in Pop« heißt die neue Textsammlung. Wie hat Martin Büsser denn »Pop« definiert?
Es ist natürlich immer schwierig, die Sache mit den Definitionen, wichtig ist ja vor allem, was Martin an Pop interessiert hat, oder welche Form von Pop ihn interessiert hat, nicht umsonst trägt das von ihm mitgegründete Magazin »testcard« ja den Untertitel »Beiträge zur Popgeschichte«. In einem Artikel hat er mal beschrieben, dass ihn vor allem eine Popkultur interessiert, die sich einerseits nicht als Pop im Sinne ihrer ökonomischen Verwerter als Pop versteht, aber eben auch nicht im Sinne einer Hochkultur. Martin schreibt: »Dass zum Beispiel der Punkband Dead Kennedys zu Beginn der Achtziger als damals vielleicht radikalste Kritik am Reagan-System eine Bedeutung zukommen muss, die mit den künstlerischen Äußerungen von George Grosz und John Heartfield während des Aufkommens des Nationalsozialismus in Deutschland verglichen werden kann, wird nur jenen transparent, die eine Band wie die Dead Kennedys unter Avantgarde-Gesichtspunkten, nicht unter akademisch-musikwissenschaftlichen Gesichtspunkten betrachten.«
Büsser hat zahlreiche Rezensionen geschrieben, er war Plattenkritiker. In dem wunderbaren »testcard«-Heft »Kritik« wird gefragt, von welchem Standort aus man denn überhaupt kritisieren kann. Was war Büssers Standort für Popkritik?
Martin ging es darum, die Auseinandersetzung mit Pop daran zu orientieren, was unter Pop als Avantgarde im Sinne einer irgendwie verstörenden Ästhetik zu einer bestimmten Zeit verstanden wurde und wie sich dies in ein Verhältnis zur Gegenwart setzen lässt. Warum z. B. die Sex Pistols Ende der Siebziger den gesellschaftlichen Status quo in Frage stellen konnten und NOFX das heute, mit ähnlichen musikalischen Mitteln, nicht mehr können. An solchen Fragen hat sich sein Schreiben über Pop orientiert.
Niels Penke sagt: »Pop ist das, was die Beliebtheitslisten anführt, was an der Spitze der Charts steht.« Und der Musikwissenschaftler Ralf von Appen sieht den Standpunkt Büssers ebenfalls kritisch. Er meint, zu Pop gehörten eben auch Modern Talking und Phil Collins. Ist kommerzieller Unterhaltungspop und Castingpop verwerflich? Michel de Certeau oder die britischen Cultural Studies haben ja den Standpunkt, dass es eher darauf ankommt, wozu der Rezipient die Musik gebraucht, und nicht so sehr, was die Absicht der Kulturindustrie war. Kann man auch Castingmusik subversiv hören oder gebrauchen?
Ich denke nicht, dass es lediglich darauf ankommt, was die Rezipienten mit Musik machen, um sie subversiv umzuwerten; eine Schlagerparty im linken JUZ bleibt eine Schlagerparty und ändert auch nichts an der Ästhetik der Musik, was nicht gegen Schlagerpartys im JUZ sprechen muss, aber es bleibt eben einfach eine Party und ist keine subversive Aktion. Einzelne Popphänomene können sicherlich nicht für sich beanspruchen, subversiv zu wirken, aber Popphänomene wie z. B. Glam in den Siebzigern haben sicherlich mehr zur Auflösung starrer Geschlechterrollen beigetragen als Judith Butler – und das eben über Chartspop. Aber da steckte eben auch genau jenes Moment drin, das etwa auch Martin interessant fand an Pop: die Momente, in denen Pop als ästhetische, soziale und diskursive Störung aufgetreten ist.
Der Autor Georg Seeßlen ist ja sehr besorgt wegen der Kolonisierung des Pop von rechts. In den »testcard«-Heften sprechen sie von der »Poplinken«. Martin Büsser hat in seinem Buch »Wie klingt die neue Mitte« bereits auf rechte Tendenzen im Pop hingewiesen. War Büsser damals schon hellsichtig für einen Trend, der sich erst jetzt richtig abzeichnet? Wie sehen Sie das?
Die »testcard« ist ja Mitte der Neunziger entstanden, als es sowas wie die Poplinke noch nennenswert gab, als von »Spex« über »Die Beute« bis eben zur »testcard« viele Poptheoretiker und Popschreiber auf die Hoffnung gesetzt haben, in Pop stecke das Potenzial von Kritik. Davon ist nicht mehr viel geblieben, was verschiedene Gründe hat und hier auszuführen jetzt zu weit führen würde. Klar, heute gibt es eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz von reaktionären bis rechten Inhalten im Pop, gerade auch von Chartskünstlern wie Frei.Wild oder Xavier Naidoo. Aber eben auch die Gesellschaft ist nach rechts gerückt. Das hat sich schon zu Martins Lebzeiten abgezeichnet, der neue Wohlfühlnationalismus von Mia oder Nena war ja schon in den Nullerjahren omnipräsent.
Kann die Poplinke diesem Trend entgegentreten?
»Die Poplinke« gibt es ja nicht mehr und genau das ist Teil des Problems. Pop hat ja als Ort von Utopie, als Vorschein einer irgendwie besseren Welt, wenn auch oft nur so diffus umrissen, für die Poplinke als Identifikationsmoment funktioniert. Wenn die Linke daran nicht mehr glaubt oder sich nicht mehr dafür interessiert, ist Pop nach rechts offen – allerdings noch nicht verloren, würde ich hoffen. Aufgabe der Poplinken wäre es z. B. in der Gegenwart, um Frank Apunkt Schneider zu zitieren, daran zu erinnern, dass Pop – eben gerade weil er der Ausfluss einer selbst wiederum multinational operierenden Kulturindustrie ist – eine ihrem Wesen nach migrantische und heimatlose Kunstform darstellt.
Sie lesen demnächst in Esslingen mit Françoise Cactus Büssers Texte. Welche Verbindung gibt es zwischen meiner ganz persönlichen Heldin Françoise Cactus und Martin Büsser?
Die Idee für die Lesungen in Gedenken an Martin Büsser hängt eng mit der oben gestellten Frage nach der Poplinken zusammen: Ich habe versucht, an verschiedenen Orten verschiedene Protagonisten dieser Poplinken zu Lesungen zu überreden – unter anderen Schorsch Kamerun, Knarf Rellöm, Conny Lösch und Kristof Schreuf, um zum einen daran zu erinnern, dass es das mal gab, einen poplinken Konsens, und zum anderen wieder in die Diskussion zu kommen über den Vorschein einer besseren Welt, den Pop liefern kann.
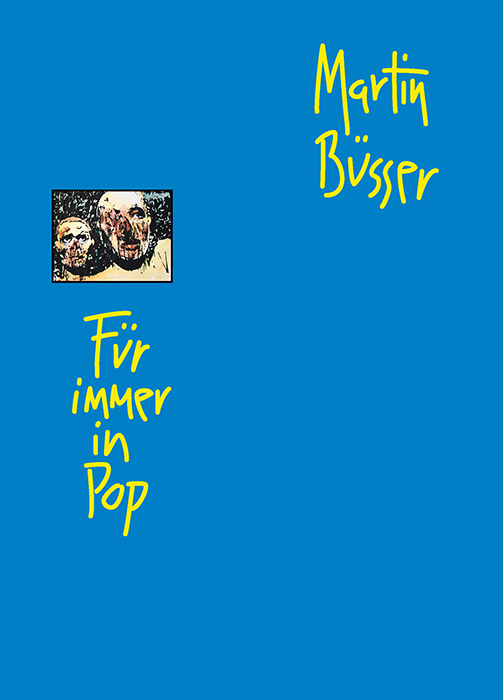
Dieser Text erschien erstmals am 1. August 2018 auf dem Hobbypop Blog.
Link: https://www.ventil-verlag.de/titel/1810/fuer-immer-in-pop



















