»Die Linke und die Kunst« … das kann schon tragische Formen annehmen, sehr nerven, alle Stadien (zwischen Farce und Komödie) von kognitiven Dissonanzen und Double-Double-Binds generieren und trotzdem nie langweilig werden. Zwar mögen sich die Beziehung zwischen Kunst und sagen wir mal dem Werk von Marx immer wieder in eher extremen elliptischen Bahnen abspielen (mal ganz zärtlich nahe, mal unendlich weit entfernt, mal gegenseitig total aufeinander angefressen), aber, und das ist der springende Punkt, Marx definiert Kunst nicht einfach als Hobby (»Ein Hobby vertreibt einem die Zeit, aber es füllt sie nicht aus«, sagt ja auch Norman Bates/Anthony Perkins in Hitchcocks »Psycho«). Da ist schon noch mehr dahinter.
»Revolutionstauglichkeit«
Entgegen idealistischer Darstellungen linker Kunsttheorien (plus ein paar aktueller Updates) geht Jens Kastner zuerst mal von der Frage aus, inwieweit der bildenden Kunst überhaupt eine »Revolutionstauglichkeit« attestiert werden kann. Anders gefragt: Welche Funktion(en) kann bzw. soll »Kunst« überhaupt in Sachen »sozialer und kultureller Gerechtigkeit« und »emanzipatorischer Veränderungen« übernehmen?
Dabei definiert Kastner gleich zu Beginn, was unter einem linken Kunstverständnis (einer linken Kunsttheorie) und unter linker Kunst zu verstehen ist. Nämlich ein (kollektives) Gefüge aus Künstler*innen, sozialen Bewegungen und Theorien/Theoretiker*innen, wobei sich die einzelnen Teile im Idealfall gegenseitig transformieren und auch infrage stellen (die Poplinke sieht Pop bekanntlich auch nicht anders). Andererseits sind viele klassische Forderungen der (linken) Kunst-Avantgarden des 20. Jahrhunderts, wie etwa der Wunsch nach der »Aufhebung der Grenzen zwischen Kunst, Arbeit, Politik und Leben« vor allem unter neoliberal-prekären Verhältnissen (zwischen »Home Office« und »Work-Life-Balance«) zu einem Zwang umgedeutet geworden. Es verwundert daher auch nicht, dass Risse, Dispute und Spaltungen innerhalb linker Kunsttheorien vor allem Fragen nach dem Verhältnis von Kunst und Arbeit und Leben betroffen haben.
Bereits Walter Benjamin stellte die (orthodox) marxistische »Widerspiegelungstheorie« ebenso wie die eines (relativ) »autonomen Kunstwerks« durch die Kritische Theorie infrage. Schon hier diagnostiziert Kastner die Trennung zwischen einer »marxistischen Ästhetik« (die immer noch dem »autonomen Kunstwerk« verpflichtet ist) und einer »marxistischen Kunstsoziologie«, bei der es in Form von »materialistischen Praxistheorien« nun vor allem um »Kontexte« und Produktionsverhältnisse, also um »Prozesse und Praktiken des Umgangs mit Kunst« geht. Hier (und das ist nur einer von vielen quasi »Sub-Plots« des Buches) zeigt sich schön, wieviel von Marx im Poststrukturalismus stecken kann, sofern diese Gefüge nicht gekappt, verschwiegen oder gleich ignoriert werden.

»Entnaturalisierung des Sozialen«
Für Marx steht Kunst für eine »Aneignung von Welt« im Sinne einer »Entnaturalisierung des Sozialen« (mit den Menschen als »Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse«), wodurch »ein Subjekt für diesen Gegenstand« produziert werden soll. Um das Wann dieser »Aneignung von Welt« und die Subjekte »für diesen Gegenstand« dreht sich seitdem aber auch der Disput mit dem Anarchismus (und darum, wer nun jenseits von Bohemia und Lumpenproletariat auch noch »bürgerlich« sei …).
Dessen Losung »We want the world, and we want it now!« (und nicht erst nach der Revolution), war mit Marx nicht wirklich kompatibel. Jedoch sprach Bakunin ausgerechnet in der Auseinandersetzung mit Kunst einen blinden Fleck bei Marx an, als er erkannte, dass ökonomische Veränderungen nicht zwangsläufig zu veränderten »Denkgewohnheiten« führten, dies aber eventuell mittels Kunst möglich wäre. Was bekanntlich auch Lenin erkannte, als er die Kunst Tolstois gegenüber dem Künstler Tolstoi in den höchsten Tönen lobte. Andererseits stellt sich bei Trotzki und Rosa Luxemburg gleich auch eine ganz andere (ebenso grundsätzliche wie ewige) Frage: Wie weit kann »bürgerliche Kunst« überhaupt ein Maßstab für »proletarische Kunst« sein?
»Nicht-Repräsentierbarkeit«
Die Frage nach dem Nutzen bzw. der Funktion von Kunst (durchaus im Sinne dessen, was Marx als »Notwenigkeit« im Gegensatz zur »Nützlichkeit« definiert hat) wird hierbei sowohl bei Adorno (»die bestehende Realität verneinen«) wie bei Marcuse (»prinzipielle Zweckfreiheit«) und Julia Kristeva (»Nicht-Repräsentierbarkeit«) als jene »Eigengesetzlichkeit« gesehen, die nun in der Lage sei, »Denkgewohnheiten« zu verändern. Dass dabei immer wieder auf den Surrealismus (später auch auf Psychedelic) verwiesen wird, liegt auf der Hand.
So besteht die »verborgene Antriebskraft von ›Kunst‹« für Kristeva vor allem darin, Bedingungen für ein permanentes »Anderes-Werden« zu provozieren, indem Wirklichkeit (Wahrnehmung) verändert wird, wozu sich »der moderne Text«, wie Kristeva anmerkt, »jenseits der ›Kunst‹ nieder(lässt).« Als Irritation, Überschreitung, Provokation. Dazu gehört etwa auch die radikale (und dabei auch jeglichen Surrealismus zu überschreiten versuchende) »Nichtanpassung an die Welt«, von der der Situationist Raoul Vaneigem spricht und die in Form des situationistischen »Nichtstuns« sowie Guy Debords berühmter »Technik des Umherschweifens« gleichsam Walter Benjamins Herumflanieren als Blaupause für Punk berühmt gemacht hat.
Nur ist das alles mittlerweile nicht mehr ganz so funky wie dereinst. Diedrich Diederichsen hat schon 2004 in »Eigenblutdoping« darauf hingewiesen, dass eine ultra-situationistische Losung wie »Nie wieder arbeiten« unter prekären Verhältnissen eher eine Androhung ewiger Erwerbslosigkeit als eine freie (»Null Bock«-)Entscheidung ist. Auch dürfte sich der Glamour des Herumschweifens mittlerweile im Abhängen in Shopping Malls bzw. als Social Media-Big-Data-»Spektakel« aufgelöst haben.

Kunstvoller Müßiggang
Als möglichen Ausweg aus diesem Dilemma verweist Kastner auf Maurizio Lazzaratos und dessen von Marcel Duchamps »Schweigen« angeregter Theorie des »faulen Handelns«, welches grundsätzlich gegen jenes rationale Verhalten, »für das der Zweck, nämlich das Geld, alles ist und der Prozess nichts« gerichtet ist. Zwar funktioniert Lazzaros »faules Handeln« nur, wenn (wie bei Duchamp) zuvor nicht nur gehandelt, sondern damit auch ein Image ausgebaut wurde. Interessant wird dieser Ansatz jedoch, weil Mark Fisher bei seinem unvollendeten Entwurf eines »Acid Communism« genau solche, gegen die Lohnarbeit an sich gerichtete Arbeitskämpfe des italienischen Operaismus, die Lazzaro als »Verweigerung der Arbeit« beschreibt, mit Popsongs, die das Lob des gekonnten wie kunstvollen Müßiggangs besingen (»Sunny Afternoon« von The Kinks, »Lazy Sunday« von den Small Faces und »I’m Only Sleeping« der Beatles), in Verbindung bringt.
Pop spielt zwar bei Kastner nicht wirklich eine Rolle, aber es gelingt ihm dennoch, überall dort, wo »Pop« stehen könnte (oder es damit weiter ginge), zumindest Wegweiser aufzustellen (zumal sich spätestens seit den 1960ern die jeweiligen Diskurse sowieso immer wieder überschneiden und durchkreuzen).
Erfahrungen versus Betroffenheiten
Wie ähnlich sich Praktiken von Pop und bildender Kunst sein können, zeigt sich exemplarisch beim Thema »Selbstermächtigung«. Denn auch bei noch so moderner (oder post-moderner) Kunst geht es in der Regel immer noch um Privilegien (solchen, die von Institutionen verliehen werden, und solchen entlang von Race/Gender/Class), die Rollen, Teilhaben, also das Mitspielen (oder eben nur Zuschauen) ordnen (wer mal so richtig in Sachen »Class« eine aufs Maul kriegen will, soll nur mal im Sommer eine x-beliebige Galerie einer x-beliebigen Festspielgroßstadt besuchen).
Von daher ist es ganz klar, dass es nicht nur um die Infragestellung solcher Privilegien gehen kann, sondern es auch darum, diese überhaupt als obsolet für das eigene Feld (und beyond) zu definieren. So gesehen ist der feministische Ansatz von Valie Export, »the history of female experience« als »primary source« der eigenen Kunst zu betrachten, revolutionär in dem Sinn, dass hier ein Bruch mit dem Bisherigen (der bisherigen Kunstgeschichte wie dem Schreiben darüber) stattfindet, wohin dann auch nicht mehr zurückgekehrt werden kann (jedenfalls nicht mehr so easy und ohne Blessuren). Ihr Rekurs auf eine (hidden) »HerStory« erinnert dabei nicht zufälligerweise auch an afro-futuristische Positionen (etwa an Sun Ras »His story is history, but my story is mystery«).
In beiden Fällen geht es um illegitimierte (verachtete und für unwert betrachtete) Praxen als Pool für neues (re-signifiziertes) Handeln. Diese »Erfahrungen« (als das, was Foucault mal »das Unbewusste der Diskurse« genannt hat) müssen dabei jedoch immer als in Strukturen eingebunden und durch Strukturen determiniert vermittelt werden, weil sie sonst nicht »politisch« werden können. Ähnlich argumentieren auch afro-amerikanische Linke wie Cornell West in Abgrenzung zu rechten/konservativen »Erfahrungs«-Narrativen. Es geht also nicht um das Lob eines Selfie-Biographismus, gleichwohl handelt es sich bei »Erfahrung« um eine ambivalenten Kategorie, die als Vereinheitlichung und Essentialisierung (von Erfahrungen) unter Ausblendung sozio-politischer Kontexte auch in identitäre Betroffenheitsgesten kippen kann (wie etwa bei all den Updates der »Selbsterfahrungslinken« zwischen »Trigger Warnings« und »Cancel Culture« zu sehen ist).
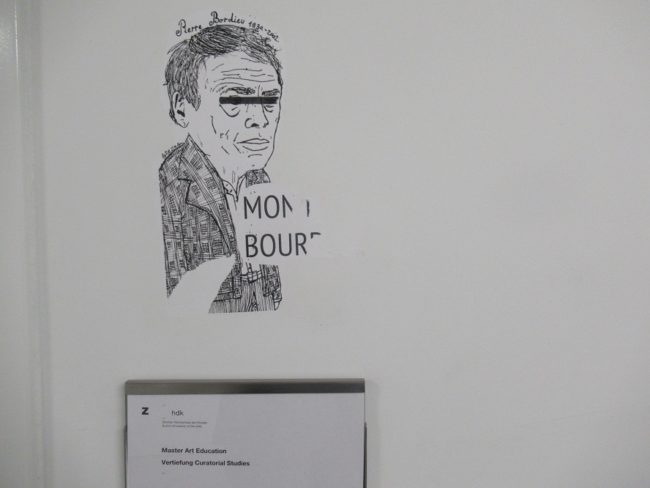
Creative Craftler
Das Kippen linker Kunsttheorien und Praxen nach rechts ist dann auch ein weiterer Sub-Plot, der sich speziell durch jene Kapitel zieht, bei denen es um – grob gesagt – identitätspolitische« Ansätze seit den 1960ern geht. Es mag dabei auch kein Zufall sein, dass die ersten kritischen Debatten um Neoliberalismus und »Creativity« in den 1990ern ausgerechnet bei Kunst-Symposien zu hören waren. Wenn Kastner linke Kunst-Utopien (seit den 1960ern) als »grenzenlos, flexibel, allgegenwärtig, mobil, ohne Unterschied zur Freizeit« definiert, dann klingt das heute wie das idealtypische Jobprofil im Prekariat. Auch Bini Adamczak schreibt in »Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende« (2018) davon, wie »1968« gleichsam im »Zerrspiegel des Neoliberalismus« wiederkehrt (und verkneift sich dabei aus guten Gründen jegliche Häme).
Dabei mutet es schon komisch an, wenn Kastner aufzeigt, wie es im 18. Jahrhundert zur Trennung zwischen »bildender und dekorativer Kunst« als Unterscheidung zwischen männlichen (aktiven, öffentlichen) und weiblichen (passiven, privaten) Tätigkeiten gekommen ist, und wie diese »konstitutiv auf einer geschlechterpolitischen Ausgrenzung« basierende Aufsplitterung unter aktuellen Hipstervorzeichen (und DIY-Baumarkt-Selbsterfahrungspropaganda) umgedeutet wird. Verkehrt sich doch gerade hier die »historisch-patriarchale Arbeitsteilung« von »bildender Kunst als männlicher und Handwerk als weibliche Tätigkeit« in eine Art perverses maskulinistisches Gegenteil, wo »Handwerk« in allen Formen (aber vor allem bei »Craft Beer«) scheinbar locker mit »toxischer Männlichkeit« einhergeht und dabei gleichzeitig sämtliche »immaterielle Arbeit« entwertet wird. Von daher kann jedoch Pop und Pop Art (als »dekorative Kunst«) durchaus als »feminizing art« verstanden werden (was Andy Warhol – etwa in seiner Abneigung gegenüber dem »aktionistisch-männlich« codierten Abstrakten Expressionismus – ja auch immer wieder zur Sprache gebracht hat). Diese neoliberalen Übernahmen und Umdeutungen verdeutlichen aber auch jenen »turn« zwischen (noch) disziplinargesellschaftlichen und (schon) kontrollgesellschaftlichen Regimen.
Als die Psychologin Betty Friedan 1963 für Frauen eine Arbeit jenseits von »Ehe und Mutterschaft« sowie »Weiblichkeitswahn« forderte und dabei auf »das lebenslange Engagement in Kunst oder Wissenschaft, Politik oder freiberuflicher Tätigkeit« verwies, konnte sie noch nicht wissen, wie sich »die positive Wertung von eigenem Einkommen, freier Zeiteinteilung und schöpferischer Tätigkeit« (Kastner) zur neoliberalen »Work-Life-Balance« transformieren würde. Dabei ist es schon auffällig, dass all diese feindlichen Übernahmen gerade bei »Feministischer Kunst« (also auf dem Feld »Gender« so exemplarisch vorgeführt werden.
»Can the Subaltern Do Art«
Ähnliches können wir jedoch auch dort beobachten, wo es um Kunst unter post- bzw. de-kolonialen Vorzeichen geht (etwa, wenn Versuche unternommen werden, »autochtone Volkskulturen« mittels solchen Narrativen identitär aufzurüsten). Wobei die Gegensätze zwischen Essentialismus und Anti-Essentialismus gerade innerhalb post- bzw. de-kolonialer Diskurse oftmals nicht weniger heftig ausgetragen werden als zwischen vergleichbaren feministischen Positionen. So verwehrt sich etwa der Lacan-Leser Franz Fanon gegen Rückgriffe auf eine (zu revitalisierende) »autochthone Kultur« (also jene gerne auch in linken Kreisen geradezu fetischisierte »nationale Kultur« aus vorkolonialen Zeiten) und plädiert stattdessen (ähnlich wie später auch Stuart Hall) für einen am Fortschritt orientierten »Universalismus«.
Auch bei Gayatri Chakravorty Spivak und Homi K. Bhabha spiegelt Kunst keine fixen Merkmale (oder Traditionen) wider, sondern stellt ein mannigfaltiges Gewusel aus Formen von diversen, sich stets durchdringenden Repräsentationen dar, die gerade durch diese Vermischungen das Potenzial zu Gegenstrategien haben (bzw. durch »ironische Brüche« wie es bei Edward Said heißt). Wobei wir auch hier wieder einem Problem begegnen, welches linke Kunsttheorie scheinbar immer heimsucht: Auch Bhabhas Konzept der Hybridisierung als »zwischenräumlicher Übergang zwischen festen Identifikationen« kann schnell (wieder) zu einer Multikulti-Wellness-Fusion mutieren, wenn Fragen nach Macht und Herrschaft hier nicht mehr gestellt werden. Anders gesagt: Nicht alles, was aus aller Welt in den Sampler geladen und dann wieder auf diese losgelassen wird, ist kosmopolitisch, herrschaftsfrei und utopisch.
Hier kommen nun jene essentialistischen Positionen ins Spiel, für die gerade in den (post-modernen) »hybriden Formen« eines (diasporischen) Anti-Essentialismus die Gefahr besteht, kulturelle, soziale und ethnische Differenzen zu nivellieren (etwa wenn Soul nicht mehr von Pop zu unterscheiden ist oder »Black Music« plötzlich wie Michael Jackson aussieht). Für aktuelle Debatten um Cultural Appropriation liefern diese Zusammenfassungen (und auch die Darlegungen der mannigfaltigen Gründe für differente Positionen) jedoch nicht nur wichtige Theorie-Basics, sondern zeichnen dabei auch jene Verschiebungen innerhalb linker Kontexte nach, die zum neoliberal verzerrten Revival längst überwunden geglaubter Essentialismen (etwa die Frage, wer denn nun überhaupt Dreadlocks tragen darf) geführt haben.

Fuck Art, Let’s Dance?
Feminismus und Black Liberation stellen für Kastner jetzt aber auch Theorieansätze dar, bei denen bildende Kunst nur eine eher marginalisierte Rolle spielt (was jedoch nicht gleichbedeutend mit unwichtig oder nicht wirkungsmächtig ist). Dies mag jedoch vielleicht auch damit zusammenhängen, dass bildende Kunst gerade für jüngere Autor*innen und Theoretiker*innen (nach dem Zweiten Weltkrieg) nicht mehr jenes diskursive Feld darstellt, in dem (aktuelle) hegemoniale Fragen entlang von Race, Gender/Sex, Class verhandelt werden, sondern sich solches in actu nun woanders abspielt. Eben bei Pop, Mode, TV/Kino der Popular Culture oder den von Judith Butler so prominent behandelten Drag Performances.
Dabei fällt gerade in den USA auf, dass es in vielen Texten afro-amerikanischer Theoretiker*innen und Aktivist*innen (und auch Literat*innen) einen spezifischen Fokus auf Musik gibt und bildende Kunst eher (aber nicht nur) am Rande vorkommt. Dabei ist es vollkommen nachvollziehbar, wenn die Künstlerin und Kritikerin Michele Wallace darauf mit dem Aufschrei »I am at war with music, to the extend that it completely defines the parameters of intellectual discourse in the African-American community« reagiert. Nur wird dabei aber gleichzeitig der zentrale Stellenwert, den Musik sowie »dance, fashion, humor, spirituality, grassroots politics, slang, literature, and sports« (Greg Tate) innerhalb afro-amerikanischer Erfahrungen und Theorieproduktionen einnehmen, unterschlagen.
Nicht nur konnte die Benjamin’sche Reproduzierbarkeit (Verfügbarkeit via Tonträger) eine Gemeinschaft/soziale Bewegung (nationwide) generieren, auch die frühesten afro-amerikanischen Theorietexte (wie spätere jene von Greg Tate, Stuart Hall oder Cornell West) sind voll mit Bezügen zu (populärer) Musik.
Wenn Cornell West Gramsci mit HipHop kurzschließen kann, dann findet sich afro-amerikanische bildende Kunst vielleicht auch (aber nicht nur) dort, wo es um Graffiti (als »semiotische Guerilla«) und Platten-Cover (P-Funk) geht (und leitet einen von hier aus weiter zur bildenden Kunst nicht nur afro-amerikanischer sondern auch afrikanischer Künstler*innen).
Let’s Art
Es spricht viel für Kastners Herangehensweise(n), dass ihm nicht nur eine anschauliche Auflistung und Aneinanderreihung linker Kunsttheorien gelingt, sondern diese in den jeweiligen Kapiteln auch auf ihre historischen Herkünfte, Dispute und Irrungen und Wirrungen wie auf ihre aktuellen Potenziale und Probleme abgeklopft werden. So wird dabei aus dem Buch ein Praxisband und Nachschlagwerk par excellence, welches als Arbeitsbuch (zum selbstständigen Erweitern, Ergänzen, Diskutieren etc.) schon vor Corona gute Dienste geleistet hat und welches danach wohl noch wichtiger sein wird. Zieht sich doch quer durch die Kapitel auch ein Zutagefördern jener »Geschichte umstrittenen Wissens«, von der die Queertheoretikerin Sabine Hark spricht, wenn sie über die Grundlagen einer Selbstermächtigung zur Transformation (der Welt) durch »dissidente Partizipation« spricht. Anders gesagt: Bücher wie »Die Linke und die Kunst« sind so wichtig wie Wasser in der Wüste.

Link: https://www.unrast-verlag.de/neuerscheinungen/die-linke-und-die-kunst-detail



















