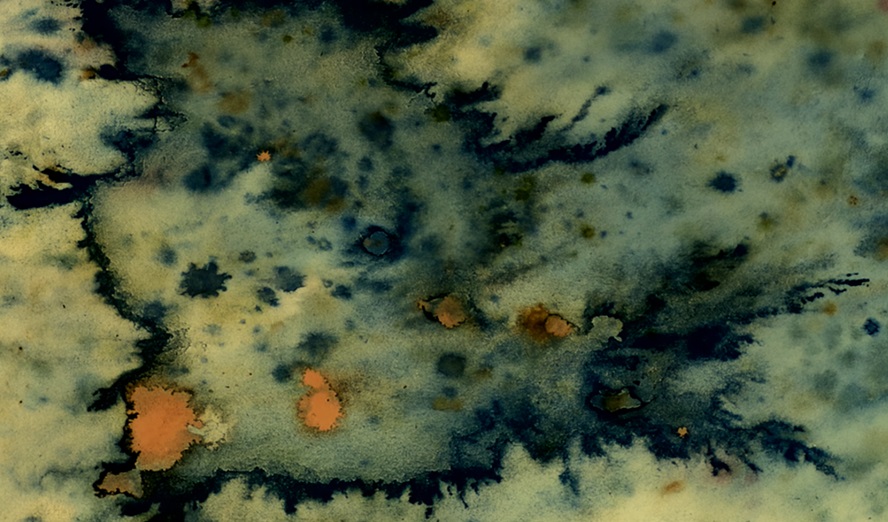Wenn Bowies Kunst inauthentisch ist, wenn sie F for Fake (F für Fälschung) ist, wie Orson Wells es verstanden hätte, ist sie dann auch F for Falsehood (F für Falschheit)? Ich erinnere mich an ein Interview mit Robert Fripp – das ist lange her -, in dem er über einen Studioauftritt Bowies in den 1970er Jahren spricht. Bowie beschäftigte sich mit einem Titel und versuchte sehr vorsichtig, wohl überlegt und über eine sehr lange Zeit hinweg, die richtige emotionale Färbung in seiner Stimme zu erreichen. Was könnte künstlicher und gefälschter sein als das? Sollte wahre Musik nicht direkt aus dem Herzen kommen, herauf über die Stimmbänder und hinein in unser wartendes, muschelartiges Gehör? Und doch, wie von anderen bereits beobachtet, liegt ja gerade Bowies Genie in der sorgfältigen Angleichung von Stimmung und Musik mithilfe des Mediums der Stimme.
Wäre ich ein größerer heideggerianischer Langeweiler als ich schon bin (und das bin ich), könnten wir über die Beziehung von voice (die Stimme) und mood (die Stimmung) als die zugrundeliegende Aktivität, durch die sich uns eine Welt auf zunehmend e motionale Weise und weniger auf rationale Weise enthüllt, sprechen. Bowies Genie ist also eine Interpretation im Sinne der Auslegung oder des Aus-legens von etwas, mit dem wir übereinstimmen oder das volltönend für uns erklingt, das uns entweder hart oder weich trifft. Diesem Gedanken folgend, wollen wir aber eine wichtige Warnung anfügen. Musik, wie die von Bowie, ist nicht dazu geeignet, die Menschen affektiv in eine Art vorherbestimmter Harmonie mit der Welt abzuberufen. Das wäre, wortwörtlich, banal und irdisch. Ganz anders erlaubt Bowie eine Form, sich von der Welt zu entweltlichen, eine Erfahrung von Gestimmtheit, Emotion oder Stimmung, die aufzeigt, dass nicht alles in der Welt stimmt, will heißen, dass nicht alles mit dem Selbst übereinstimmt oder stimmig scheint mit dem Selbst. So gesehen ist Musik ein Konflikt mit der Welt, der eine gewisse Entweltlichung zulässt, ein Rückzug, der uns erlaubt, die Dinge in einem utopischen Licht zu sehen. Jeder, der Bowie über die Jahre hinweg begleitet, ist vertraut mit der nahezu varietéhaften oder pantomimischen Qualität seiner Bühnencharaktere. Jeder dieser Charaktere besitzt eine eigene Stimme. Das reicht vom frechen, mockney-cockney eines Tony Newley oder einem dreckig lachenden Gnom über den engelshaften Anglo-Surrealismus eines Syd Barett, dem reichen basso profundo eines Scott Walker, weiter zu einem höher gelagerten Iggy Pop (ich zähle nicht zu den größten Fans von Bowies Iggy-Imitationen), bis hin zu einem rauchig-weißen Soul-Boy und schließlich zum quasi Opernhaften, geradezu Hymnischen, wie in »Word On A Wing«. Variationen dieser Figuren und anderer lassen sich von Album zu Album aufs Neue ausmachen. Dumm sind wir nicht. Wir wissen, dass es sich bei allen um Fälschungen handelt. Es stellt sich also die Frage, wie aus all dem Vorgetäuschten etwas Wahres hervortreten kann. Man könnte sagen, es macht es einfach, man spürt es einfach (oder eben nicht – alles in allem: Geschmack lässt sich nicht berechnen, schon gar nicht schlechter Geschmack), wie in den berühmten Zeilen aus »Changes«:
But I’ve never caught a glimpse
Of how the others must see the faker
I’m much too fast to take that test.
Sich umzudrehen, um sich selbst zu sehen, bedeutet nicht, seine authentische Subjektivität zu konfrontieren. Es geht darum, nichts zu sehen, nicht einmal einen flüchtigen Blick zu erhaschen. Warhol ist die Leinwand. Häng sie bei dir zu Hause an die Wand. Nichts verbirgt sich dahinter. Für manche ist dies eine Vortäuschung, aber Bowie ist zu schnell, wie er es zwar arrogant, aber nichtsdestotrotz sehr genau darzustellen versteht. Er hat sich bereits aufgemacht zu irgendeiner neuen Form. Meine Hypothese lautet, dass Bowies Genie es uns erlaubt, eben jene oberflächliche Verknüpfung, die Authentizität mit Wahrheit zu verbinden scheint, aufzubrechen. In Bowies Kunst steckt eine Wahrheit, eine stimmungsvolle Wahrheit, eine gehörte Wahrheit, eine gefühlte Wahrheit. Diese Wahrheit jedoch ist inauthentisch, total selbst-bewusst und zur Gänze konstruiert.
Dystopie – schnapp es dir hier, das Ding
Peter Noones 1971 ziemlich erfolgreiche Coverversion von »Oh! You Pretty Things« stellt einen der seltsamsten Momente in der britischen Popgeschichte dar. Noone – dessen Name sich aufspaltet in no one (niemand) und an Odysseus’ Antwort an die Zyklopen erinnert – war Frontman von Herman’s Hermits gewesen, einer Band mit schrägem Namen, die jedoch sehr erfolgreich war. Noone zeichnete sich durch einen fast schon meisterhaften Mangel an Sensibilität für Bowies Lyrik aus, die voll an Referenzen zu Nietzsches »Zarathustra« ist. Um es genau zu sagen, bestätigt der Song die Nutzlosigkeit des Homo Sapiens, und das Verlangen, den Weg für den Homo Superior freizumachen.
Zugegebenermaßen spielt sich das alles im Rahmen einer billigen, typisch britischen BBC»Doctor Who«-Version der Zukunft ab, in all seiner schäbigen Ausstattung und mit schlechten Kostümen. Die Pointe aber ist unmissverständlich: Die außerirdischen Fremden sind gekommen, um unsere Kinder in eine nichthumane Zukunft zu entführen. Für uns also hat der Albtraum begonnen und »[w]e’ve finished our news«.
Das Lustigste daran ist, dass Noone, aus Angst vor der Zensur im Radio, Bowies »the earth is a bitch« gegen das etwas Peppigere »the earth is a beast« austauschte. Die Basis, die Konstante, der Grund für Bowies wichtigste Arbeiten, liegt ja gerade in der Ansicht, dass die Welt verloren, aufgebraucht, alt und am Ende ist. Die Welt ist ein sterbender Hund, der auf die Prügel durch den neuen Meister wartet. Bowies Vision ist unaufhörlich dystopisch. Man hört das gut in der vor-apokalyptischen Melancholie von »Five Years«, oder auch in der postapokalyptischen Vision eines »Drive-In Saturday«. In letzterem Song hausen die Ûberlebenden einer nuklearen Katastrophe in gigantischen Kuppeln in der Wüste im Westen der USA und benützen alte Filme, um das Leben, wie es ihrer Vorstellung nach vor dem Krieg gewesen sein könnte, nachzuspielen, »[l]ike the video films we saw«. Was aber klarerweise durch dieses Nachstellen hervorgebracht wird, ist nicht die Vergangenheit, sondern der klischeehafte Schund romantischer Filme aus den 1950er Jahren. Und »His name was always Buddy«. Die tiefschürfendste und umfassendste dystopische Vision ereignet sich jedoch nach der Einführung der Cut-up-Methode in »Diamond Dogs« (1972), die von Peter Doggett als Bowies »dunkle Studie kulturellern Verfalls« (»dark study in cultural disintegration«) bezeichnet wird. Welches Urteil wir uns auch immer über Bowies Entwicklung auf musikalischem Gebiet erlauben, »Diamond Dogs« stellt in seiner Konzeption einen mutigen Schritt auf neues Terrain dar. Meiner Meinung nach entledigt sich Bowie mit diesem Album endlich des Geistes von »Ziggy Stardust« und beginnt seine so üppige wie rasante Serie aus ästhetischen Transformationen, die bis zu »Scary Monsters« von 1980 reicht. Den oft wiederholten eindeutigen Huldigungen an die Rolling Stones zum Trotz – vor allem die wunderbar kratzigen und leicht verdorbenen Keith-Richards-Gitarrenimitationen – übersteigt das Album alles, was bisher als Rock’n’Roll galt. Das kommt einem Genozid gleich. Inspiriert von Burroughs’ »Wild Boys«, mit seinen marodierenden, zweischneidige Bowiemesser tragenden Gangs, beginnt »Diamond Dogs« mit der Prophezeiung der »Future Legend«, wenn in den zügellosen Tagen des Punk die Jungs und Mädels aus der Vorstadt durch die Straßen kaputter britischer Städte ziehen:
As the last few corpses lay rotting on the slimy thoroughfare
The shutters lifted in inches in t emperance building High on Poacher’s Hill
And red mutant eyes gaze down on Hunger City
No more big wheels
Fleas the size of rats sucked on rats the size of cats
And ten thousand peoploids split into small tribes
Coveting the highest of the sterile skyscrapers
Like packs of dogs assaulting the glass fronts of Love-Me Avenue
Ripping and rewrapping mink and shiny silver fox, now legwarmers
Family badge of sapphire and cracked emerald
Any day now the year of the diamond dogs.
Bowies Vision der Welt ist die einer zerstörten Welt: der totale zivilisatorische Kollaps. Das Bild ist das eines urbanen Raums vor der Gentrifizierung (was für ein Segen es doch, war zu der Zeit am Leben gewesen zu sein), eines Raums des Verbrechens und der verkehrten Verbraucherherrschaft. Vagabunden tragen Diamanten, Pelz aus Silberfuchs wird zu Stulpe, und aus Juwelen gefertigte wappenartige Embleme schmücken freakige Peoploids.

Les tricoteuses
In Bowies Alben finden sich oft Spuren aufgegebener musikalischer Stile, die wie verlassen abgenutzte Häute wirken, aber bereits etwas Neues erahnen lassen, denen in zukünftiger Arbeit erst eine Stimme verliehen wird. »Diamond Dogs«, »Rebel, Rebel« und »Rock’n’Roll With Me« weisen in die Vergangenheit, während wohl die soulige, von Isaac Hayes beeinflusste Wah-Wah-Gitarre aus 1984 bereits nach vorne auf »Young Americans« verweist. Aber die wahren Neuerungen zeigen sich in der neunminütigen Sequenz aus »Sweet Thing«, »Candidate« und »Sweet Thing« (Reprise), wie auch im albtraumhaft großartigen »We Are the Dead« (gute Argumente ließen sich auch für »Chant of the Ever Circling Skeletal Family« finden. Auf meiner original Vinyl von »Diamond Dogs« aus den 1970er-Jahren blieb die Nadel immer am Ende des Tracks hängen und erzeugte so ein unendliches, zunehmend verstörendes »bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro«).
In der toten Diamond-dog-Welt des Halloween-Jack (einer der Figuren aus dem Album) ist Sex nicht mehr länger irgendeine anstößige Erregung. Sex ist »putting pain in a stranger«. Das Bild dafür, ähnlich einem Gemälde von Bacon, ist »a portrait in flesh, who trails on a leash«. Wenn dies eine Welt aus Fleisch ist, dann ist es ein sterbendes Fleisch. Wir finden hier ein fast schon paranoid-schizophrenes Bild der Welt als etwas Ausgestorbenes, Verfaulendes und Erlösungsbedürftiges vor. Diese Art von Welt findet man in Präsident Schrebers delikaten Wahnvorstellungen oder auch in R. D. Laings offenem Asyl Kingsley Hall samt seiner Insassen, im London der späten 1960er Jahren: »Can’t you tell I’m dead. I can smell the flesh rotting.«
Vielleicht spielt auch die Erinnerung an die Welt von Bowies schizophrenem Halbbruder Terry Burns hier mit hinein, von dem er soviel gelernt hatte. Der am Glauben festhielt, dass David ihn eines Tages würde retten können, nachdem er für so viele Jahre in einer psychiatrischen Klinik institutionalisiert gewesen war. Terry beging Ende 1984 Selbstmord und Bowie löste durch seine Nichtteilnahme am Begräbnis einen Familien- und Medienkrieg aus. Er wollte nicht, dass das Ganze in einen Zirkus ausartete.
Es wurde schon oft gesagt, dass irgendetwas in Bowie psychotisch sei, was ich aber sehr bezweifeln würde. Bowie war kein durchgedrehter Junge. Sollten solche psychotischen Tendenzen existieren, dann – man halte es hier wie mit Joyce’ »Finnegans Wake« – werden sie künstlerisch sublimiert. Dank seiner Kunst ist er wahrscheinlich nicht verrückt. Die regelmäßigen Referenzen an Wahn, Paranoia und Selbsttäuschung, vor allem in den frühen Nummern auf »The Man Who Sold the World«, funktionieren als musikalische Transformationen ihres Terrors. Selbst der abschließende, verrückt jaulende Gesang von »All the Madmen«: »Zane, zane, zane. Ouvrez le chien.«
Abgesehen davon ist ein verrückter toter Halbbruder, der wie eine Art Schattenfigur die Geschichte des Wahnsinns in der Familie repräsentiert (wie auch im Falle von Bowies Mutter, Margaret Mary Burns), erschreckend genug. Wir sind alle tot. Die Luft ist voll von ihren Schreien.
»Is it nice in your snow storm, freezing your brain?«, fragt Bowie. Es ist die beglückende Trostlosigkeit von Bowies Vision in »Diamond Dogs«, von deren dreckigen Klauen ich förmlich hineingezogen werde. Als die Hauptfigur aus »Candidate« durch das Filmset, das selbst wie ein solches riecht, spaziert, prahlt er:
Who wrote up scandals in other bars.
Die tricoteuses (Schneiderinnen) waren jene aufständischen Pariser Frauen der Arbeiterklasse, die den Exekutionen des Terrors von 1793/94 zujubelten und der chirurgische Präzision der »Madame Guillotine« zusahen. Der Aufbau von »Candidate« besitzt eine Furcht einflößende lyrische Kraft und zeigt uns eine Welt voll Ausbeutung, Verfall und Vergewaltigung:
Who press you on the ground while shaking in fright.
Die Welt ist eine sexuell ausgebeutete Hölle, bestimmt durch willkürliche und extreme Gewalt:
With you by my side it should be fine
We’ll buy some drugs and watch a band
Then jump in the river holding hands.
Die einzige mögliche Beziehung in einer verzweifelten, kaputten Welt, der einzig verbleibende Rest an Liebe, besteht in der Einnahme von Drogen und der Umsetzung eines suizidalen Paktes. In einer lieblosen Welt kann die Liebe nur durch den Tod gerettet werden.
Dystopie und Utopie I ~ Dystopie und Utopie II ~ Dystopie und Utopie III