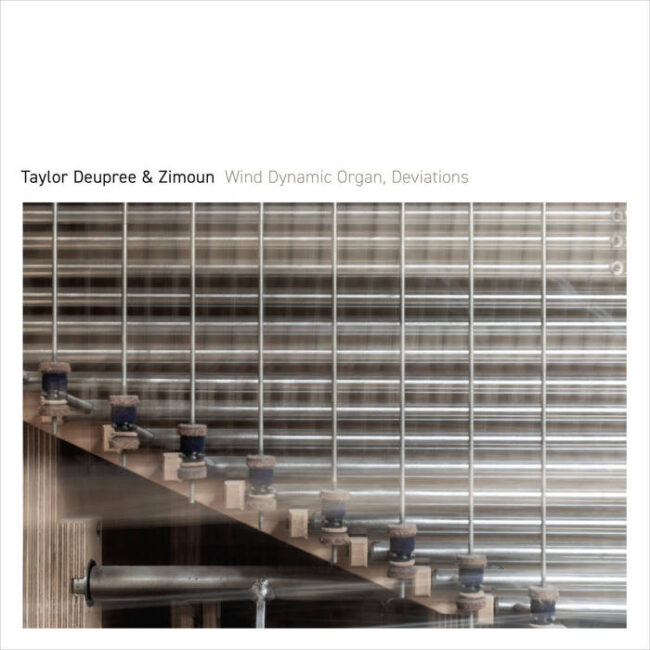Bon Ivers Debüt-Album »For Emma, Forever Ago« traf 2007 wohl einen Nerv. Schwer zu sagen, warum; Neo-Folk war ja schon in die Jahre gekommen, Melancholisches, vorgetragen von jungen Männern in brüchiger, hoher Stimme – zuhauf, zuhauf, man konnte es schon nicht mehr hören. Und dennoch: Irgendwie hob sich Justin Vernons Falsettgesang ab vom übrigen Mainstreampop. Vielleicht deckt Bon Ivers Musik einfach dieses Grundbedürfnis, immer wieder einmal in ein bisschen traurigen Songs zu schwelgen, die eigene Empfindsamkeit zu pflegen (durch Teilhabe an der Empfindsamkeit des Songwriters, der sein Inneres, oder gar sein Innerstes preisgibt) und sich einfach trösten zu lassen. Und des Trostes bedürfen viele in dieser krisengebeutelten Zeit. Auch das selbstbetitelte zweite Album aus 2011 ist so ein Trostspender. Im Gegensatz zu »For Emma …«, das eher karg, vorwiegend auf der Basis von akustischen Gitarren, instrumentiert war, tritt dieses Album mit breiter Orchestrierung auf und landet damit im Fach Baroque Pop. Wie auf der EP »Blood Bank« (2009) kommen hier Electronics (ja, auch der berühmte Vocoder) zum Einsatz. Und so ist es auch keine Ûberraschung oder ein vollkommener Stilbruch, dass »22, A Million« ein Elektronik-lastiges Album wurde (Samples, Loops, verfremdete Stimmen usw.). Es gibt aber auch wunderhübsche Saxofonbläsersätze darauf. Stimmungsmäßig schließt Bon Ivers neues Werk an die vorherigen Arbeiten an – Musik zum Zudecken, diesmal mit ein paar kleinen Irritationselementen. Offenbar, so heißt es jedenfalls, wurde Bon-Iver-Mastermind Justin Vernon gedrängt, vom Basteln an Soundscapes abzulassen und das Material in Songform zu wandeln. Wie auch immer, was den Sound betrifft, bietet »22, A Million« nichts Neues unter der Sonne, auf instrumentaler Ebene eigentlich nichts, was etwa im Ambient-Bereich so um 2000 herum nicht auch schon zu hören war. Lustigerweise klingt das in Kombination mit dem Gesang Vernons ähnlich wie einiges von Peter Gabriel in den 1980ern und 1990ern.
Innerhalb des schmalen Bon-Iver-Å’uvres (drei LPs, eine EP) hat der Musikstil des Justin-Vernon-Projekts große Veränderungen erfahren. Im größeren Zusammenhang betrachtet, etwa der Popgeschichte insgesamt oder auch nur dem Singer-Songwriter-Bereich ab 2000, ist das musikalische Tun des aus Winsconsin stammenden 35-jährigen Musikers eigentlich recht insignifikant. Schön anzuhören ist es aber dennoch. »22, A Million« bietet keinen Grund, sich in Lobeshymnen zu überschlagen. Das Album als Kommerzkitsch abzutun, wird ihm aber ebensowenig gerecht. Dank YouTube & Co. ist es ja ganz einfach möglich, in der musikalischen Vergangenheit Justin Vernons zu stöbern. Seit Teenagerjahren war der Mann in unterschiedlichen Band- und Soloprojekten tätig, machte einmal in Reggae, Soul und Jazz, einmal in grungigem Bubenrock, croonte am Klavier, coverte Bruce Springsteen, Ausflüge in den HipHop nicht zu vergessen. Dabei immer wieder das Rad neu zu erfinden, ist mäßig spannend, wenn auch angenehm anzuhören. Aber irgendwann muss er die ganze Musikgeschichte durch haben – und dann?