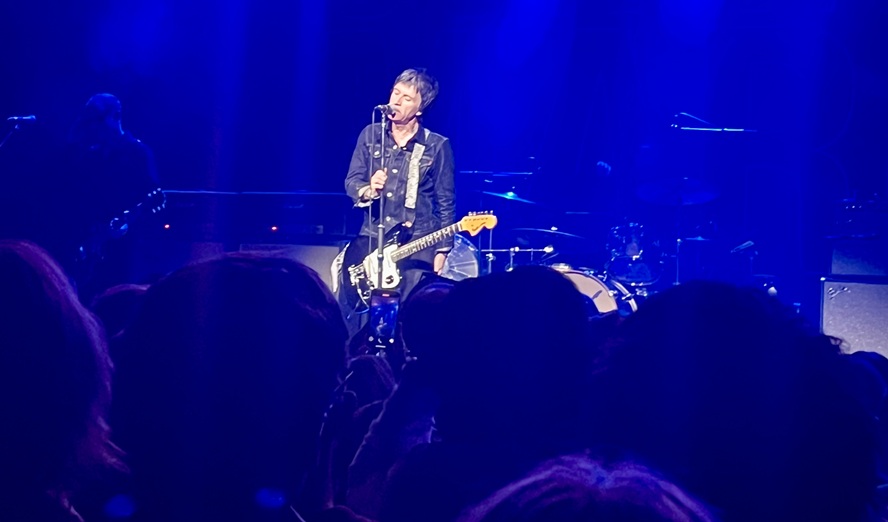skug: Unser Gespräch ist Teil einer längeren Untersuchung zum Thema Noise-Ästhetik. Ihre Ästhetik definiert sich weniger über Noise als über Intensität. Ich beginne daher mit einer konventionellen Frage: Wie fühlen Sie sich nach so einem Konzert? Im Publikum war es extrem laut und intensiv – ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das auf der Bühne anfühlt.
Glenn Branca: Auf der Bühne selbst haben wir heute Abend gar nicht so laut aufgedreht, was normalerweise aber nichts daran ändert, wie’s über die PA kommt. Meiner Meinung nach war es nicht wirklich laut. Ich höre Musik am liebsten laut, ob Beatles oder Beethoven. Durch das Publikum wurde heute allerdings viel Klang geschluckt. Ich versuche also, die Intensität in die Musik zu legen und nicht auf die Bühne zu verlagern. Es sollte auch keine Rolle spielen, ob ich dirigiere oder nicht, wie im Fall meines Stücks für hundert Gitarren, mit dem ich seit drei, vier Jahren unterwegs bin. Dirigiert wird es von John Myers, einem früheren Mitglied meiner Band. Er ist wieder in New York zurück und wird vielleicht auch wieder zum Ensemble stoßen.
Im Großen und Ganzen basieren Ihre Kompositionen jedoch auf Harmonien.
Es ist meine Version dessen, was ich als Harmonie betrachte. Ich beschäftige mich intensiv damit, arbeite mit unterschiedlichen Techniken, verfolge jeden Ansatz, den man sich nur vorstellen kann. Einmal ist er experimentell und frei, dann wieder sehr fokussiert und differenziert, und manchmal ist es eine Kombination von beidem.
Und heute Abend? Waren diese Stücke alle durchkomponiert?
Das letzte Stück war eine strukturierte Improvisation. Diese Form praktizierte ich bereits in den 1970er-Jahren, vor allem weil viele MusikerInnen, mit denen ich zusammenarbeitete, keine klassische Ausbildung hatten. Ich kann so eine allgemeine Vorstellung dessen vermitteln, was ich möchte. Dass auch eines meiner bekanntesten Stücke, »Lesson No. 1 for Electric Guitar« aus dem Jahr 1980, eine strukturierte Improvisation ist, hätten die meisten Leute wohl nicht gedacht. Es ist jedoch keine Improvisation, wie man sie von John Zorn oder Miles Davis kennt. Das sind musikalische Giganten … Ich bin kein Gigant.
Sie verweisen immer wieder auf Polaritäten. Wie aber würden Sie die Grenze zwischen Noise und Intensität definieren?
Das ist eine sehr interessante Frage, denn es besteht nicht der geringste Zweifel, dass die Dynamik entscheidend mitbestimmt, wie ein Akkord klingt. In der Harmonielehre heißt es für gewöhnlich: eine bestimmte Kombination von Tönen, die einen bestimmten Effekt hat. Was nicht stimmt. Zusammenklang erstreckt sich nämlich auf jeden einzelnen Aspekt des Klanges und der Performance und des Instruments und der Komposition. Ich stelle mir vor, dass ich im Publikum sitze und zuhöre. Meine Musik soll ein Hörerlebnis für das Publikum sein.
Raum ist für Ihre Art des Komponierens ein wichtiger Begriff. Die Prozesse der Perzeption waren für Sie zunächst mit den Kategorien des Theaters verknüpft. Eines der Grundkonzepte des Theaters ist der Körper im Raum oder der Körper in Raum und Zeit. Ihre Form des Komponierens ist eine sonische Erkundung, die den ganzen Konzertraum mit einbezieht.
Ich bin erfreut darüber, dass Sie das alles während des Interviews sagen und nicht erst danach schreiben, um besser dazustehen, wie es viele InterviewerInnen machen. Früher dachte ich tatsächlich mehr in räumlichen Kategorien, im Sinne von Musik als Theater. Nun geht es mir eher darum, ein Werk zu schaffen, das in jeder Form existieren kann, ob es nun aufgezeichnet ist oder aufgeführt wird, oder ob ich dabei bin oder nicht. An Projekten mit vielen Gitarren habe ich bereits in den 1980er-Jahren gearbeitet. Dabei ließen sich viele akustische Phänomene im Raum registrieren, die von den Leuten oft Geistertöne genannt wurden, tatsächlich aber nur beweisen, dass Musik auch ein psychoakustisches Ereignis ist und nicht nur etwas, das einfach auf einem Stück Papier notiert werden kann. Bei der Musik des 20. Jahrhunderts, bei viel Zwölftonmusik, sprach man mitunter sogar von Augenmusik. Sie sah auf dem Papier gut aus, aber sie klang nicht sehr gut. Ich wollte von Anfang an Musik machen, die gut klingt, jedenfalls für mich.
Mögen Sie keine Zwölftonmusik?
Zwölftonmusik? Nein, ich hasse sie. Ich habe sie immer gehasst. Ich habe mir alles angehört, Zwölftonmusik, serielle Musik, und natürlich gibt es Stücke, die ich mag, ein Streichquartett von Elliott Carter, Kompositionen von Stockhausen.
Bleiben wir bei der Kategorie des Raumes.
Ich bin aber auch nicht so sehr an Musik interessiert, in der es nur um den Raum geht. Ich komponiere gerne, ich schreibe gerne. Ich hätte auch Journalist werden können oder Schriftsteller. Ich finde Gefallen daran, zu schreiben, ich finde Gefallen daran, allein zu sein und mir etwas auszudenken. Mit zunehmendem Alter interessiert mich das Schreiben mehr als das Auftreten. Der Stand der Dinge ist jedoch, dass ich oft nur deshalb auftreten muss, damit meine Werke aufgeführt werden, um einmal die ungeschminkte Wahrheit zu sagen. Ich würde lieber nicht, aber die Menschen wollen mich sehen, und noch macht es mir Spaß.
Ich sollte übrigens anmerken, dass ich bei der heutigen Aufführung etwas gemacht habe, was ich nie zuvor gemacht habe und wahrscheinlich nie mehr wieder tun werde. Als ich Otto Klemperer entdeckte, wusste ich nicht, dass es überhaupt einen Dirigenten gab, der so dirigierte wie ich, besonders in den 1980er- Jahren, als ich noch jünger war und viel mehr Energie hatte. Ich geriet völlig aus der Fassung, als ich entdeckte, mit welcher Intensität Klemperer dirigiert hat. Heute Abend versuchte ich etwa zweieinhalb oder drei Minuten lang eine Vorstellung von Otto Klemperer zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob das irgend jemand bemerkt hat. Vielleicht hat jemand gefilmt … es war eine kleine Verbeugung vor jemandem, den ich für einen großartigen Dirigenten halte.
Ihre Faszination für Gitarrensounds haben Sie sich aber offensichtlich bewahrt.
Gitarren mag ich nach wie vor, ich schreibe ja noch immer für Gitarren. Das Ganze ergab sich eher zufällig, als ich den Auftrag erhielt, ein Stück für ein kleines Ensemble zu komponieren. Für gewöhnlich nehme ich so etwas nicht an, weil es aber für Steve Reich, einen meiner Lieblingskomponisten, und ein größeres Festival in London war, sagte ich zu und schrieb ein Stück für vier Gitarren und Schlagzeug. Danach ergaben sich weitere Aufführungsmöglichkeiten, und ich erkannte, dass ein kleines Ensemble ein verdammt guter Klangkörper ist. Derzeit arbeite ich am Stück »The Ascension: Three«, das voraussichtlich vor Jahresende fertig sein wird. Und es wird ganz anders klingen.
Das führt zu einer Frage, welche sich auf die Rolle der MusikerInnen auf der Bühne bezieht. Würden Sie die MusikerInnen als InterpretInnen oder als Instrumente definieren? Welche Rolle spielen sie?
Meine neuen Werke würde es ohne dieses spezielle Ensemble überhaupt nicht geben. Ich brauche MusikerInnen, die nicht nur verstehen, was ich mache, sondern auch Noten lesen können. Es gibt viele RockmusikerInnen, die in meiner Gruppe gerne einen höllischen Lärm machen würden, aber ich schreibe alles in Liniennotation … das heißt außer – wie bereits gesagt – diesem einen sehr kurzen Stück, das eine strukturierte Improvisation war. Ohne diese speziellen Menschen, die großartigen MusikerInnen hätte das alles heute gar nicht stattgefunden. Zu sagen, dass sie die Musik interpretieren, trifft es nicht wirklich. Es ist eher eine … ich kann nicht einmal Zusammenarbeit dazu sagen. Die Musik ist sehr sorgfältig notiert und selbst für erstklassig geschulte MusikerInnen gar nicht so einfach zu spielen. Ich schreibe äußerst selten Rhythmen, die nicht ständig über den Taktstrich hinweggehen.
Manchmal erinnert es an Elliott Sharp, sehr mathematisch …
Ja, ich arbeite gerne mit prozesshaften Entwicklungen, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Steve Reich. Das Stück mit dem Titel »Lesson No. 3«, mit dem ich Steve Reich Anerkennung zolle, ist sehr schwer zu spielen. Es erfordert ein ungeheures Maß an Konzentration. Der Respekt, den ich vor der Arbeit dieser MusikerInnen habe, ist immens. Ich brauche sie. Ohne sie könnte ich Stücke wie dieses gar nicht machen. Auch Steve Reich wurde mit diesem Problem konfrontiert. In seinen frühen Jahren war das durchschnittliche Tempo seiner Kompositionen 200 Schläge pro Minute – Viertelnoten pro Minute! – es galt also, irrwitzig schnell synkopierte Rhythmen zu spielen, was in den 1970er- Jahren die meisten klassischen MusikerInnen einfach nicht konnten. Libby Fab, meine Drummerin, kommt am Ende des Stückes immer auf bis zu 208 Schläge. Und diese Menschen lesen dabei noch immer vom Blatt, sie spielen noch immer synkopierte Rhythmen, wie verlangt, also auch über den Taktstrich hinweg.
In Ihrer Rolle als Dirigent setzen Sie also gewissermaßen einen Kommunikationsplan um?
Sie brauchen erstens Einsatzzeichen, weil es schwer ist, immer zu wissen, wo man einsetzen muss – vor allem bei diesem Stück, diesen vielen Wiederholungen. Mittlerweile haben wir es aber so oft gespielt, dass die MusikerInnen mich eigentlich nicht brauchen. Die Arbeit des Dirigenten besteht üblicherweise darin zu interpretieren, was nichts mit dem zu tun hat, was ich mache, ich weiß nämlich genau, wie es klingen soll.
Würde ich versuchen, die Matrix Ihrer heutigen Arbeit zu definieren, könnte ich sagen: Minimal Music, Intensität, Harmonie und Lautstärke im Raum.
Ich würde Dynamik statt Lautstärke sagen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber es war nicht alles laut. Ich gehe nicht mehr gerne zu Orchesterkonzerten, weil es mir nicht laut genug ist. Ich würde gerne ein Orchesterstück für eine Besetzung von 200 Personen schreiben – auf der Bühne wäre jedenfalls genug Platz, weil auch bei manchen Orchesterkonzerten ein 100-stimmiger Chor mitwirkt. Gehen Sie zurück zu Bach, dann weiter zu Mozart, zu Beethoven, zu Wagner, zu Bruckner, zu Mahler, und Sie werden feststellen, dass das Orchester immer größer wird. Warum? Das Publikum mag’s lauter.
Da könnten wir gleich einen weiteren Begriff zur Sprache bringen, nämlich Extension, Erweiterung.
Das ist eine Erweiterung, ja, daran besteht kein Zweifel. Ich weiß aber auch, dass sich die Menschen heute schwer tun, bestimmte Musik zu hören. Meine bekanntesten Alben sind jene, die ich vor 30 oder mehr Jahren gemacht habe. Meine beste Musik jedoch habe ich erst danach komponiert. Sie ist viel komplexer, viel nuancierter, viel lauter.
Soweit ich verstanden habe, ist die Avantgarde des späten 20. Jahrhunderts – wie zum Beispel John Cage und seine Ideen, dass alles Musik sein kann, jeder Klang interessant sein kann, sogar Geräusche – für Sie weniger wichtig als rhythmische Konzepte.
Ja, deshalb war Cage auch so aufgebracht. Er hat in den 1980er-Jahren heftige Attacken gegen meine Musik geführt. Cage mochte keine stark rhythmische Musik, er hielt sie für faschistisch, was meiner Meinung nach total lächerlich ist. Es muss einfach Dinge geben, die nur ein Mensch ganz allein machen kann, die nicht aus kollektiven Prozessen entstehen oder dem Zufall überlassen werden können. Wer will schon kollektive Gemälde sehen, kollektive Romane lesen? Haben Sie je von einem kollektiven Roman gehört? Etwas Schlimmeres könnte Ihnen gar nicht unterkommen. Trotzdem glaube ich, dass Cage ein Poet ist. Er war ein musikalischer Poet und ist ein unheimlich wichtiger Künstler unserer Zeit, aber meiner Meinung nach kein Musiker oder Komponist, den viele Leute jemals hören wollen. Ich meine, Zufälligkeit schafft nichts Neues, sondern erzeugt Gleichförmigkeit.
Ich erinnere mich an die Kontroverse in den späten 1980er-Jahren. Doch meine Frage jetzt ist: Wo beginnt das Geräusch? Wie würden Sie Geräusch definieren? Sie stehen solcher Zufallsmusik zwar reserviert gegenüber, und doch kann Geräusch auch als zufälliger Vorgang definiert werden.
Nein, nein, nein! Ich werde Ihnen da nicht helfen mit solchen Begriffen, ob »Noise« oder »Geräusch«! Es ist strukturiert, es ist Musik. Es gibt so viele verschiedene Arten von Geräuschen, wie es verschiedene Arten von Harmonien gibt.
Vielleicht sollten wir über Harmonik und Obertöne reden?
Heute Abend hatten wir das Problem, dass es zwar beim Soundcheck laut genug war, aber enttäuschenderweise verschwand der voluminöse Klang, als das Publikum hereinkam. Die MusikerInnen mussten viel härter arbeiten, und ich hatte viel weniger Spaß. Es ist ja nicht so, dass ich zwangsläufig an Obertönen per se interessiert bin. Jeder Klang, den wir erzeugen, ist nun einmal eine Kombination von Obertönen und immer nur Ergebnis der Akustik im Raum. Natürlich betont man mit einer höheren Lautstärke die Obertöne, aber dafür war das PA-System einfach nicht stark genug. Diese Anlage war entweder für Techno, Disco oder für Popbands ausgelegt. Wir haben die richtigen Verstärker auf der Bühne, wir haben die richtigen Gitarren, wir haben das richtige Drum-Set. Es klang phantastisch auf der Bühne und während des Soundchecks. Aber das Publikum schluckt so viel Klang. Ich könnte im Vertrag auf 20 Stunden Soundcheck bestehen, aber das funktioniert in der Realität natürlich nicht.
Seit vielleicht sieben oder acht Jahren findet sich auf Ihrer Website keine Diskographie.
Ja, die Website war ursprünglich eine Fanpage. Sie wurde noch unter MSDOS geschrieben, was ich seit den 1980er-Jahren nicht mehr gemacht habe und für mich auch absolut schrecklich ist … Aber wenn Sie auf die Startseite gehen, dann sehen Sie, was ich gemacht habe: das 100-Gitarren-Stück …
Wie oft haben Sie es aufgeführt?
Sooft man es haben wollte. Wir haben es in Los Angeles gemacht, in St. Louis, in London, in Belgien. Wir haben es ungefähr zehn Mal aufgeführt.
Sie arbeiten dabei auch mit lokalen MusikerInnen.
In New York kann ich es tatsächlich mit 100 MusikerInnen aus der Stadt machen. Normalerweise finden sich an die 80 oder so. Es gibt 27 Instrumentengruppen, und jede muss separat gemischt werden. Ich habe das Stück laufend verändert und weiterentwickelt, einige Teile zur Gänze gestrichen oder umgeschrieben und erweitert. Ich würde auch gerne ein akustisches Stück machen, »Music for Strange Orchestra« für eine unglaubliche Vielfalt von unterschiedlichen Instrumenten, von sogenannten ethnischen über selbstgebaute bis hin zu konventionellen, klassischen. Dieses Orchester soll klingen, wie kein Orchester je geklungen hat. Es ist, als ob ich für die Berliner Philharmoniker schreiben würde.
Letzte Frage: Was lesen Sie gerade?
Zurzeit lese ich viele Satiren, vor allem politische. Wenn Sie Namen hören wollen, dann nenne ich einen englischen Autor: Ben Elton – sehr intelligent und politisch sachkundig. Er vertritt Standpunkte, die meinen sehr ähnlich sind. Ich hasse die Welt so, wie sie ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in der Steinzeit lebe. Ich glaube, dass der Mensch der Gegenwart ein psychotisches, verrücktes, pathologisches Monster ist, das nicht nur die Welt zerstört, sondern auch seine Mitmenschen. Ich meine, ich bin ein Tier, drücke aber meine animalischen Tendenzen auf der Bühne aus. Ich töte keine Menschen, ich bestehle niemanden, dafür nehme ich meine animalischen Instinkte, die real sind und Teil dieses genialen Denkapparates, mit dem wir alle ausgestattet sind, und lege sie in meine Musik, weil ich glaube, dass wir Menschen schlicht und einfach die Tatsache zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir Tiere sind. Dass wir diese Instinkte haben. Auch davon handelt meine Musik.
Übersetzung von Friederike Kulcsar, englische Version: https://skug.at/interview-with-glenn-branca/
Glenn Branca: »The Ascension: The Sequel«
(mit aktuellem Ensemble 2010, Systems Neutralizers)
Glenn Branca: »Symphony No. 7 (for orchestra) – Live in Graz 1989«
(2010, Systems Neutralizers)