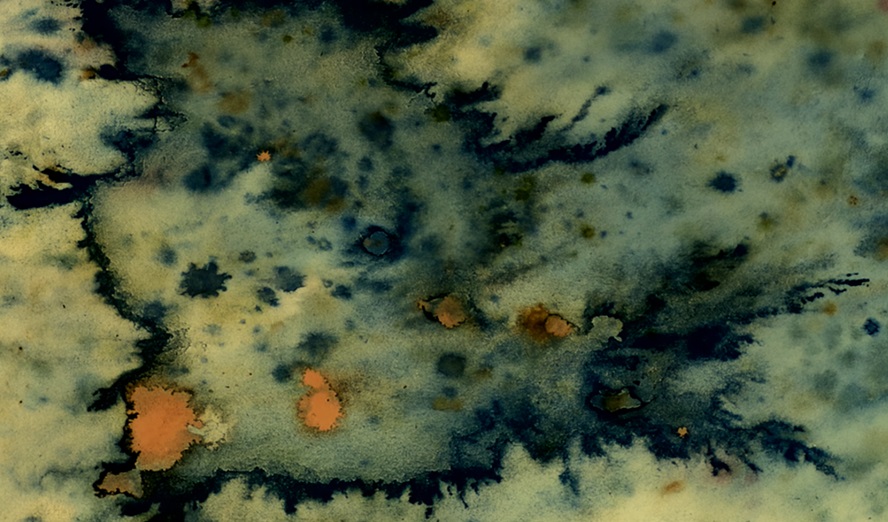»Es ist immer Krieg.
Hier ist immer Gewalt.
Hier ist immer Kampf.
Es ist der ewige Krieg.«
Mit diesen Worten schließt das zweite Kapitel von »Malina«, Bachmanns einzigem Roman. Warum befinden wir uns in einem »ewigen Krieg«? Aktuelle Ereignisse lassen hierüber kaum Zweifel aufkommen. Aber was ist dieser ewige Krieg und wie ist er über uns gekommen? Eine seiner Quellen ist die Verhexung unserer Sprache. Eine vernebelnde Sprache, die Ingeborg Bachmann zuweilen »Gaunersprache« nannte und deren Analyse sie einen wesentlichen Teil ihres intellektuellen Lebens widmete. Ihr Schreiben kann als ein Versuch betrachtet werden, dieser Sprache der Gauner und dem unbeendbaren Krieg, der durch diese entsteht, zu entkommen. Ein äußerst schwieriger Weg.
Sprache ist nicht bloßes Mittel der Kommunikation, sie prägt gleichzeitig – um es philosophisch auszudrücken – unseren empirischen Charakter. Es mag sein, dass Worte die Welt nicht verändern können, aber sie verändern das Abbild des Weltbestandes in uns. Ingeborg Bachmann glaubte an eine Möglichkeit der Begegnung mit der Wirklichkeit, an einen »moralisch […] erkenntnishaften Ruck«. Dieser Hauptgewinn, eine echte Erfahrung, eine Bewusstwerdung der eigenen Lage und des Verständnisses der Welt, dieser Hauptgewinn wird durch die Gaunersprache verunmöglicht. Die permanent auf uns einquasselnden Gauner wünschen schlicht keine Veränderung der Verhältnisse, weil sie diese kontrollieren (oder zumindest glauben, sie täten es). Es bedarf nur eines einzigen, sich seiner Situation bewussten Menschen und schon zerfallen die größten ideologischen Gebäude zu Staub. Nur – und hier zeigt sich die Tücke – welcher Sprache sollte sich jener erwachte und bewusste Mensch bedienen? In jener der Gauner können Einsichten nicht vermittelt werden.
»Ein Wildermuth wählt die Wahrheit«
In ihrer Erzählung »Ein Wildermuth« widmet sich Bachmann am Beispiel eines Richters, der an seiner Aufgabe, Recht zu sprechen, zerbricht, dem Verhältnis von Welt und Sprache anhand der gigantischen Vokabel »wahr«. Eine Konsequenz der Gaunersprache ist die Auflösung der Rechtssicherheit. Recht ist ein Spruch, eine sprachliche Verbindlichkeit, die als solche nur gelten kann, wenn sie von allen Beteiligten erkannt und akzeptiert wird. Die gaunerartige Sprachverhexung sucht nun nach dem immerwährenden Schlupfloch, indem jede Formulierung so gewählt wird, dass sie unverbindlich bleibt und sogar ins Gegenteil verkehrt werden kann. Die Bachmannsche Spracharbeit war Arbeit gegen eben diese Schläue. Ihre Kontroverse mit Martin Heidegger, auch ein wenig die Differenzen mit Paul Celan, hatten hier ihren Kern, da diese (ersterer mehr als letzterer) bereit waren, das Poetische als das Offene und Vieldeutige zu gestalten, das es nicht ist. DichterInnenwort ist Hammerschlag und zwar auf des Nagels Kopf.
Wenn nun Verträge und Rechtsprechung in gaunerartiger Offenheit gehalten werden, dann liegt hierin schon die sprachliche Quelle von Unwahrheit und Unfrieden. Aktuell zeigt sich dies in der Kontroverse um die Wiederholung der österreichischen Bundespräsidentenwahl. Wenn die blaue Schlange mit gespaltener Zunge züngelt, sie setze sich durch die Forderung nach einer Wahlwiederholung für »Demokratie und Rechtsstaatlichkeit« ein, dann betreibt sie damit genau das Gegenteil, indem sie eben diese aushöhlt. Denn zugleich insinuiert die FPÖ, es habe »Unregelmäßigkeiten und Manipulationen« gegeben, obgleich der VfGH festgestellt hat, keine Belege dafür gefunden zu haben. Gleichwohl musste er – ein Gebot der Logik – einräumen, »es hätte manipuliert werden können«. Die Betonung des »hätte werden können« durch die FPÖ ist ein politisch-sprachliches Gaunerstück und nichts weniger als eine Art sprachliche Vorbereitung zu autoritärer Machtübernahme. Was ein Richterspruch schaffen sollte (und wollte), die Befriedung durch Entscheid der Interessenskonflikte, wird torpediert. Da nun weitere Unregelmäßigkeiten durch einen einzigen vorzeitigen Tweet am Wahltag belegt werden könnten, kann auch die nächste Wahl bei unbefriedigendem Ergebnis wiederholt werden. Dadurch wäre die für die Demokratie essenzielle Institution des Urnengangs selbst destabilisiert, weil unglaubwürdig. Einem historisch gut dokumentierten Schema folgend, müsste dann nur mehr die Formel ausgegeben werden: »Demokratie funktioniert nicht, deswegen schaffen wir sie ab!« Wobei dann geflissentlich der wichtige Zusatz verschwiegen würde: »Nachdem wir zuvor dafür gesorgt haben, dass sie nicht funktioniert.«
»Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar«
Den latent wahrheitswidrigen Behauptungen der FPÖ ist in diesem aktuellen Fall kaum beizukommen, da die Verdrehungen durch geschickten Einsatz von Gaunersprache sehr tief verwurzelt sind. Der Richter Wildermuth muss in der Erzählung Bachmanns erkennen, wie die Schwierigkeiten seiner Rechtsprechung ihren Kern in der Unmöglichkeit der rechten Wortwahl haben. Er bricht zusammen über der Beobachtung, dass das Wort »Wahrheit« für ihn unaussprechbar wird. Alles was er sich »wahr« zu nennen angewöhnt hatte, war nur vorläufig. Sein lebenslanger Versuch, Wahrheit durch die möglichst genaue Verbindung von Wort und Tatsache zu filtrieren, scheitert, weil im Sprachgebrauch des Richters die Worte nach einer Weile zerfallen. In Bachmanns – ein wenig schematisch geratener – Erzählung kontrastiert der Richter seine letztlich ergebnislose Wortsuche mit jener der fabulierlustigen Ehefrau und ihres vermutlichen Liebhabers, eines Dichters. Der Richter muss einsehen, wie dieser ihm verhasste dichterische Sprachgebrauch einen Mangel seines eigenen offenbart, obgleich beide – egal wie hochpräzise punziert – unzureichend bleiben. Jeder auf seine Art kann den Graben zwischen Wirklichkeit und Worten letztlich nicht dauerhaft überwinden.
Die Gaunersprache bedient sich bereitwillig der Misere, dass das »wahr« zu sein scheint, was gerade eine der streitenden Parteien als wahr ausgibt. Bachmanns berühmter Satz, »die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar« wurde gern vom ehemaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider zitiert. Verstanden hat er ihn nie. Der Satz meint: Die Wahrheit ist eine Zumutung. Ihre innere Struktur so schwierig, verworfen und unerklärlich, dass sie immer unerreichbar bleibt. Dennoch ist sie das Maß und die einzige Orientierung und kann deswegen niemandem erspart bleiben. Wir sind zum Ausblick ins Unmögliche gezwungen und verpflichtet. Nun, wer mit dieser teils bedauerlichen, teils paradoxen Einsicht nicht hadert, darf füglich ein Gauner oder eine Gaunerin genannt werden. Für den ehemaligen Kärntner Landeshauptmann war die Wahrheit immer ganz easy, nämlich jeweils das, was ihm in den Kram passte.
»War on Terror«
Alle drei Monate ist der französische Präsident mittlerweile gezwungen, dem islamistischen Terrorismus den Krieg zu erklären. Aber was erklärt er dabei wem? Die Unsinnigkeit dieser Sprachhandlung scheint längst mit Händen greifbar. Ingeborg Bachmann ahnte diese Entwicklung voraus bzw. sie war zu ihrer Zeit bereits evident. Sie sagte, Kriege können nicht mehr beendet werden, weil sie nie zuvor erklärt worden sind. Es kann kein Ende des »War on Terror« geben, genauso wenig, wie es ein Ende des Kampfes gegen die Mittelmäßigkeit gibt. Beides Exempel der Gaunersprache, letzteres dämlicher Managementsprech, ersteres tödliche Politik. In der Kriegserklärung wird deutlich, wie wichtig Sprache als Handlung ist (oder war). Jede formelle Kriegserklärung geschieht im Gedanken an den Friedensschluss, weil was erklärt wird bereits durch die Erklärung begrenzt wird. Heutige Kriege sind unerklärt. In weiten Teilen Afrikas (Sudan, Nigeria, Kongo etc.) wird teils seit vielen Jahrzehnten Krieg geführt. Hier hat sich bereits eine Kriegsökonomie und Kriegsgesellschaft ausgeprägt, die den Frieden nicht mehr schließen kann, da die sogenannten Friedensschlüsse nur mehr »Deals« von »Rackets« (also Gaunerbanden) sind, die sich nicht mehr an die getroffenen Vereinbarungen halten, sobald sie irgendwo einen größeren Vorteil für sich sehen. Die Mitglieder der Rackets sehen keinerlei Chance, sich selbst zu übersteigen, indem sie in einen Friedensschluss einwilligen, der mehr ist als sie selbst, also mehr als ihre Partikularinteressen. Dies können sie allein deswegen nicht mehr schaffen, weil ihnen – so würde Ingeborg Bachmann vermuten – ihr »Ich« längst abhandengekommen ist.
»Ein Tag wird kommen, an dem die Menschen schwarzgoldene Augen haben«
Die Einsicht in diesen Verlust des Ichs ermöglicht erst, die ganze Dimension unserer Tragik zu begreifen. Wir haben nicht einmal mehr uns selbst zur Hand, denn sogar unsere Selbstliebe plumpst wie ein Stein in den Diskurs der von den verschiedenen Gaunern aufgestellten Bedeutungsfallen. Kenneth Patchen: »Der Typ an der Bar kommt zu mir und will mir ›seine‹ Geschichte erzählen.« Das »seine« muss in Anführungszeichen stehen, denn was immer der eine arme Säufer dem anderen erzählen will, es kann nicht mehr authentisch sein, es kann in einer Welt umfassender Sprachverhexung nur das sein, was man halt so sagt. Keine Worte zu haben, um die eigene Not zu beschreiben, das ist die Hölle auf Erden. Salman Rushdie eröffnete die letztjährige Frankfurter Buchmesse mit der These »[Menschen] existieren, indem sie ihre Geschichte erzählen.« Diese literarische Naivität macht ihn zu dem schlechten Autor, der er ist. Sollen das übliche Gerede und all dessen tückischen Fallstricke, all seine feinen, systemerhaltenden Lügen überwunden werden, dann müsste nichts weniger, als eine radikal neue Sprache gefunden werden. Diese gigantische intellektuelle Leistung kann allerdings kaum je gelingen, abgesehen davon, dass eine radikal neue Sprache nicht verstanden werden würde.
Aber Ingeborg Bachmann gab nicht auf. Sie antwortete auf die Misere mit einer Utopie. Ein gesellschaftlicher Bezug kann niemals gänzlich aufgegeben werden und sollte es auch nicht. Menschen leben unter Menschen und werden deswegen ein Auskommen miteinander finden müssen. Und dies werden sie mittels einer Sprache tun, die ihnen hilft, sich untereinander zu vertragen. Für dieses Auskommen kann Dichtung eine bedeutende Hilfe leisten, indem sie den Weg zurück zum Ich ebnet. Ingeborg Bachmann entwarf für sich eine Rückkehr ins Gehäuse der Dichtung, indem das Ich einsam eingeschlossen verweilt und nicht mehr die allgemeinen Lügen der Gaunersprache ausposaunt. Gelingt dieser Rückzug auch nur zeitweilig, dann kann einem erneuerten Leben, einer befreiten Welt Raum geschaffen werden. Denn: »In der Einsamkeit des Bewusstseins liegt das bedeutende Faktum der Selbstgarantie aller Wahrheit: die Unfähigkeit des Ichs sich selbst zu belügen.«
»Ein Tag wird kommen, an dem die Menschen schwarzgoldene Augen haben, sie werden die Schönheit sehen, sie werden vom Schmutz befreit sein und von jeder Last, sie werden sich in die Lüfte heben, sie werden unter Wasser gehen, sie werden ihre Schwielen und Nöte vergessen. Ein Tag wird kommen, sie werden frei sein, es werden alle frei sein, auch von der Freiheit die sie gemeint haben.«
Nicht weniger als das. Leider wird wohl auch nichts weniger als diese utopische Umgestaltung ausreichen, um uns zu retten.
Eingestandenermaßen sind die hier angesprochenen Fragen bezüglich des Verhältnisses von Sprache, Politik, Wahrheit und Wirklichkeit sehr komplex und sogar kompliziert zu nennen. Dies liegt in der Natur der Sache. Dennoch hat Ingeborg Bachmann einen ganz einfachen Tipp für jene parat, denen sich nach diesen Ausführungen der Kopf dreht: Niemals die Sätze nachsprechen, die die Gesellschaft spricht, denn in dem, was alle sagen, zeigt sich nichts.
Zum Weiterlesen
So ziemlich alles von Ingeborg Bachmann empfiehlt sich zur Lektüre, im Zusammenhang ihrer Sprachkritik v. a. die Sammlung von Erzählungen »Das dreißigste Jahr« und die Essays und Interviews »Frankfurter Vorlesungen«, »Von den Linien der Wirklichkeit« und »Wir müssen wahre Sätze finden«. Alle sind bei Serie Piper (jüngst auch als E-Books) erschienen.
Für ein eher fachkundig interessiertes Publikum empfiehlt sich die Essay-Sammlung von Ingeborg Bachmanns Studienkollegen Michael Benedikt: »Kunst und Würde«, Wien: Turia und Kant 1994, 219 Seiten.
Eine Hörprobe Ingeborg Bachmanns findet sich in der Österreichischen Mediathek.