»In einer Kontroverse gibt es das PRO, und es gibt das CONTRA, und es gibt das Gemisch des CONTRA und des PRO … Doch Auschwitz, wir wiederholen es, ist kein Kolloquiumsthema; Auschwitz schließt die Dialoge und literarischen Gespräche aus; und allein die Idee, das PRO und das CONTRA einander gegenüberzustellen, hat hier etwas Schändliches und Höhnisches; diese Konfrontation ist eine schwerwiegende Ungebührlichkeit gegenüber den Gemarterten … Im übrigen ist der Nazismus keine ›Meinung‹, und wir dürfen es uns nicht zur Gewohnheit werden lassen, darüber mit seinen Advokaten zu diskutieren.«
Kein Vergessen, kein Verzeihen
Wer bisher mit Vladimir Jankélévitch (1903–1985) noch nicht oder nur wenig vertraut gewesen ist, darf sich anhand dieser Zeilen das Bild eines engagierten, unbestechlichen und unbeugsamen Linksintellektuellen machen. In seinem Essay »Verzeihen?« (Suhrkamp 2003), aus dem das Zitat stammt, machte er 1971 deutlich, dass es angesichts der beispiellosen Naziverbrechen keine Verjährung, weder ein Vergessen noch ein Verzeihen geben könne. Jankélévitch, der von 1941 bis 1944 in Toulouse aktiv in der Résistance war, und dessen Eltern die deutsche Besatzung gerade noch überlebten, blieb auch in seiner privilegierten Position als Professor für Moralphilosophie an der Sorbonne konsequent und mied jene Kolloquien, die u. a. »Meisterdenker Heideguerre« huldigten.
Andreas Vejvar von der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Herausgeber des nun vorliegenden Auswahlbandes »Zauber, Improvisation, Virtuosität«, bringt in seinem Nachwort Jankélévitchs Haltung auf den Punkt: »Erst die Moral, dann das ästhetische Vergnügen.« Um die »für Jankélévitch bezeichnende Verzahnung von Musik, Nachdenken und Tat« nachvollziehen zu können, trifft es sich besonders gut, dass der Band auch das Interview »Jankélévitch und das Beinahe-Ähnliche« enthält. Es war das letzte, wenige Tage vor seinem Tod am 6. Juni 1985 geführte, posthum in der »Libération« erschienene. Noch vor einigen Jahren nicht für den Band »Das Verzeihen« freigegeben, liegt es nun mit sechs weiteren Texten in deutscher Erstübersetzung von Ulrich Kunzmann vor. Die Auswahl der Texte präsentiert, nach »Die Musik und das Unaussprechliche« (Suhrkamp 2016), Jankélévitchs musikalisches Denken in bemerkenswert zugänglicher, beim Lesen oft mitreißender Weise.
Élan, Charme und Dissonanzen
Philosophisch blieb Jankélévitch in vielerlei Hinsicht der von Henri Bergson geprägten Lebensphilosophie verpflichtet. »Die Einfachheit. Über die Freude« stammt aus seinem Buch über Bergson von 1959. Das Leben als ein dauernder kreativer Prozess verstanden, getragen vom »Élan vital«, dem Lebensimpuls, der sich in immer neuen Formen manifestiert – das offenbart sich für Jankélévitch nicht nur in der Philosophie, sondern ganz besonders in der Musik. Als starke Stimme der Moderne ist Jankélévitch nicht frei von Essenzialisierungen. Genialischer Schöpfungswille und kreative Kraft wird großen Komponisten (nahezu ausschließlich Männern) zuerkannt. Jankélévitchs immer wiederkehrende Helden sind Claude Debussy, Gabriel Fauré, Federico Mompou und ganz besonders Franz Liszt. Die Komparative drängen immer wieder gerne zu Superlativen. Allerdings verliert sich Jankélévitch selbst nie im dionysischen Rausch, der zwar im Musikgenuss erlebt werden kann, aber nicht im Nachdenken über Musik zwangsweise ausgelebt werden muss. Äußerst wortgewandt schreibt er über das Unaussprechliche, höchst inspiriert über Inspiration und Improvisation, charmant über Zauber (Charme), virtuos über Virtuosität.
In seiner Würdigung Mompous liest sich das beispielsweise so: »Das dritte und das 13. Stück von ›Música callada‹ lassen alle beide eine hartnäckige falsche Note dissonant erklingen, ein Ges im dritten in B-Dur, ein Fis im 13. in Es-Dur, und die Kadenzen, die beharrlich zum Hauptton zurückführen, verströmen in beiden Stücken eine gewisse eindringliche Wehmut … die herzzerreißenden Akkorde ertönen im zwölften Stück wie Ausrufe. Die klagenden Dissonanzen seufzen im 15. Stück in einem zögernden Rhythmus. Das überaus hintersinnige 14. Stück ist beinahe atonal. (Aber nur beinahe! Denn tatsächlich ist es dies nicht.)« Nicht frei von Pathos bleibt Jankélévitch stets präzise. Diesen Eindruck verstärkt der sorgfältig editierte Text, der sämtliche erwähnte Musikstücke im Haupttext und in den Fußnoten ergänzend anführt. Das ergibt eine beachtliche Playlist, die während des Lesevergnügens auch Lust auf die eine oder andere klassische Entdeckungsreise weckt.
If it ain’t got verve…
Vom »Élan vital« kommt Jankélévitch mit Ésprit zur Verve, dieser vortrefflichen Stimmung, in der »der Mensch in schwungvoller Begeisterung« ist und »die schöpferischen Energien von selbst wirken«. Hat dieser Schwung auch Swing? Kein Zufall, dass Jankélévitchs Überlegungen zur Verve im Text »Über Improvisation« von 1955 auftauchen. Darin zitiert er affirmativ einen Artikel von 1934: »Mit großem Scharfblick definiert Blaise Pesquinne die Improvisation im Jazz durch die Annäherung, das heißt die Mehrdeutigkeit der Töne, Rhythmen und Klangfarben. Dieselbe Feststellung würde gewiss auch für die Rhapsodie im Allgemeinen gelten.« Eine weitere Auseinandersetzung mit Jazz oder vom Jazz beeinflussten Komponisten findet nicht statt. Als Meister der Rhapsodie geht es nicht um Gershwin, sondern um Liszt. Allerdings laden Elemente aus Jankélévitchs musikalischem Denken, ausgehend von Passagen wie jener, geradezu ein, auf andere Stile und Genres übertragen zu werden; und erscheinen jedenfalls weitaus anschlussfähiger als etwa Adornos polemische Perspektive auf den Jazz zu sein.
Und vielleicht ist das ja eine der verblüffendsten Erkenntnisse, die sich aus der Lektüre ergibt: Jemand, der quasi-metaphysisch die klassische Komposition als so ziemlich höchsten Ausdruck menschlicher Kreativität feiert, muss keineswegs zwangsläufig arrogant kontrastiv auf das Populäre herabblicken. Vielmehr lauscht auch Jankélévitch, der selbst ein hervorragender Pianist war, als Rhapsode und Improvisator »in der warmen Julinacht aufmerksam auf die Gassenhauer des Festes«. Und das womöglich nicht bloß, um sich ein paar volkstümliche Takte und Melodien anzueignen; um diese kunstmusikalisch zu sublimieren.
Oberflächliche Tiefe ist nicht seicht
Jankélévitch weiß auch – in diesem Punkt Nietzsches »Fröhlicher Wissenschaft« folgend – die »oberflächliche Tiefe« zu schätzen. (Etwas, das, nebenbei bemerkt, Klaus Walter dem aktuellen Album der Pet Shop Boys in einer Rezension attestierte.) Denn auch diese Tiefe ist eben nicht seicht. Wenn Jankélévitch ausgesprochen lustvoll dialektisch das Pro und Contra Virtuosität durchmisst, wird am Ende der »Tiefe der Oberflächlichkeit« die synthetisierende Ehre zuteil: »Der Schein sagt durchaus, was er sagt; er zeigt, was er zeigt; er singt, was er singt.« Wobei auffällt, dass er fast doppelt so viele Seiten lang Argumente und Aspekte contra Virtuosität entfaltet und dabei einige seiner pointiertesten Formulierungen hinterlässt.
»Meistens inspiriert der Größenwahn zu wahnsinnigen Steigerungen, und das frenetische Überbieten führt zu Gigantismus! Virtuosen, Kosmonauten und Meistersportler aller Kategorien rivalisieren in diesem Wettkampf um den unendlichen Superlativ, und die ›Weltpremiere‹. … Stellen wir nunmehr fest, dass die Übermacht tatsächlich Ohnmacht ist, dass der Reichtum eine grundlegende Armut verbirgt; Leere und haltlose Rhetorik sind die dialektische Kehrseite des Talents. Talent auf der Vorderseite, Bedürftigkeit und Geschwätz auf der Rückseite!« Unweigerlich muss man hier auch an hochgeputschte politische »Talente« denken. Und man kann sich dazu ausmalen, was Jankélévitch von Bayreuth und den Salzburger Festspielen samt dem hierzulande ganz besonders penetrant zelebrierten Personenkult um Karajan hielt, wenn er »das zum Spektakel gewordene Konzert« und die »Vergöttlichung des Ausführenden« kritisiert. Und freilich lassen sich auch Assoziationsketten zu diversen Artists im Popzirkus, zu den virtuosen Verirrungen in Prog-Rock, Metal, Fusion, neokonservativem Be-Bop sowie im R’n’B und HipHop knüpfen; also von Karajan bis Kanye West.
»Virtuosität« ist eine teilweise Übersetzung von Jankélévitchs Liszt-Buch von 1979. Liszt war einer der wenigen deutschsprachigen Komponisten, mit denen er sich nach dem Krieg noch auseinandersetzen wollte. »Die Orchester spielten Schubert, während man die Inhaftierten henkte«, mahnte er in »Verzeihen?«. Das konnte und wollte er nie vergessen. Niemals wieder wollte er »nach Deutschland fahren … und noch weniger nach Österreich!« Das Ausmaß der Naziverbrechen, wie massiv ihre Gewalt auch die zivilisatorischen Fundamente zerstört hatte, das konnte Jankélévitch auch deshalb so schonungslos identifizieren, weil er ebenso tief zu ergründen vermochte, wie sehr schöpferische Kraft das menschliche Leben lebenswert machen kann. Schließlich wird der Mensch nicht nur frei, sondern für die Freude geboren.
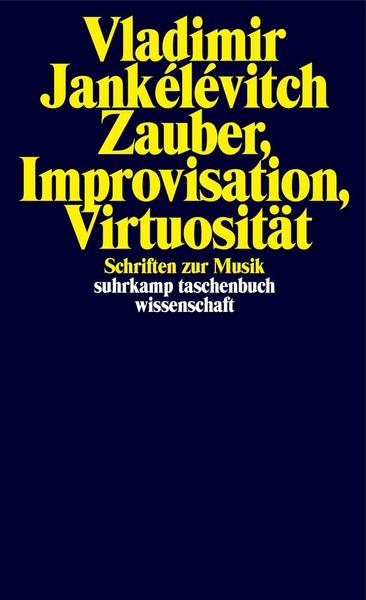
Link: https://www.suhrkamp.de/buecher/zauber_improvisation_virtuositaet-vladimir_jankelevitch_29871.html



















