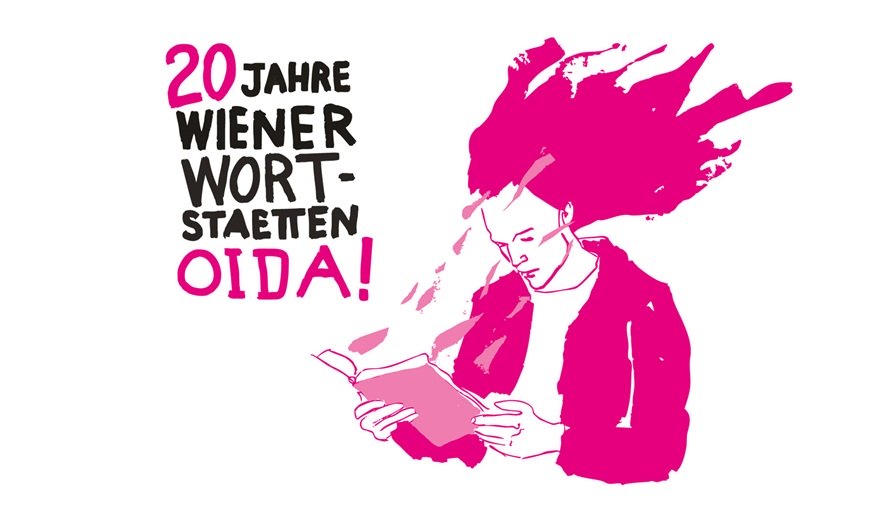Der Shuttlebus parkt vor dem Gemeindebau, der sich seinen Nachnamen mit dem historisch größten Schlachthof Wiens teilt. Obwohl der Schlachthof Sankt Marx 1848 errichtet wurde, also im Jahr der Erstveröffentlichung des »Kommunistischen Manifests«, ist er nicht nach dessen Autor Karl, sondern nach dem Heiligen Markus benannt. Da kann man nichts machen. Aber weil dort seit 1994 nicht mehr geschlachtet wird, fährt der Shuttlebus sowieso nicht nach Erdberg, sondern nach Zwettl. Genauer: zur Viehversteigerungshalle Zwettl. Denn dort wird zur »Rindsrevue« geladen, die unter der Titel-Trias »melken steigern ausnehmen« steht. Was das alles bedeutet, ist im Vorfeld keineswegs klar, aber die Liste der beteiligten Künstler*innen liest sich wie ein ganz vorzügliches Wochenmenü, und drum checkt man sich, ohne viel zu fackeln, ein Busticket.
Die Anreise erweist sich dabei bereits als der erste Act der Revue. Sebastian Brauneis, gegenwärtiger Filmregisseur und vermeintlich ehemaliger Fremdenführer, moderiert die Fahrt über das von Schullandwochenfahrten wohlbekannte Busmoderationsmikro. Er gibt Zahlen und Fakten zur niederösterreichischen Landschaft zum Besten, ruft zwischendurch Schätzfragen zur Massentierhaltung in Europa aus und teilt uns dann noch die heißesten News vom SPÖ-Parteitag mit: dass nämlich Hans Peter Doskozil zum neuen Chef der Sozialdemokratie gewählt wurde. Die Stimmung im Bus sinkt rapide, Excel-Gate erlöst uns erst zwei Tage später.

Zwettler Noise und Paso doble
Vor der Viehversteigerungshalle wartet, als der Wiener Bus zum Halten kommt, bereits das aus Zwettl und Umgebung angereiste Publikum. Dass die Zahl der lokalen Interessierten mindestens gleich groß ist wie die der aus der Hauptstadt Hergekommenen, spricht für eine Einladungspolitik, die den Veranstaltungsort nicht bloß als skurril-witzige Location betrachtet, sondern ihn, seine Nutzung und seine Umgebung als ge- und belebten Raum ernstnimmt und verhandelt. Dieser Anspruch geht bereits aus den ersten Sätzen der in bestem Zwettlerisch vorgebrachten Anmoderation von Marlene Hauser klar hervor und zieht sich durch den gesamten Abend. Dessen eineinhalb Stunden an Revue-Programm strotzen nur so vor Interdisziplinarität, Abseitigkeit und experimentellen Lärmereien, ohne dabei auch nur stellenweise willkürlich zusammengeschustert oder (dorthin ist es dann ja auch nicht mehr weit) abgehoben zu wirken.
Der Weg vom Parkplatz zur Halle wird von einem Marsch der autodidaktischen Blasmusikkapelle Academy of Fine Brass angeleitet und führt an der über dem Eingang des Gebäudes hockenden, mit Wasser gefüllte Gummihandschuhe melkenden, singenden Katarina Maria Trenk vorbei. In der Halle selbst klagt der Banjo-spielende Minotaurus Georg Haider über seine Einsamkeit im Labyrinth, direkt im Anschluss tanzt Julia Müllner mit stolpernden Kolleg*innen Paso doble und auf Flora Besenbäcks Zerflexen eines Wasserfasses unter Strobolicht und ohrenbetäubender Noise-Rendition von »Old MacDonald had a farm« folgt ein improvisiertes Fernsehkochshowgespräch über die Zubereitung der einzelnen, soeben aus dem zerlegten Fass gewonnenen Kuhkörperteile.

Zuletzt das Fressen, auch dann nicht die Moral
Die Elemente, aus denen die »Rindsrevue«, besteht, sorgen schon als einzelne beim Zuschauen für Spaß, Überraschung und Kurzweiligkeit. Und doch ist es nicht einfach ihre Addition, die die Qualität des Abends ausmacht. Was die Revue vielmehr als etwas Besonderes und Ungewohntes erfahrbar werden lässt, ist die Art und Weise, auf die all diese Einzelteile zusammengeklebt sind – also die konkrete Form, die das Kollektiv an Künstler*innen vor Ort erarbeitet hat, um sich gemeinsam dem Thema des Rinds zu nähern. Es wäre schließlich leicht, sich bei einem Format, das sich um Fleischproduktion und -konsum dreht, fürs Moralisieren zu entscheiden, der Konsumkritik zu verfallen oder als Kunst verkleidete Statistiken zu präsentieren. Oder aber das genaue Gegenteil zu tun und sich dem Entertainment zuliebe der unkritischen Affirmation eines die Umwelt zerstörenden Lebensstils hinzugeben.
Die »Rindsrevue« entgeht beiden Fallstricken, weil sie auf etwas ganz anderes aus ist. Ihr geht es darum, ein Verständnis dafür zu kultivieren, was Kunst abseits von pseudopolitischer Selbstpositionierung noch heißen kann. Der Abend erzeugt einen Zustand, in dem für eine kurze Weile anders Zeit verbracht, geschaut und gehört wird, als wir es sonst gewohnt sind. Das Rindsvieh ist dabei in erster Linie das motivische Bindeglied. Und kalt lässt es eine*n natürlich nicht, wenn beim Snacken der am Ende verteilten Wurstpralinen auf einmal die Tore der Halle aufgehen und das Publikum kauend den eingesperrt auf ihr Schicksal wartenden, wiederkäuenden Kühen gegenübersteht. Aber den Widerspruch muss man schon selbst aushalten. Die Show nimmt uns diese Aufgabe nicht ab. Sie tut auch nicht so, als könnte sie es, und aus diesem Bewusstsein für die eigene Rolle der Veranstaltung zieht sie bei aller Schwere des Themas ihre Leichtfüßigkeit.
Nach der Revue wird vor der Halle Bier verteilt, die Kantine ist offen und eine Boombox spielt Blasmusik. Das Plaudern im Zwettler Industriegebiet fühlt sich als genauso integraler Bestandteil des Gesamtprogramms an wie die vorangegangenen Tänze auf dem Sägespanboden oder Johannes Gierlingers Videoprojektion zur Kuh-Geschichte Europas. Um ein Uhr Früh schaukelt der Shuttlebus, der am späten Nachmittag aus Wien losgefahren ist, schließlich wieder vor dem Karl-Marx-Hof ein. An Bord transportiert er müde und gleichzeitig lustvoll sich setzende Eindrücke darüber, was Kunst abseits von halbentspanntem Galerieeröffnungsvernetzungsplausch, warenfetischisierender Marktförmigkeit oder selbstreferenzieller Kritik noch so heißen kann: nämlich Freude am undogmatisch kollaborativen Arbeiten, wohlüberlegte Skurrilität durch die Vermengung diversester Kontexte und vor allem den Wunsch, Zeit für eine Weile anders erfahrbar zu machen als im Rest des Alltags.
Link: https://www.viertelfestival.at/veranstaltung/2023/melken-steigern-ausnehmen/