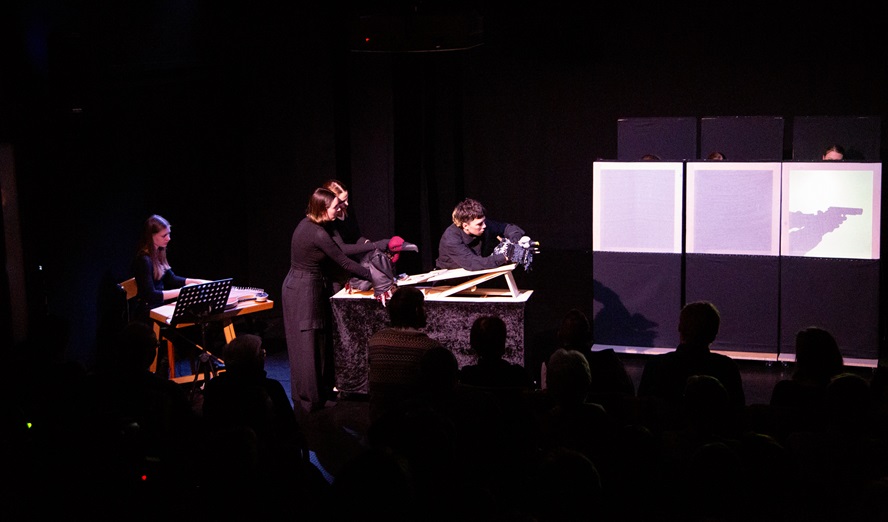Die Werke von Hermann Staudinger laden dazu ein, innezuhalten und genauer hinzusehen. Seine Malerei spielt mit Licht, Textur und Tiefe und entfaltet ihre Wirkung oft erst nach und nach. Geprägt von einer stillen, aber kraftvollen Energie, wirken die Bilder zugleich reduziert und voller Resonanz. Im Gespräch erzählt Staudinger von seiner Leidenschaft für reduzierte Mittel, seiner Faszination für die Natur und der feinen Kunst, Emotionen durch Material und Technik zu übertragen. Warum für ihn Zeichnen die ehrlichste Form der Kunst ist, wie der Wald und das Licht seine Prozesse prägen und welche barocken Inspirationen in seinen Werken mitschwingen, verrät er im Interview mit skug. Noch bis 1. Februar 2025 ist seine Ausstellung in der Galerie Amart zu sehen.
skug: Wie hat deine künstlerische Reise begonnen?
Hermann Staudinger: Wahrscheinlich vor meiner Geburt. Aber der entscheidende Moment war 1990, als ich mit 27 Jahren für drei Monate nach New York fuhr. Dort tauchte ich in die Kunstszene ein, mied bewusst Österreicher und erlebte Neues. Im Museum of Modern Art sah ich mein erstes Werk von Ad Reinhardt, einem abstrakten Expressionisten. Seine Black Paintings, die sich bei genauem Hinsehen in unterschiedlich gemischten Schwarztönen auflösen, haben mich tief berührt. Vor lauter erlebter Schönheit kamen mir die Tränen. In diesem Moment begriff ich, was es heißt, Künstler zu sein.
Diese Resonanz zu erzeugen?
Und diese Energie zu übertragen.
Wenn du von Energie sprichst, meinst du dann eine Idee, die du im Vorfeld zu einem Motiv hast? Oder ist es eher die Sache selbst in der Welt, die diese Energie auslöst?
Ich glaube, dass jeder von uns mit einer eigenen Energie auf die Welt kommt, und auf die greifst du immer wieder zurück. An einem Tag arbeitest du mit Ton, am nächsten mit Öl und Malerei, aber ich denke, du kommst immer wieder zum selben Punkt zurück.

Warum war das bei dir etwas Bildendes und nicht Ausdrucksformen wie Theater oder Musik?
Das hat mir schon als Kind entsprochen. Man kann für sich sein und ist trotzdem nicht allein. Man ist nicht von dieser Welt, aber dennoch genau in der Mitte.
Ist es eine Transzendenz, die du zu erreichen versuchst?
Vielleicht ist es eher eine Immanenz: etwas, das hineingeht, nicht darüber hinaus. Ich habe einmal mit Nitsch zusammengearbeitet und ein paar Schüttbilder auf Gold gemacht. Er sprach immer vom Grundexzess. Damals habe ich ihm geschrieben: »In Wirklichkeit, wenn dich deine Freundin am Fingernagel berührt oder ein Lichtstrahl einfällt – das sind die kleinen Dinge, bei denen du auf die andere Seite blickst. Das ist für mich kein Grundexzess, sondern eher ein Grundtranszess.«
Schön gesagt. Und die andere Seite, von der du sprichst: Ist sie Teil der realen Welt?
Ja, sie ist Teil der realen Welt. Ohne diese andere Seite wäre die reale Welt nur tönernes Erz. Es gäbe keinen Geist, keinen Esprit, keine Freude. Es gäbe nichts »extra«. Alles wäre nur eine pragmatische Funktionalitätsgleichung, die vielleicht schön ist, wenn sie aufgeht, aber eigentlich fad bleibt.
Hattest du jemals das Gefühl, dich in deiner künstlerischen Praxis auf dieser anderen Seite zu verlieren? Oder gibt es Dinge, die dich zurückholen?
Dieses Grenzüberschreiten muss man gezielt einsetzen, es darf nicht zum Gift mutieren. Wenn man zu lange weg ist, ist das auch nicht gut. Aber meiner Erfahrung nach ist das Wiederauftauchen etwas, das man lernt. Dann weißt du auch: Jetzt muss ich wieder Laufen gehen, in die Kirche oder meditieren. Ganz normale Dinge. Jeder kann das für sich gestalten, aber für mich gehört die Rückkehr zu einem Ursprung dazu. Das sind jetzt alles so katholisch geprägte Wörter, aber immer wieder einen Sammelpunkt zu finden, halte ich für essenziell. Ohne das werden die eigenen Arbeiten auch irgendwann seltsam.
Oder zerfließt man?
Man verliert sich in den Aufgaben, die die Welt an einen heranträgt, die reizvoll sein können. Aber es gibt auch so etwas wie Auftragslosigkeit. Da wird es wirklich spannend. Heiner Müller hat einmal einen schönen Satz gesagt: »Wenn die sozioökonomische Frage gelöst ist, beginnt das eigentliche Drama des Menschen.«

Denn dann müssen sich alle mit sich selbst beschäftigen?
Ja, wenn das Existenzielle gelöst ist: Wer ist man dann?
Wie spielt das Material, mit dem du arbeitest, in diese Ideenwelt hinein?
Ich arbeite mit Bleistift und Blattgold. Für mich ist Zeichnen die ehrlichste Form der Kunst. Ich mag reduzierte Mittel – und Gold ist an sich ein barockes Mittel, das oft überbordend verwendet wurde. Aber letztlich ist Gold nur ein Material.
Die Bedeutung, die es erhalten hat, ist vom Menschen gemacht.
Es ist alles nur menschengemacht!
Wie bereitest du deine Werke vor, bevor sie ihre Wirkung entfalten können?
Die meisten Bilder kommen von Fotos, die als Schwarz-Weiß-Kopie auf Papier ausgeprintet werden. Die pause ich mit Bleistift durch. Das ist ganz einfach. In Wirklichkeit ist es wie ein Malbuch auszufüllen. Ich habe eine Vorlage in Schwarz-Weiß und pausiere sie minutiös auf die Goldfläche. Dafür wird nur ein Papier darüber gespannt. Es braucht so wenig!
Dafür sieht das Endprodukt sehr aufwendig aus.
Es ist auch aufwendig! Es steckt viel Lebenszeit in diesen Strichen. Aber genau das mag ich so gern: Du triffst einmal eine Entscheidung und ziehst sie durch – das kann bis zu zwei Monate dauern. Bei anderen Künstlern ist es oft ein ständiges »Jetzt, Jetzt, Jetzt«. Ich bevorzuge es, in meinem Prozess eine Ewigkeit zu betreten und mich dort auszubreiten.
Ist es nicht immer ein Spiel zwischen Expression und Entfremdung der Welt?
Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder, sondern ein gegenseitiges Ergänzen. Die Suche nach der endgültigen Expression im Alltag der Kunst halte ich für Unsinn. Das interessiert mich nicht. Ich will etwas schaffen, das ein bestimmtes Gefühl ausdrückt und ausstrahlt – ein Gefühl, das nicht »Ich« sagt, sondern einfach da ist.
Es ist ein Gefühl, das sich nicht ständig behauptet, sondern den Raum für die Betrachtenden offenlässt?
Genau. Es ist wie ein offener Tisch, auf dem vieles liegt, von dem man sich etwas nehmen kann.

Welche Rolle spielt die Technik, die du anwendest, für die Interpretation des Motivs?
Mir ist es wichtig, dass die Oberfläche eine Ähnlichkeit mit einem Tierfell hat – unzählige kleine Einheiten, die ein Gesamtbild erzeugen. Vielleicht ist es eine Suche nach Unendlichkeit, aber in dieser Wiederholung fühle ich mich wohl. Sich in ein geistiges Feld hineinzuarbeiten, finde ich einfach gut. Das mag ich.
Für mich klingt das, als wolltest du dich in die »Haut« der Dinge einnähen und ihnen eine neue Form geben.
Aber die Form ist nicht der Punkt. Es sind nicht zehn Striche, sondern zehntausend. Das Endprodukt ist natürlich ein Bild, das man kaufen, aufhängen und betrachten kann. Aber es ist nicht der Gestus eines Malerfürsten, der sagt: »Ich habe mit meinem Pinsel die Welt erschaffen.« Das interessiert mich nicht. Es geht eher um eine subtile Beschreibung, ähnlich wie an einem ruhigen Tag am Meer, wenn man das Plätschern der Wellen hört.
Wie entscheidest du, was du als dieses Plätschern verwendest?
Die Motive müssen mich ansprechen. Ich arbeite viel mit Fotografien, vor allem mit Bildern, die ich auf Spaziergängen in meiner Umgebung aufgenommen habe. Natürlich habe ich auch Goldflächen, die völlig abbildungslos sind.
Bist du viel in der Natur?
Ja, ich habe zwei Hunde und wollte schon immer die Jahreszeiten bewusst erleben. Mit ihnen bekomme ich das jetzt mit – ich gehe zweimal täglich mindestens 20 Minuten nach draußen. Wir wohnen mitten im Wienerwald. Hunde eröffnen dir eine andere Welt. Wie sie schnüffeln und die Umgebung wahrnehmen – das verstärkt auch die eigene Sensibilität. Es ist ein Austausch.

Ein anderer Aspekt, der bei dir stark hervortritt, ist das Licht. Inwiefern ist Licht für dich ein Richtungsweiser?
Es gibt ein schönes Zitat von Rabbi Nachman, einem chassidischen Lehrer. Er sagte: »Wie die Hand, vors Auge gehalten, den größten Berg verdeckt, so deckt das kleine irdische Leben dem Blick die ungeheuren Lichter und Geheimnisse, deren die Welt voll ist; und wer es vor seinen Augen wegziehen kann, wie man eine Hand wegzieht, der schaut das großer Leuchten des Weltinneren«. Dem folge ich irgendwie. Jede Art von Leuchten ist faszinierend – sei es das Lachen eines Menschen, die Sonne nach einer langen Nebelzeit oder ein freudig hüpfender Hund.
Das Licht spielt in zweierlei Weise eine Rolle: Wie du es wahrnimmst und wie es am Bild reagiert. Lenkst du das bewusst?
Das hat sich entwickelt. Meine erste Arbeit in der Goldtechnik entstand für eine Gruppenausstellung einmal kurz vor Weihnachten, als ich keine Zeit mehr hatte, zum Drucker zu gehen. Eigentlich wollte ich einen Siebdruck auf Gold machen. Der Drucker hatte keine Zeit, also beschloss ich, das Bild mit Schwarz- oder Blaupapier auf Gold durchzupausen. Nichts hat aber funktioniert, also habe ich – frei nach Beuys: »Hauptsache, es ist gemacht« – ein Bild geschaffen, das man zunächst nicht sehen konnte. Zwei Monate später, als der Mond durchs Fenster fiel, sah ich plötzlich etwas. Das hat mir gefallen. Es ist ein seltenes Bild, weil es nicht »einfach so« sichtbar ist. Es verändert sich ständig, fast wie im echten Leben. Dieselbe Sache sieht immer anders aus. Es ist eine Illusion, zu glauben, dass Dinge fest sind. Unser »Bordcomputer« kann das alles gar nicht verarbeiten. Wir machen in Wirklichkeit immer nur kurze »Schüleraufsätze«.
Was mich immer am meisten fasziniert hat, ist, dass deine Welt vermutlich immer anders aussehen wird als meine – aus dem Sehen und Wahrnehmen heraus.
Das stimmt. Und gleichzeitig stimmt es überhaupt nicht, weil wir alle eine ähnliche Art zu sehen und zu denken haben. Wir sind Menschen und keine Gorillas, auch wenn unser Erbmaterial zu 99,9 Prozent übereinstimmt. In Wirklichkeit ist genau das der Grund, warum Kunst funktioniert: Sie spricht uns auf einer Ebene an, die verbindend ist.
Aber warum löst ein Kunstwerk bei einer Person etwas aus und bei einer anderen nicht?
Das ist wahr, aber es gibt Kunstwerke wie die »Mona Lisa« oder den »Johannes der Täufer« von Leonardo da Vinci – er hat menschliche Zuneigung in einem Bild verewigt. Und ob du willst oder nicht, es packt dich. Das hat eine besondere Kraft. Natürlich kann man sich für moderne Formen begeistern – Geschmäcker sind verschieden. Aber diese grundlegende Energie der Kunst, die kennen wir alle.

Denkst du, dass in der Moderne etwas verloren gegangen ist?
Nein. Für mich habe ich das damals bei Ad Reinhardt verstanden: Es geht in der Kunst um die Übertragung. Ob du das mit einem Pappendeckel, einem Modell oder in einem Theaterstück erzeugst, ist letztlich egal. Entscheidend ist: Gibt es eine Energie, die sich mitteilen möchte? Wenn nicht, bleibt es eine fade Geschichte.
Dann will das Kunstwerk zu sehr einfach nur es selbst sein.
Genau. Es gibt z. B. Künstler, die irgendwann ein »Strickmuster« gefunden haben, das funktioniert – und sie machen immer so weiter.
Wie vermeidest du es, in so ein Muster zu geraten?
Ich glaube, mir würde wirklich körperlich schlecht werden. Natürlich sind meine Arbeiten ähnlich, aber ich probiere immer wieder neue Legierungen oder Formate aus.
Wie hältst du es für dich frisch, sodass dir nicht langweilig wird?
Gegen eine gepflegte Art von Langeweile habe ich nichts einzuwenden. Ich glaube nicht, dass wir die Welt ständig neu erfinden müssen – alles ist ohnehin schon da. Schlimm wäre es, wenn meine Umgebung oder meine Käufer sagen würden: »Das mag ich jetzt nicht mehr.« Dann müsste ich mir etwas anderes überlegen. Ich habe inzwischen auch ein paar Bilder über Wasser gemacht, aber ich brauche kein gänzlich neues Programm.
Was ist es am Wald, das dich immer wieder zurückkommen lässt?
Der Wald spiegelt für mich so etwas wie ein Unmöglichkeitsthema. Erstens gibt es ihn viel länger, als es uns gibt. Und dieser Blick in den Wald, diese hunderttausend Blätter, die einfach nicht aufhören – dieses Nicht-Enden-Wollende finde ich faszinierend. Es bleibt auch nicht bei einem einzelnen Baum stehen. Ein Baum erzählt von der Schönheit des Lebens und der Schönheit der anderen Bäume. Es ist eine vielschichtige Sache. Der Wald ist jeden Tag anders, auch durch das Licht oder die Luft. Und man selbst beruhigt sich. Der Wald steht für ein Bewusstsein, das netzartig funktioniert, nicht spitzenartig. Es ist nicht wie ein Berg, der sagt: »Ich!«

Rhizomatisch?
Genau! In der indischen Mythologie gibt es den Begriff des »Netzwerks«, Indras Netz. Wir sehen vom Rhizom immer nur ein paar auftauchende Teile, aber nie das Ganze.
Mich hat die Rhizom-Idee immer schon fasziniert: Ein Netz, das uns alle umgibt.
Ja, wie eine geflechtartige Energie, die uns alle trägt.
Genau, es ist wie ein Netz, das über allem liegt …
Und das wir alle auch sind …
… unsere Gedanken, unsere Gefühle. Und natürlich sind das nur Ideen. Es gibt kein wirkliches Netz.
Wir beschäftigen uns ständig mit Hilfskonstruktionen. Rupert Sheldrake spricht von morphischen Feldern – etwa, wenn zwei Schimpansenpopulationen, die voneinander getrennt sind, gleichzeitig lernen, wie man Kokosnüsse spaltet. Ein bisschen an diesem Netz zu arbeiten und sich darin geborgen zu fühlen, gehört für mich zu den schönsten Dingen im Leben.
Hat deine Kunst einen historischen Bezug?
Die Idee, mit Gold zu arbeiten, wurde von barocken Künstlern ähnlich umgesetzt. Es ist auffallend, wie goldene Räume – wie die Jesuitenkirche in Wien oder die Mariazeller Basilika – durch moderne Renovierungen mit Strahlern ausgestattet wurden, die den Effekt zerstören. Ursprünglich waren diese Gebäude für Dämmerlicht konzipiert. Da entdeckte man eine Goldreflexion nach der anderen und verstand so den Raum.
Ein allmähliches Entschlüsseln des Raumes.
Genau. Gold darfst du übrigens nicht direkt anstrahlen. Jedes Mal, wenn ich zu einer meiner Ausstellung komme, schalte ich das Licht aus.
Möchtest du mit deinen Werken eine Bewegung, ein Erwachen oder eine bestimmte Funktion erfüllen? Oder lässt du das offen?
Eine bemerkenswerte Frage! Ich denke, was mich bewegt, bewegt auch andere. Es freut mich, etwas Schönes in die Welt gebracht zu haben, das kommuniziert. Das ist wunderbar. Sonst wäre ich kein Künstler, sondern Hausmeister. Wobei: Auch ein Hausmeister freut sich über einen schönen Boden!