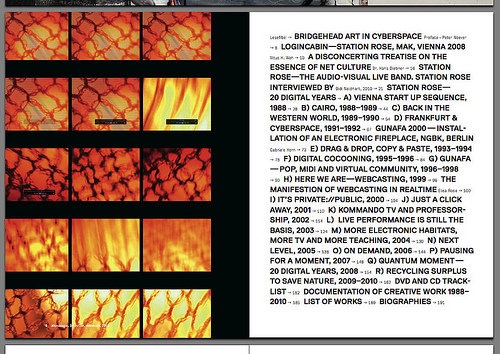STR haben durch das »Web-2.0.-Gekrähe« (Gary Danner) wieder ihre analogen Körper ausgepackt. Die Pioniere des Cyberspace kolonisieren nun die unerforschten Schnittstellen zwischen haptischen und digitalen Ästhetiken. Wie immer schwer geschichtsbewusst, ist ein Gespräch mit STR eine Tour de force in die avancierte Popkultur seit den 1960er Jahren. In »20 Digital Years Plus«, eine Art Opus Magnum europäischer AV-Kunst, stecken STR wohldokumentiert den Beginn der Station 1988 in Wiens Margaretenstraße, ihre prägenden Erlebnisse in Kairo ein Jahr später, die Ûbersiedlung in den Medien-Hub Frankfurt und schließlich die langjährige Urbarmachung des Cyberspace ab. Beiträge von Peter Noever, Didi Neidhart und systemtheoretische Ûberlegungen von Hans Diebner sorgen für entsprechenden Denk-Input.
Gary Danner: Ich hatte in Oberösterreich diverse Schülerbands. Aber als ich dann nach Wien ge- gangen bin, hat meine Musikkarriere professionelle Züge angenommen. Ich habe mit Ronnie Urini The Vogue gegründet, eine Band, die der Punkszene zuzurechnen war. Punk war damals sehr weit gefasst, sie beinhaltete vor allem Leute, die sich dem Diktat des Blues nicht beugten. Das hatte die verschiedensten Auswirkungen. Es gab solche, die sich stark am englischen Punk-Idiom orientierten, aber auch solche, die sehr avancierte Elektronikmusik machten wie z.B. ZYX. Wir haben uns an der Punk- und Garagebewegung der späten 1960er orientiert. Das Ganze war recht kurz gehalten, die Nummern meist nur um die drei Minuten lang, ziemlich schnell und ziemlich aggressiv.
Mitte der 1980er hatte Wien einen Durchhänger. Ich hatte mit meiner damaligen Formation Die Nervösen Vögel oft Konzerte in London und bei Plan Gitarre gespielt. Diese Zeit kann man mit der heutigen überhaupt nicht vergleichen, Wien ist ja mittlerweile international verortet. Jeder kennt zumindest drei elektronische Acts aus Wien. Damals war das eine extrem kleine Szene, die im Aus- land und da besonders in Deutschland verpönt war oder zumindest geschmäht wurde. Durch den tragischen Tod des Nervöse-Vögel-Bassisten Christian Brandl habe ich angefangen, das Bandkonzept in Frage zu stellen. Das passte auch mit meinem Abschluss auf der Angewandten zusammen. Bereits 1986 hatte ich mir ein Sampling-Keyboard besorgt, ein Jahr später habe ich aufgehört, ernsthaft mit Bands zu arbeiten. Da kam es mir sehr recht, dass Elisa das Konzept der Station hatte, bei der es nicht um Musikfixiertheit ging, sondern ich war Teil eines größeren Ganzen.
Elisa Rose: Wir sind immer fünf Jahre früher mit etwas dran und wissen oft gar nicht, in welcher Zeit wir uns aufhalten. Vor der Gründung von STR haben wir auf der Angewandten gemeinsam bei Oswald Oberhuber studiert. Ich habe ursprünglich auch bei Karl Lagerfeld Mode studiert. Ich empfand die Modeszene als unbefriedigend, weil sie stark schwul dominiert ist und man sich mit einem Mann- Frau-Ansatz schwer tut. Am Ende unserer Ausbildung mit Medienkunst, Mode und Musik mussten wir realisieren, dass es überhaupt kein Feld für uns gibt. Die Station war schließlich der Startschuss.
Ich finde es bemerkenswert, wie zeitlos und wie nach wie vor aktuell die ganz frühe STR-Phase ist. Als wir 1991 in Kairo waren, mussten wir feststellen, dass in Europa praktisch niemand an arabischer Kunst interessiert war und das Nicht-Figurale des Orients überhaupt nicht ankam. Als Band waren wir nie an dem Pop-Gestus des Ausstellens des Künstlersubjekts interessiert sondern an abstrakten Patterns. Und das hat sich natürlich perfekt mit den Computer-Samples vermischt. Ich denke, dass sehr viele aus der VJ- und Neue-Medien-Szene ganz schnell, wie die Deutschen sagen, ihre Haus- aufgaben machen müssen, weil es nicht geht, dass jemand denkt, VJ-Kultur habe vor fünf Jahren angefangen, wenn wir das schon 1988/89 in Clubs gemacht haben.
GD: Generell kann man sagen, bei STR gibt es eine strikte Kompetenzentrennung. Die Konzepte ent- stehen gemeinsam, jeder hat 50:50 genauso viel Gewicht. Bei der Ausarbeitung oder Schaffung einer audiovisuellen Domäne teilt sich das aber wieder: Elisa ist für alles Sichtbare verantwortlich, ich schaffe und produziere allein die Musik. Das ergibt seit mehr als zwanzig Jahren ein synergetisches Ganzes. Wir haben festgestellt, wie wichtig diese Kompetenzentrennung ist. Spannend ist auch, und darin wurden wir von Timothy Leary ideologisch bestärkt, die Male-Female-Sache. Nämlich dass man als Mann-Frau im elektronischen Raum schnell sehr weit kommen kann.
Warum ist STR kein VJing?
GD: Der Unterschied zwischen STR und VJing ist, dass bei uns Ton und Bild zur selben Zeit und auf derselben Stelle passieren. VJing reagiert ja meist auf eine vorgefertigte Musik. In unserem Studio ist die Situation ähnlich wie bei einer Band, nur dass nicht Bass, Schlagzeug und Gitarre herumstehen sondern ich sitze über MIDI vernetzt neben Elisas Workstation. Wie hatten nie ein Konzeptpapier sondern wir jammen drauf los. Nach gut drei bis vier Stunden steht dann meist das audiovisuelle Grund-»Riff«.
ER: Klar werden bei dem wegdriftenden Musikmarkt Fusionen mit Bild-Künstlern geschlossen. So nach dem Motto dass sich Elektronikmusiker oder DJs denken, dass sie sich ganz schnell einen VJ besorgen müssen, damit im Hintergrund eine visuelle Tapete läuft. Bereits 1991 hatten wir bei unseren Gunafa-Clubbings in Frankfurt mit vier Projektionen, Musik, Bildcomputern und Internet gearbeitet. Der Einfachheit halber wurde dieses Konzept viel später von anderen auf DJs plus VJs herunterreduziert.
Ich habe in den letzten Jahren viele Projekte gesehen, die an dieser audiovisuellen Schnittstelle arbeiten, etwa Carsten Nicolai oder Ryoji Ikeda. Diese minimalistische Ästhetik scheint zu einer Art common sense in der aktuellen Audiovisionskunst geworden zu sein.
ER: Carsten Nicolai ist ja auch bildender Künstler. Es gibt sicher Schnittstellen hinsichtlich der Umsetzung zwischen ihm und uns. Aber es ist sehr männlich orientiert. Raster-Noton wollte einmal etwas von STR herausbringen, haben es dann aber nicht getan, weil ich zu viele Farben verwendet habe. Wenn sie sich trauen würden, aus diesen juvenilen monochromen Flächen herauszugehen, würde ich das spannend finden.
GD: Es ist »etwas« nicht automatisch minimal, nur weil es wenig Ideen hat. Außerdem, und das finde ich sehr wichtig: Ich glaube nicht an eine Universalbegabung. Aus mehr als zwanzig Jahren Erfahrung weiß ich, dass jemand entweder für eine Musik- oder für eine Bildsprache geeignet ist. Das sind zwei verschiedene Gehirnstränge. Bei Nicolai werden oft physikalische Naturgesetze visualisiert und das interessiert mich nur peripher. Bei Kunst geht es schon um Synergie.
Deswegen habe ich ja auch Bands wie Granular Synthesis oder Metamkine so spannend gefunden …
ER: Granular Synthesis sind sozusagen mein kleiner Bruder. Problematisch finde ich mittlerweile, dass sich Live-Videokunst derart auf einen Festivalkontext ghettoisiert hat. Die meisten haben es trotzdem nicht geschafft, in der Kunst zu landen und haben sich über kurz oder lang aufgelöst. Unser Ansatz war ja immer, dass es sowohl im Musik- wie im Kunstkontext stattfinden kann. Im Endeffekt sind es zwei verschiedene Szenen mit zwei beinahe unterschiedlichen Menschengruppen oder Fans. Offensichtlich gehen diese beiden Ansätze mittlerweile doch zusammen, es hat aber mehr als zwanzig Jahre gedauert. Am Anfang wusste ja keiner, wie er’s nun einteilen soll. Auch die Umsetzung im Kunstmarkt war überfordert, weil man nicht wusste, wie oder was man verkaufen kann. Es war die Angst vor Performancekunst aus den 1970ern. In unserem Buch haben wir erklärt, dass man von STR immer schon etwas Physisches haben konnte.
Wie kann man Performance verkaufen? Ich kann mir vorstellen, dass wenn man in der Audiovision arbeitet, sich der Kunstmarkt fragt, wie daraus ein kaufbares Kunstobjekt zu generieren ist, also eine ökonomische Verwertung. Provokant gefragt: STR stehen seit zwanzig Jahren für Digitalität, für das Internet, für den Cyberspace. Und dann bringt ihr ein Buch heraus, das ja nun nicht das allerneueste Medium ist? wie könnte eine Zusammenfassung, wie sie im Buch passiert ist, in einem digitalen Medium aussehen?
ER: Das haben wir ja vorher mit unserer STR-Datenbank gemacht. Es geht dabei um die Idee eines »inverse publishing«. Nach der Login-Cabin haben wir uns überlegt, wie wir diese Datenbank in ein anderes Medium rückübersetzen können. Ich finde Bücher völlig zeitlos, es bietet die Möglichkeit, sich in Ruhe einzulesen.
GD: Wir haben 2007 mit der Login Cabin begonnen, einer 3,3 Tonnen schweren Medienskulptur, die dann 2008 im MAK aufgestellt wurde. Das sind der Spaß und die Freude, wieder mit analoger Materie umzugehen. Ich habe wieder total Freude daran, Gitarre zu spielen, Elisa hat wieder Freude daran, mit haptischen Materialien zu arbeiten. Das heißt nicht, dass wir in Bands spielen oder Bilder malen. Aber diese Web-2.0-Euphorie geht uns schon ziemlich auf den Zeiger. Die zwanzig Jahre STR-Geschichte zeigen auch, dass wir schnell von etwas gelangweilt sind, wenn es Mainstream wird. Als vor fünf Jahren dieses Web-2.0-Gekrähe losgegangen ist, haben wir uns gedacht, dass der Cyberspace wirklich so ausarten wird, wie wir das vor zwanzig Jahren befürchtet hatten. Das wird sich sicher wieder legen und dann können wir unsere digitalen Körper wieder in Anspruch nehmen. Unser derzeitiger analoger Zugang ist die Subversion der Mainstreamisierung des Netzes.
ER: So wie wir von den Performancekünstlern der 1970er lernen mussten, finde ich, muss die aktuelle VJ-Kultur von uns lernen. Außerdem: Es muss immer etwas geben, dass sich die Leute kaufen können, man muss etwas besitzen können. Es gibt keinen Markt, der bessere Renditen abwirft als der Kunstmarkt und es gibt ja nichts Tolleres, als sich Kunst zu kaufen. Man kann sich den Moment der ursprünglichen Komposition kaufen.
Ich glaube, dass sich mittlerweile das Analoge neben dem Digitalen behaupten konnte. Ende der 1990er sah es ja so aus, als ob das Analoge völlig antiquiert sei. Es gibt einen derartigen Fetischismus zum Analogen, gerade beispielsweise am Buchmarkt: welche Papierwechsel, welche Einbände, Neonfarbe im Innencover. Diese Entwicklung kam symbiotisch mit der des Netzes. Ich bin dem Stoff als Material wahrscheinlich wegen meiner Mode-Sache treu geblieben. Ich wollte immer schon auf Stoff drucken, nur war das früher unbezahlbar. Man musste ganze Stoffballen bedrucken. Jetzt kann ich einen Zehn-Zentimeter-Schnipsel in Auftrag geben und verwende getragene Strumpf- hosen von mir, die ich dann als Wollknäuel verstricke. Es kommt immer ein Original dabei heraus.
Ihr verfolgt das Netz ja schon sehr lange. Wie schätzt ihr aktuelle Tendenzen und Entwicklungen des Cyberspace ein? Stichwort Web 2.0, social media, Facebook. Auch hinsichtlich Privatheit vs. Öffentlichkeit, was bei auch ja auch ein wichtiges Thema ist. Es scheint ja so zu sein, dass offizielle und private Kontrolle durch digitale Medien sehr weit fortgeschritten ist. Indes nicht ein Szenario à la »big brother is watching you« sondern eines, in dem à la »Brave New World« Kontrolle Spaß macht.
GD: Das Netz ist bei Otto Normalverbraucher angekommen. Da haben wir den Salat. Es ist einfach so, dass nicht jeder Mensch kreativ ist und nicht jeder Mensch ist ein Künstler. Wir als Avantgardisten haben nun mit dem zu tun, welche Wendungen das Netz in diesen Jahren genommen hat. Da ist viel Schuld bei den Netzkritikern zu suchen, die Mitte der 1990er auftauchten und nichts Besseres zu tun hatten, als sich als Netzkünstler zu sehen und ihre Hausaufgaben nicht zu machen. Sie haben auf irgendwelchen Medienfestivals unschlüssige Konzepte präsentiert, anstatt dass sie in den Under- ground gegangen oder politisch geworden wären. Sie haben Netzkünstler der ersten Stunde, und auch und vor allem jene aus Kalifornien, verunglimpft und versucht, ästhetische Maßregelungen aufzu- stellen. Die Früchte dieser Versäumnisse sind genau die, die du jetzt aufgezählt hast.
Unsere »Holz-Phase« mit Buch und Login Cabin ist natürlich eine Reaktion darauf und der Versuch, ein Standbein auch außerhalb des Netzes zu schaffen. Es braucht keine Leute, die Künstlern gegen- über Profilierungsneurosen haben, sondern sich wirklich als Netzaktivisten sehen, die gegen diese Kommerzialisierung ankämpfen. Zurzeit ist es eine wirklich schwierige Ûbergangsphase. Die Ûber- macht des Kommerzes, und wir sitzen zu allem Ûberfluss auch noch in Frankfurt, kommt uns immens vor.
ER: Ich war sicher eine der ersten Frauen, die das Netz in ihre Kunst integriert hat. Ich finde, dort ist nach wie vor eine ausgeprägte Frauenfeindlichkeit zu spüren. Man will sofort den Ûbervater, den man fragen kann: »Was tun wir da eigentlich?« Die sollen nicht diesen Ûbervater fragen, sondern mich. Die Leute müssen sich daran gewöhnen, auch auf Spezialistinnen zu hören, ohne dass man dafür gleich Cyber-Feministin sein muss.
Es ist insofern eine sehr komplexe Situation, weil nie etwas aus dem Netz verschwindet, es ist nicht möglich, etwas zu löschen. Es muss ein System gefunden werden, in dem man bestimmte Dinge öffentlich macht und Einiges privat hält. Wenn man nicht aufpasst, kommen Leute, die versuchen, einem die Angst vor dem Cyberspace zu nehmen und daraus Profit zu schlagen. Dann treten Tritt- brettfahrer auf den Plan, die zu jeder Fernsehsendung eingeladen werden wie Sascha Lobo, der den Begriff der »digitalen Boheme« zwölf Jahre später von uns gestohlen und 2006 damit zu hausieren begonnen hat. Es geht aber nicht ums Ausziehen, sondern ums Anziehen. Das ist mittlerweile in der Performance genauso: Was nackt ist, wird nackt bleiben, weil es nicht mehr gelöscht werden kann. Daher muss es eine Ästhetik darüber geben, wie viel und was man herzeigen will und was nicht. Durch unsere zweihundert Web-TV-Sendungen haben wir herausgefunden, wie viel man vom Privaten herzeigen kann und was eben nicht. Besonders als Frau, wenn ich alles selber mache, muss ich mir immer vergegenwärtigen, was ich tun kann oder soll, ohne dabei das Gesicht zu verlieren, ohne eine Pause zu haben oder abschalten zu müssen. Wir gehen in eine Form der Echtzeitkultur, es wird alles mitgeschnitten und bleibt für ewig abrufbar.
»Ein wilder und gleichzeitig sinnlicher Zugang zu Strom«
Wollen wir einen Schritt zurück machen, Stichwort Kairo. Als ich mir euer Buch angesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass das eine sehr prägende Phase für euch war. Die Ähnlichkeiten zwischen euerer Videokunst und der arabischen Kunst des Nicht-Abbildens waren für mich sehr frappant. Da treffen sich die 1960er mit dem Heute, wenn man Marokko, Burroughs, Gysin, Brian Jones und Psychedelic dazunimmt. Die Gegend zwischen Kairo und Tanger scheint wohl eine zu sein, die viele Leute inspiriert hat.
GD: Ich bin nach Kairo, weil ich die Rolling Stones begreifen wollte. Das war ein Post-Graduate-Stipendium. Extrem spannend fand ich, dass es keine Entdeckung von Neuland war sondern eine Bestätigung von Implikationen, wie ich sie in den frühen 1980ern in Bands und dann später mit Acid House erfahren hatte. Das absolut Faszinierende an der nordarabischen Kultur finde ich die Parallelität von Aggression und Spiritualität. So etwas findet man im Westen nicht. Hier gibt es Kirchenmusik, die entrückt und ästhetisch-inhaltlich alles andere als martialisch ist. Und es gibt Kriegsmusik. Das Nebeneinander von Martialität und Spiritualität hat in der arabischen Popmusik eine extremst aus
geprägte Geschichte. Die Musik eines Syd Barrett genauso wie Dubstep aus Bristol hat genau diese Stränge, die parallel laufen und eine Synergie ergeben.
ER: Für mich ist das Bild von Kairo schlicht Licht. Kairo ist ein einziger Licht- und Soundcluster. Ich habe meinen Amiga dorthin mitgenommen und bin draufgekommen, dass ich dort Muster gefunden habe, die ich bereits im Computer hatte, wie eben diese arabesken Patterns. Was wir zu dieser Zeit als eine sozusagen Multimedia-Party im Kopf hatten, war dort bereits umgesetzt. Ein wilder und gleich- zeitig sinnlicher Zugang zu Strom. Im Kairo wurde alles händisch verknüpft. Wenn du eine Kabelver- längerung für Lichtinstallationen im öffentlichen Raum machen willst, und das tun sehr viele, ver- kabeln sie riesige Systeme mit einem nicht funktionierenden Stromnetz, bei dem man normalerweise davon ausgehen müsste, dass es sofort zusammenbricht. Tut es aber nicht. Dort konnte man ästhetisch erleben, was hierzulande verboten war, die Kunst, die ich machen wollte, war damals in Europa »verboten«. Als wir dann zurückgekommen sind, trafen diese Ansätze auf die frühe Phase der kalifornischen Cyberkultur, die damals ja auch überhaupt nicht kunstlastig war. San Francisco ist überhaupt kein Ort für bildende Kunst, bei der Musik sind sie bei Grateful Dead stehengeblieben. Plötzlich kam dieses digitale Vernetzungsding dazu. Der Startschuss für Station Rose war der arabische Raum plus die frühe kalifornische Cyberkultur.
Früher, als es noch keine Beamer gab, war es in den Clubs sehr schwierig, mit Diaprojektoren über- zeugende Videoarbeiten zu machen. Damals auf der Angewandten durfte man kein Video mit Bild- störungen produzieren. Das wäre unseriös gewesen. Mittlerweile gilt Material von damals nur dann als authentisch, wenn eine Bildstörung dabei ist. Diese Ästhetik hat sich durchgesetzt: Jede Kriegs- berichterstattung ist ja nur dann »echt«, wenn sie als schlecht produziert und mit Bildstörung rüberkommt. Damals war das im Kunstbereich tabu.
Was mir bei STR immer wieder gefällt, ist die Sinnlichkeit. Mir fällt bei AV-Projekten immer wieder eine Abstraktion, eine Zurückgenommenheit, eine, wenn man so will, Entleerung auf. Eine aufgeräumte Sterilität, die für mich eine Zwischenschranke zwischen den Künstler und seinem Werk treibt. So etwas wie eine Angst vor Farben. Ein derzeitiger anderer Zugang ist, finde ich, ein spielerischer, der indes oft ins Infantile, Eklektische kippt. Mir fehlt oft die Sinnlichkeit; vielleicht sind wir dabei wieder bei der Psychedelic. Bei STR ist das erkennbar anders. Es sind eben nicht die Computerabstürze oder granulare Synthese, die nur noch Krach und Lärm übriglassen …
GD: Man erinnere sich an die Clicks’n’Cuts-Bewegung Ende der 1990er. Eine Angelegenheit, die zu Beginn sehr vielversprechend war: der Fehler als Stilmittel. Das ging aber recht schnell sehr schief. Ab 2001 war das nur noch eine Wolke aus granularen Bröseln. Um es irgendwie interessant und stabil zu halten, ging stupider 4/4-House-Beat durch. Also wieder einmal die charakteristische christliche Trennung zwischen Kopf und Körper. Faszinierend finde ich hierbei die Dubstep-Szene, die es mittlerweile schon seit gut fünf, sechs Jahren gibt und immer noch nicht in diese christliche Zwei- teilung zerfallen ist. Durch den Bass ist es extrem sinnlich und zum Tanzen und über Kopfhörer bleibt einem teilweise der Atem weg.
Welche Art von Kunst auch immer es ist, es ist wichtig, sich darauf einzulassen und sich hineinfallen zu lassen. Es genügt nicht, ein Konzeptpapierchen zu schreiben und zu glauben, dass der Rest eh vom Computer erledigt wird. Da zitiere ich Timothy Leary: Der Mensch hat durch audiovisuelle Computer ein Tool in die Hand bekommen, das es bisher noch nicht gab und bei dem bisher nur an der Oberfläche gekratzt wurde. Vom Internet gibt es bisher nur die Kanäle, die müssen jetzt aber erst mal bespielt werden. Man muss sich auch der Gefahren dieser Medien bewusst sein und sie künst- lerisch ausloten. Zu sagen, dass man mit den neuen Medien so toll kommunizieren kann, ist für mich viel zu wenig. Man muss sich vernetzen. Vor fünfhundert Jahren bei der Entdeckung der Weltmeere war es auch besser, im Flottenverband zu segeln.
ER: Nachdem mittlerweile die Geräte verfügbar sind, ist sofort, sobald sie eingeschalten sind, das Verlangen da, dass etwas mit ihnen passiert. Dabei war es um so vieles einfacher, als sie nicht ein- geschalten waren. Warum braucht heutzutage jede noch so gute Band einen visuellen Hintergrund? Das lenkt doch nur ab. Ich habe nie verstanden, warum plötzlich klassische Rockbands, die in ihrer Musikdarbietung so gut sind, damit anfangen, Visualisten zu beschäftigen. Mich stört, dass ein Beamer dabei sein muss, egal um welche Musikdarbietung es sich handelt. Mittlerweile sind Beamer so hell, dass wenn drei in Serie geschalten sind, man das Gefühl haben kann, im Krankenhaus zu sein. Mit dieser visuellen Kraft muss man lernen umzugehen, welche Energie will man erzeugen, mit welchen Frequenzen arbeiten. Die Geräte sind heutzutage so fein getuned, dass man sich damit sehr gut auskennen muss, um nicht in eine Art psychedelisches Schlittern zu geraten. Sonst erschlägt einen diese Lichtkraft. Laserprojektionen finde ich wie ein Laserschwert, das ist Comic. Und auf Minimal-Ästhetik zu machen, halte ich für einen trostlosen Ausweg. Es sollte einen Lichtstopp für Beamer geben, kein Mensch braucht Beamer mit 5000 ANSI. Ich möchte mal ein Projekt erleben, das dezidiert sagt: »Wir wollen weniger«.
Ich habe den Eindruck, dass es in der Kunst mittlerweile akzeptiert ist, bewegte Bilder zur Musik zu haben. Unlängst habe ich Eva Fischer, die Kuratorin des Sound:Frame-Festivals, interviewt. Hier treffen zwei Generationen von Audiovisionskünstlern, von Zugängen zur Interaktion von Bild und Ton und zur Kartografierung des öffentlichen Raums aufeinander. AV-Kunst scheint mittlerweile überwiegend im VJ- und erweiterten Techno-Kontext rezipiert zu werden.
ER: Ich finde, diesen VJ-Kontext, den du erwähnst, den gibt es nicht.
GD: Es gibt keinen Kontext und keine Namen. Wem fällt ein international relevanter VJ ein? Mir nicht. Obwohl es mein Beruf ist. Wem fällt ein DJ ein? Mir zwanzig.
ER: Das ist wahrscheinlich die Hauptcrux an dieser Situation. Entweder man ist im Elektronik-/ Technokontext, da muss man dann aber auch so wie wir als Name auftauchen, oder eben im Kunst- kontext. Die Schwierigkeit ist aber die Marginalisierung, in die sich die Medienfestivals und die elektronische Szene manövriert haben; Das ist eine Einbahnstraße erster Kajüte. Die Medienfestivals sind die nächste Problematik, da geht es um überhaupt nichts mehr. Die jüngere Generation hat nicht verstanden, dass sie sich viel mehr mit Kollegen auseinandersetzen muss, die seit Jahrhunderten in der Bilderwelt tätig sind. Die deshalb ja auch in den aktuellen Bilderwelten vorzukommen haben. Ich bin dem Thema Mapping sehr skeptisch gegenüber eingestellt. Wozu soll ich auf Vorhandenes projizieren? Da will ich doch viel lieber auf etwas Eigenproduziertes projizieren.
GD: Etwa 1994 war es in Frankfurt mit Techno vorüber, da wurde es Mainstream. Wir dachten, der nächste logische Schritt wären audiovisuelle Gruppen wie STR. Das ist bis heute nicht passiert. Heute glaube ich nicht mehr daran. Nach Techno hat sich die Popmusik getreu von »pop will eat itself« aufgelöst. Als STR haben wir unsere künstlerische Sprache gefunden. Wir sind aber nicht Teil einer globalen Bewegung, sondern wir sind einfach STR. Jeder Kreative, der nicht mit dem Schwanz sondern mit dem Kopf dachte, wusste doch, dass nach »Beggar’s Banquet« der Rolling Stones andere Zeiten losbrechen. Das dachten wir von Techno auch: Gut, das war das letzte Aufbäumen der maskulin dominierten Musikkultur, jetzt geht es um Audiovision. Es pas
sierte aber einfach nicht. Durch das Internet hat die Musikszene einen zusätzlichen Todesstoß bekommen, nicht durch die eigene Blöd- heit, sondern durch technologische Fortschritte. Wieder ein Hinweis, dass es Ende der 1990er in Richtung AV-Bands hätte gehen sollen. Ich sehe zurzeit keine Synergie zwischen Bild und Ton. Es gibt die VJ-Bewegung, ja, aber wo sind die Namen, wo die Stars, wo die theoretischen Positionen?
Was könnte auf dem AV-Sektor in zehn Jahren los sein?
ER: Man muss sich im AV-Bereich sehr dringend mit Kunstgeschichte auseinandersetzen. Es wird immer mehr in Richtung Echtzeitkunst und -lebensformen gehen und man muss umso aufmerksamer damit sein, was man dabei fühlt. Ich glaube auch, eine der Problematiken bei DJ/VJ ist, dass sie zuwenig aufeinander abgestimmt sind, weil sie zuwenig miteinander proben. Sie haben nicht das verbindende Element, um miteinander loszulegen. Das funktioniert natürlich im Club nach vier Bier ganz gut. Aber wie ist es, wenn man es sich jeden Tag im Netz ansieht? Es müssen sich Leute zusammenschließen, die länger an der Sache dranbleiben. Kurzzeitehen, wie sie für die Dauer von einem Festival geschlossen werden, sind dafür einfach nicht ausreichend und zu oberflächlich.
Hat eine Demokratisierung stattgefunden, als dass die Produktionsmittel erschwinglich sind und die Software relativ leicht bewältigbar ist?
GD: Nein. Damit derartige Tools die Menschen erreichen, braucht es noch immer solche, die an den Schleusen sitzen. Heißt, die Lobbysierung, die z. B. die Presse betreibt, ist ja genauso stark wie in Mozarts Zeiten. Die Frage, welche Musik sich verkauft, hängt ja immer noch trotz der eventuellen Demokratisierung durch das Internet massiv davon ab, was die drei wichtigsten Musikmagazine schreiben. Ich halte auch nichts davon, durch Blogging bekannt zu werden. Nach mehr als zwanzig Jahren Internet-Erfahrung stelle ich fest: Es sind immer noch Printmedien, Mundpropaganda, Live- Präsenz und personelle Machstrukturen.
ER: Die Werkzeuge, mit denen man arbeitet, sind komplexer geworden, aber sie sind immer noch Werkzeuge. Ich stelle es mir grauenhaft vor, vor all diesen heute möglichen Optionen zu sitzen und nach zwei Tagen zu realisieren, dass man dabei nichts rausbekommt. Wir befinden uns in einer permanenten Demo-Modus-Version, in dem jeder irgendwas probiert. Das ist wie wenn man in einen Gemischwarenladen geht und den Betreiber fragt, er solle einem nicht das Gemüse, sondern eben Final Cut zeigen. Ich konstatiere: Die Demo-Leute kennen sich besser aus als ich, machen aber nichts. Sie bekommen nie etwas fertig. Wir sind vier Jahre im Fernsehen gelaufen, da sind Welten dazwischen. Ich glaube, es ist extremst trostlos, zu wissen, ich hätte alles, kann aber nicht spielen. Es gibt eben solche, die Gitarre spielen können wie ein Eric Clapton oder ein Jimmy Page und solche, die es nicht können. Das bleibt dann vielleicht ein Hochschul- oder Gymnasiumsprojekt von einem Jahr und dann denkt man sich, eben etwas anderes zu machen.
Die Gesellschaft wird immer transparenter, Facebook ist eine gute Plattform, diese Tendenzen zu beobachten: Wie stellt sich wer dar, was macht jemand. Man muss ja mit seinem Profil punkten oder zumindest Aufmerksamkeit erreichen. Das ist für mich eine Offenbarung hinsichtlich Transparenz.
GD: Als wir 1997 bei Sony Music unsere erste CD-Extra mit interaktivem Teil am Start hatten, der Vertrieb in den Startlöchern stand, die Presse teilweise bestückt war und es keine Pannen bei der Auslieferung gab, hatten sich Elisa und ich gedacht: Jetzt geht’s richtig los. Da haben uns die alten Hasen von Sony zurückgepfiffen und uns von dem entscheidenden Chaosfaktor, dem »strange attractor«, erzählt, nämlich vom Kunden. Diesen Faktor kann man nie bestimmen. Das ist im Internet dasselbe. Man kann die beste Arbeit aller Zeiten abliefern: Ob das in den richtigen Kanälen zum richtigen Zeitpunkt landet, diesen Unsicherheitsfaktor für den Künstler hat auch das Internet nicht beseitigen können.
Hat es diesen Unsicherheitsfaktor vielleicht sogar verstärkt?
ER: Am besten ist, man greift auf seine eigene Netzwerkumgebung zurück – was ich jedem nur empfehlen kann. Wenn man sich auf so etwas wie Facebook verlässt, ist man immer auf der un- sicheren Seite. Weil man sein Material irgendwem gibt, das dann irgendwo liegt. Klar ist es schwierig, Alternativen zu finden, weil keiner das Geld hat, Gegenkonzepte zu bauen. Wir hören immer wieder, wie uns Leute um unser Netzwerk beneiden. Damit haben wir bereits 1992 bei den Gunafa-Clubbings mit der Aussendung von Newslettern begonnen. Wenn man kein Netzwerk hat, darf man sich nicht erwarten, dass irgendwas passiert. Eine Eigenschaft, die bei Facebook zusätzlich ausgebreitet ist. Es geht schlicht ums Dranbleiben. Es gibt so viele Leute, die anfangs ganz begeistert sind z. B. von Facebook und dann nach einem Monat wieder dahin sind. Aber das hat ja mit dem Medium selbst nichts zu tun. Das ist ja nur eine Version von etwas, in zwei Jahren heißt diese Version anders. Aber wie vernetzt man sich? Ich finde, das hat im Endeffekt dann wieder sehr viel mit Kunst zu tun.