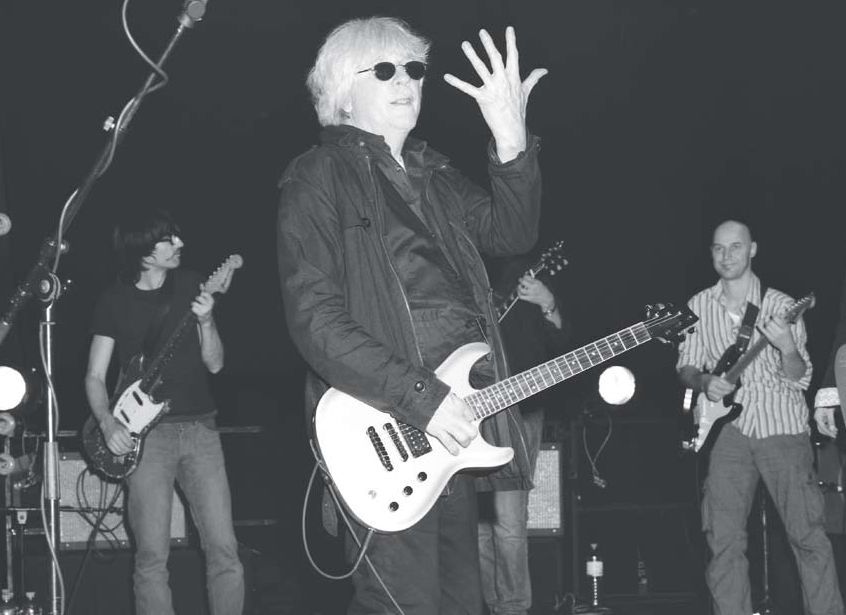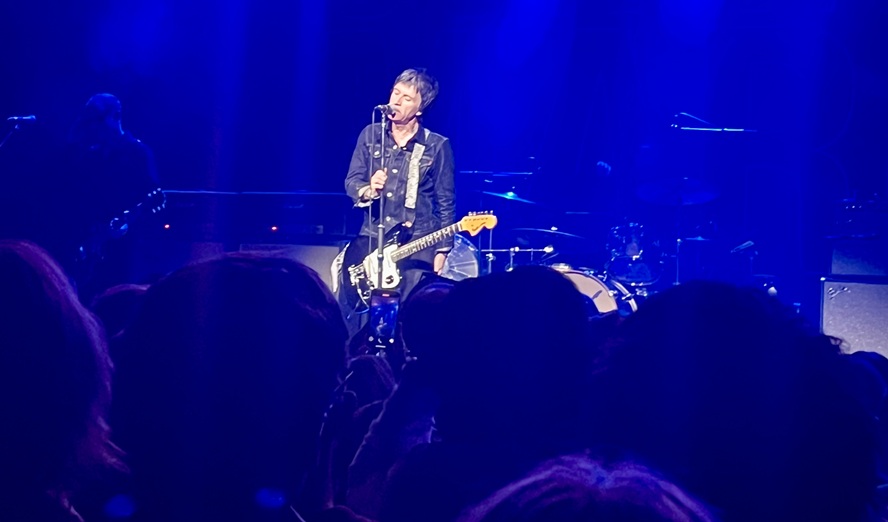skug: Tony Conrad, der vor kurzem in Wien war, erzählte mir, Sie hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass der Popmusik-Szene eine ordentliche Minimal-Music-Infusion verabreicht wurde. Welche Rolle haben Sie dabei gespielt?
Rhys Chatham: Ich kenne Tony seit ewigen Zeiten. Er lud mich 1971 ein, in seiner Gruppe mitzumachen. Sie können sich also vorstellen, wie alt ich bin, aber behalten Sie’s bitte für sich. Ich spielte eines seiner ganz speziellen Instrumente, und die Performance fand im New Yorker Experimentalstudio The Kitchen statt, wo ich das Musikprogramm kuratierte. Dieser Veranstaltungsort, den es nach wie vor gibt, wurde zu einer Zeit ins Leben gerufen, als es innerhalb der modernen musikalischen Ästhetik – in Frankreich sagt man dazu musique contemporaine, also z. B. Musik von Boulez oder Stockhausen – für Komponisten wie La Monte Young, Tony Conrad, Philip Glass oder Steve Reich keine Auftrittsmöglichkeiten gab! Ich war ja selbst auf der Suche nach einem Auftrittsort, denn als ich damals an der New York University Komposition studierte, waren solche Konzerte nur in Lofts in SoHo möglich. Es gab ein erstklassiges Kunstzentrum, wo Theaterleute wie Richard Foreman ihre Stücke aufführten oder die New York Dolls auftraten. Genau in diesem Komplex begründeten die Videopioniere Woody und Steina Vasulka, die mit elektronischer Bildgebung und -bearbeitung experimentierten und mit Andy Warhol arbeiteten, dann The Kitchen. Da ich ebenfalls mit den beiden arbeitete, luden sie mich ein, dort die Musikprogrammorganisation zu übernehmen. Wie gesagt, ich war damals Student, ich buchte daher alle meine Freunde und Freundinnen, bis ich einmal all meinen Mut zusammennahm und Tony Conrad anrief und ihn ebenfalls fragte – ich hatte Angst, weil er ein renommierter Künstler aus der Underground-Szene war, er hatte den Experimentalfilm »The Flicker« gemacht und in den 1960ern mit La Monte Young, John Cale oder Terry Riley gespielt … Jetzt bin ich aber von Ihrer Frage weit abgeschweift, Sie wollten ja über meinen Einfluss auf die Popmusik sprechen. Ich habe Popmusik nicht beeinflusst. Wenn man Popmusik eng deutet, dann glaube ich nicht, dass ich überhaupt irgendeinen Einfluss darauf hatte. Popmusik, das ist für mich … Elton John.
Aber es gab doch auch »No New York« zum Beispiel.
Das ist aber nicht Popmusik.
Das war schon Pop, in einer speziellen Ausprägung …
Jetzt verstehe ich, Sie meinen populäre Musik im weitesten Sinne; Popmusik selbst bezeichnet ja ein ganz spezifisches Genre, deshalb war ich ein bisschen verwirrt. Das ist eine sehr gute Frage! Ich weiß, worauf Sie hinauswollen. Ich bin ein Komponist, der aus der klassischen Tradition kommt, und als ich in den späten sechziger, frühen siebziger Jahren das Konservatorium absolvierte, wurde die Frage akut, ob die rein akademische moderne Musik nicht an gewisse Grenzen stößt. Wer sie verstehen wollte, brauchte ja fast schon ein Diplom oder musste zumindest jemanden kennen, der eines hatte. Alles schien in eine sehr, sehr abgehobene Richtung zu kippen. Wir bekamen natürlich mit, wie es La Monte Young und Tony Conrad erging, als sie gewissermaßen die Tonalität neu erfanden. Wenn man als junger Komponist im Jahr 1965 tonale Musik schrieb (also auch eine Art populärer Musik), interessierte das niemanden. Um hip zu sein, musste man in irgendeiner Form seriell komponieren, sehr atonal, pointillistisch, je geräuschhafter, desto besser … Aber allmählich begriffen wir, dass viele Menschen nichts damit anfangen konnten. Wie auch? Ein im Magazin »High Fidelity« erschienener Artikel des Komponisten Milton Babbitt beispielsweise hatte den Tenor: Wenn kümmert’s, ob jemand die Musik versteht. Der in den USA sehr bekannte zeitgenössische Komponist Charles Wuorinen wiederum behauptete, dass die eigentliche Aufführung der Musik ein notwendiges Ûbel sei. Die redeten damals tatsächlich so! Wir aber, darunter Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass und Tony und Charlemagne Palestine, wollten Musik komponieren, die den Weg zum Publikum findet. Und wenn jemand ein Diplom hat, ist das auch okay.
Also Musik, die nicht nur einen elitären, sehr kleinen Kreis bedient.
Es ging darum, aus den exklusiven Zirkeln auszubrechen. Ich war ein Teenager, als das für diese Komponisten zum zentralen Thema wurde. Sie alle sind meine Onkel, meine großen Brüder – »Persönlichkeiten«. Wir lebten im selben Viertel in Soho, ich war ein Bursche aus der Nachbarschaft. Einer, der am bestehenden Zustand etwas ändern wollte, war Terry Riley. Sein Orgelstück »A Rainbow in Curved Air« z. B. ist eben nicht vordergründig intellektuell und schon gar nicht nihilistisch, sondern ein Versuch, aus dem intellektuellen Ghetto auszubrechen. Terry Riley hörte ich zum ersten Mal 1968 (in diesem Jahr ist auch bei mir viel passiert), und zwar im Club Electric Circus, davor hatte ich eine seiner Partituren gesehen, die mich an ein Stück von John Cage erinnerte und sehr nach Geräuschmusik aussah. Der Eintritt im Electric Circus war fünf Dollar, was für einen 16-Jährigen sehr viel Geld bedeutete. Als ich dann diesen Typ mit den langen roten Haaren eine Art Zirkusorgel spielen hörte, konnte ich es nicht fassen und wollte mein Geld zurück [alle lachen]. Ich war wütend darüber, noisige tonale Musik zu hören! Oh mein Gott, es war furchtbar. Da man mir aber das Eintrittsgeld nicht zurückgeben wollte, ging ich wieder rein und hörte weiter zu. Zwei Stunden später war ich ein bekennender Minimalist.
Gut, dass Sie nicht weggingen …
Ja, das hat mein Leben verändert, es war eine Offenbarung! Als 19-Jähriger habe ich dann das Musikprogramm der Kitchen begründet, habe Tony eingeladen und so weiter. Ich möchte damit sagen, dass ich von diesen Männern wirklich geprägt, von dieser neuen Musik maßgeblich beeinflusst wurde. Ich las auch viel darüber, etwa La Monte Youngs »Selective Writings«, allerdings so, wie man in diesem Alter Jean-Paul Sartres »Die Transzendenz des Ego« oder »Das Sein und das Nichts« liest – es erscheint beim ersten Mal recht kompliziert. Nachdem ich La Monte kennengelernt hatte, spielte er mir einmal eine Aufnahme seines Stückes »The Well-Tuned Piano« vor, nicht die neue Version, sondern eine ältere aus dem Jahr 1964. Da ich mir mein Studium durch Klavierstimmen verdiente, sagte ich zu ihm: »Ich glaube, dein Klavier ist etwas verstimmt, ich könnte es besser stimmen.« Er lachte, weil er genau wusste, dass es mir nur darum ging, von ihm gratis Unterricht in Komposition zu erhalten, aber er war freundlich, ließ mich von da an sein Klavier stimmen und gab mir dafür Stunden. Schließlich habe ich auch in seiner Gruppe mitgemacht, was mich ebenso nachhaltig beeinflusst hat wie die Zusammenarbeit mit Tony.
Welches Instrument spielten Sie in La Monte Youngs Gruppe?
Ich habe gesungen, mit La Monte und Marian Zazeela, dann waren da noch Jon Hassell an der Trompete und Garrett List an der Posaune. Das war ein Ding! Man musste nämlich zu Sinustonfrequenzen singen, noch dazu sehr exakt … und das in den frühen Siebzigern, wo wir unheimliche Mengen aller möglichen Substanzen rauchten [lacht]. Völlig high versuchte ich also zu diesen sehr präzisen, mit Sinustongeneratoren erzeugten Intervallen zu singen, die jedoch zu driften schienen, da die Synapsen in unserem Hörsystem unterschiedlich darauf reagieren. Selbst wenn man nichts raucht, ist es eine psychedelische Erfahrung, drei Stunden lang zu so etwas zu singen zu versuchen. Es war unglaublich. Um 1975 (ich war immer noch Student) wurde mir allerdings klar, dass ich meine eigene Stimme finden musste. Ich verließ daher sowohl La Montes als auch Tonys Gruppe und begann mich umzusehen. Und dann kam die zweite Offenbarung. Ein befreundeter Komponist nahm mich in einen neuen Club mit, von dem ich noch nie gehört hatte. Niemand kannte ihn. Er hieß CBGB’s, es war Mai 1976, und ich war nie zuvor auf einem Rockkonzert gewesen.
Ist das wirklich wahr?
Als ich 16 war, spielte ich auf der Flöte oder dem Klavier Stücke von Pierre Boulez. Ich war ja Flötist. Oder ich spielte Edgar Varèse etc. Natürlich hörte ich Platten von den Velvet Underground, den Rolling Stones und den Beatles, aber meine Leidenschaft war die zeitgenössische Musik. Dann wurde ich Minimalist. Und als ich circa 25 Jahre alt war und zum ersten Mal in meinem Leben auf ein Konzert in einem Rockklub ging, spielten die Ramones [alle lachen]. Sie hatten kurz davor ihr erstes Album herausgebracht, ich glaube im April 1976, ich hörte sie im Mai. Wie sie mit ihren kurzen, wilden Songs auf den Punkt kamen, war einfach phantastisch. Für mich stellte sich das so dar, dass diese Band alles auf viel komplexere Weise machte: Ich spielte einen Akkord, sie spielten drei Akkorde. Zwar wusste ich nicht, ob ich so etwas ebenfalls hinkriegen würde, aber ich fühlte, dass ich viel damit gemein hatte. Philip Glass hatte seine Jazz-Instrumentierungen, seine »Music in Twelve Parts«, »Music with Changing Parts«. Steve Reich baute Rhythmen aus Ghana ein – und ich? Ich sollte eigentlich etwas tun, das meinem Alter entsprach … nämlich Rock ’n‘ Roll spielen. Am nächsten Tag borgte ich mir eine Telecaster, ich lernte Barrégriffe und spielte bald darauf in einer richtigen Punkband – nur war ich als Komponist minimalistischer Werke in diesem Kontext eine Art Geheimagent. Dabei legte man damals großen Wert auf Authentizität. Ich wusste, dass ich eine rockige Komposition in einem Ort wie The Kitchen aufführen konnte. Kein Problem. La Montes Werke bestanden unter anderem aus Spielanweisungen wie »Dem Klavier einen Ballen Heu füttern« oder »Einen Schmetterling freilassen«. Wenn er solche Stücke oder John Cage sogar »Stille« aufführen konnte, dann konnte ich natürlich auch minimalistische Kompositionstechniken mit dem Instrumentarium und der Rhythmik von Rock kombinieren. Aber die Frage war, ob ich eine minimalistische Komposition, in der ich mich des Vokabulars der Obertöne bediente, im Max’s Kansas City oder im CBGB’s spielen konnte. Das Publikum dort würde dich, selbst wenn es dich mochte, mit Bier überschütten. Und wenn es dich nicht mochte – vergiss es! Damals ging es wild zu, es war die Zeit des Punk. Ich war also vor dem ersten Auftritt im Max’s ziemlich nervös. Glenn Branca, der von mir seine erste Gitarre in spezieller Stimmung bekommen hatte, war ebenfalls in der Band.
Und wann spielten Sie im CBGB’s?
 Das war irgendwann nach dem Auftritt im Max’s Kansas City, wo wir 1977, nein, 1978 spielten. Unser erstes Konzert war 1977 im Franklin Furnace, im selben Jahr hatten wir noch ein paar Auftritte in Lofts, für Punkrock gab’s ja nur das Max’s und das CBGB’s, und die hatten eine sehr lange Warteliste – es war ja auch eine große Sache, dort zu spielen. Ah, war ich nervös! Die Stunde der Wahrheit stand bevor. Würde ich zu hören bekommen: »Ach, der Komponist aus der klassischen Tradition«? Es war ja nicht gerade das, was die Kids interessierte. Ich meine, wenn es kein Rock war, dann vergiss es. Meine Arbeit sollte aber sowohl avantgardistischen Kompositionstechniken als auch Rock ’n‘ Roll verpflichtet sein. Nach dem Konzert kamen die Kids zu uns und fragten: »Wo versteckt ihr die Sänger? Wir hören Sänger.« Sie haben die Obertöne gehört, und es hat ihnen gefallen! Phhhhhhuuuuuuhhhhhh! [alle lachen]
Das war irgendwann nach dem Auftritt im Max’s Kansas City, wo wir 1977, nein, 1978 spielten. Unser erstes Konzert war 1977 im Franklin Furnace, im selben Jahr hatten wir noch ein paar Auftritte in Lofts, für Punkrock gab’s ja nur das Max’s und das CBGB’s, und die hatten eine sehr lange Warteliste – es war ja auch eine große Sache, dort zu spielen. Ah, war ich nervös! Die Stunde der Wahrheit stand bevor. Würde ich zu hören bekommen: »Ach, der Komponist aus der klassischen Tradition«? Es war ja nicht gerade das, was die Kids interessierte. Ich meine, wenn es kein Rock war, dann vergiss es. Meine Arbeit sollte aber sowohl avantgardistischen Kompositionstechniken als auch Rock ’n‘ Roll verpflichtet sein. Nach dem Konzert kamen die Kids zu uns und fragten: »Wo versteckt ihr die Sänger? Wir hören Sänger.« Sie haben die Obertöne gehört, und es hat ihnen gefallen! Phhhhhhuuuuuuhhhhhh! [alle lachen]
Was Sie zu einem Mitbegründer des New York Noise machte?
Nun ja, wir arbeiteten beim Stück »Drastic Classicism« mit der wunderbaren Tänzerin und Choreographin Karole Armitage, einem früheren Mitglied der Merce Cunningham Dance Company, zusammen. Sie war die erste Tänzerin, die sich mit Musik wie unserer überhaupt zu arbeiten traute, und unser Auftritt 1981 im New Yorker Dance Theater Workshop erregte ungeheures Aufsehen. Wir hatten vier E-Gitarren, wobei die sechsten Saiten in kleinen Sekunden – Cis, D, Dis und E – und alle anderen höchst dissonant gestimmt waren, so dass sie zusammen dröhnten wie ein chinesischer Gong. Wir waren natürlich viel lauter als ein sehr kraftvoller Drummer, und Karole war sehr, sehr tapfer, in so einem Kontext zu tanzen. Das Ergebnis war phantastisch. Und nun komme ich zur Antwort auf Ihre Frage: »Drastic Classicism« war eines jener Stücke (und ich bin stolz darauf, das sagen zu können), die die New Yorker Noise-Rock-Szene begründeten, weil … es purer Noise war!
Was ist der Unterschied zwischen No Wave und Noise?
Die Antwort auf New Wave war No Wave. Der Begriff geht auf einen Sampler zurück, den Brian Eno mit Mars, den Contortions, D.N.A. und Teenage Jesus & the Jerks produzierte. Und wäre ich damals aufgetaucht … doch die Nacht davor möchte ich auch nicht missen, ich war bis sieben Uhr morgens in einem Club und habe verschlafen. Das ist nun mal so. Aber ich war Teil dieser No- Wave-Szene, auch wenn ich mich nie als Teil davon gefühlt habe. Ich fühlte mich als Komponist, der als eine Art Geheimagent in einem Rockkontext arbeitete. Diesem Ansatz konnten dann auch andere einiges abgewinnen – mein Freund Glenn Branca zum Beispiel, der mit mir spielte und danach mit Theoretical Girls und seiner eigenen Rockband (ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern), er hat auch nur die eigenen kompositorischen Konzepte auf E-Gitarren übertragen.
Die Noise-Rock-Szene sind dann also die Swans oder Sonic Youth?
Ich glaube, wir nannten diese Musik zum ersten Mal Noise, als in der New Yorker Galerie White Columns ein Festival stattfand, auf dem unter anderem Glenn, ich, Sonic Youth und die Swans spielten. Heute betrachte ich meine Musik nicht als Noise. Ich halte meine Musik für [verstellt seine Stimme] schön. Noise ist schön – aber man stellt sich unter diesem Wort etwas ganz Bestimmtes vor, während mein Interesse mehr den Obertönen gilt. Wer Obertöne hört, wird sie auch in meinen Kompositionen hören, da aber meine Musik recht laut ist, werden andere sie vielleicht als Noise hören. Es hängt also immer von den ZuhörerInnen ab.
Glenn Branca komponierte auch für E-Gitarren-Ensembles, in denen früher u. a. Mitglieder von Sonic Youth spielten. Waren Sie und Branca also Konkurrenten?
Ich erinnere mich an das Stück »Symphony No. 1«, ein wirklich schönes, sehr gutes Stück. Natürlich waren wir Konkurrenten. Wir machen ja alle das Gleiche. [alle lachen]
Selbst wenn 100 Leute spielen? Sonic Youth setzen auf ihren Instrumenten ebenfalls alternative Stimmungen ein. Das haben Sie also von Glenn Branca?
Sie haben in seinen Ensembles gespielt und sie haben auch mit mir gespielt. Was die Kompositionen für große Ensembles betrifft, gibt es natürlich schon einen Unterschied: »An Angel Moves Too Fast to See«, mein erstes Stück für 100 Gitarren aus dem Jahr 1989, ist Musik für alle – wenn man Rock mag, dann mag man auch dieses Stück. Ich sehe Heavy-Metal-Kids, die voll darauf abfahren, aber auch ihre Großmütter stehen darauf [alle lachen]. Mein älteres Stück »Guitar Trio« hingegen ist ein eigener musikalischer Kosmos. Im Grunde braucht man aber kein Minimalist zu sein, um etwas damit anfangen zu können, es reicht, wenn man seine Ohren aufmacht. Trotzdem ist es Hardcore!
Dabei spielen Sie nur einen einzigen Akkord.
Das stimmt, aber die ganze Musik ereignet sich in den Obertönen, entsteht durch bestimmte Anschlagtechniken. Glenn hingegen arbeitet direkt auf dem Griffbrett, mit diesen sehr speziellen Stimmsystemen, darin unterscheiden wir uns jedenfalls. Ich arbeite natürlich auch auf dem Griffbrett, beschäftige mich aber bei diesen Stücken eher mit Kontrapunktik als mit Stimmsystemen.
Wie war das, als Sie in verschiedenen Städten »G3« mit Mitgliedern sehr bekannter Bands performten, wie z. B. von Godspeed You! Black Emperor in Montreal?
Grundsätzlich gilt: Man muss sein Instrument wirklich beherrschen, um dieses Stück zu spielen. Wir haben es in der Kunsthochschule in Valence einstudiert, wo die Kids sehr gut Gitarre spielten, und haben trotzdem eine Woche gebraucht, weil sie noch nicht voll ausgebildete MusikerInnen waren. Wir haben jeden Tag etwa vier Stunden gearbeitet, und der Schlagzeuger und der Bassist haben extra geprobt. Je talentierter die MusikerInnen sind, desto besser. Gute MusikerInnen können hören. Als ich zum Beispiel in Chicago mit Tortoise ein Tremolo spielen wollte, brauchte das keine langen Erklärungen. Sie machten es ganz einfach. Als wir dann aufhörten, pulsierten die Töne noch immer im Raum … weil sie fabelhafte, sehr enthusiastische Musiker sind! Deswegen sind die Aufnahmen auch so irre, diese drei CDs mit verschiedenen 30-minütigen Versionen desselben Stückes, insgesamt also zirka drei Stunden »G3«, und es klingt jedes Mal anders.
Die meisten Gitarren gab’s in Frankreich, nämlich 400. Kann das überhaupt noch so viel anders klingen?
Natürlich, denn das, worauf Sie jetzt anspielen, ist ein völlig anderes Stück, »A Crimson Grail«, ein Auftragswerk, das im Sacré-Coeur uraufgeführt wurde. Ich wollte das Publikum mit dem Sound dieser Instrumente umhüllen, und dafür brauchte ich 400. Das Werk war in einer »Nuit Blanche« [einer Art »Lange Nacht der Kunst«, Anm. d. Red.] in und vor der Kirche zu hören, wir spielten aber auch »An Angel Moves Too Fast to See«, alles zusammen dauerte von sieben Uhr am Abend bis sieben Uhr in der Früh. Davor hatte ich jedoch mit dem Bischof eine Vereinbarung treffen müssen, weil er fürchtete, dass es zu laut werden würde, und meinen Beteuerungen, dass man zu meiner Musik beten könne, keinen Glauben schenkte. Erst als ich ihm versichert hatte, dass ich eine halbe Stunde spielen würde und er danach eine halbe Stunde beten könne, unterschrieb er den Vertrag. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass er viel gebetet hat. Aber es war eine wirklich phantastische Erfahrung.
Ihr Label ist nach wie vor Table of the Elements? Was ist als nächstes dran?
Ja, genau genommen das Sublabel Radium. Ich habe ein neues Stück geschrieben, und als nächstes wird ein Album meiner Heavy-Metal-Band Essentialist herauskommen, mit der ich ebenfalls die Obertöne auslote. Formationen wie Sleep, Om, Sunn O))) haben mich zu dieser Band inspiriert. Mit Stephen O’Malley bin ich befreundet. Er lebt jetzt in Paris.
Drone Metal ist toll. Stephen O’Malley spielt aber auch im Duo mit Peter Rehberg, und das klingt etwas anders.
Wie 400 Gitarren? Ich meine, das ging mir durch den Kopf, als ich die beiden das erste Mal hörte, dachte ich, das klingt wie 100 Gitarren. Wie macht Stephen das? Ich hatte so etwas nie zuvor gehört. Ich kann mir zwar denken, dass viel vom Computer kommt, aber es klingt live einfach großartig. Diese Musik ist wirklich frisch. Man sollte sie unbedingt live hören, da ist sie noch viel kraftvoller und wuchtiger. Und dazu die Nebelmaschinen … [alle lachen]
Mir gefällt, dass Sie auch Trompete spielen … klingt wie Dancefloor- Musik … oder?
In den frühen 1990ern bin ich vom Gitarrespielen langsam taub geworden, also habe ich das Instrument gewechselt. Damals verlagerte sich auch mein musikalisches Interesse von Amerika nach Europa, wo es auf einmal Gruppen wie Atari Teenage Riot und Aphex Twin gab. In Frankreich hörte ich Radio FG, wo all diese total verrückte elektronische Musik gespielt wurde. Schließlich bin ich zu Drum’n’Bass gekommen. Als Komponist von Instrumentalmusik fand ich es ungemein spannend, wie die Werke dieser Teenager nur so aus ihren Computern, ihren McIntosh herausströmten – das war brillant! Ich fragte mich, wie das alles wohl mit Trompete geklungen hätte. Ich behielt daher die Fuzzboxes und Verzerrer aus meiner Rockzeit und begann, zu Drum’n’Bass- Rhythmen zu spielen, was ich dann zehn Jahre lang machte.
Hörten Sie auch Techno, Acid House und so weiter?
Ja, zuerst Acid House. Yeah. Das hat mir alles gefallen.
Bleiben wir bei der Trompete. Was gab’s da alles?
Zunächst das Album »Neon«, das auf Ninja Tune herauskam. Ich spielte Trompete, und der englische Komponist Martin Wheeler war für die Electronics verantwortlich. Ein weiteres Album für die Wire Editions, unter anderem mit dem Keyboarder Pat Thomas, mit dem es noch ein Projekt gab, zusammen mit Apache 61. Das war eine phantastische Gruppe! Diese kleine Japanerin mit dem großen schwarzen Bösewicht und ich in der Mitte, das war ja schon fast berühmt-berüchtigt, wir hatten jedenfalls viel Spaß miteinander. Dann war wieder die Gitarre dran, meist mit hundert anderen Gitarren … Aber Anfang 2009 werde ich mich wieder der Trompete widmen und mit Talibam!, das sind Freunde aus New York, und Jean-François Pauvros im Instants Chavirés in Montreuil spielen.
Eine letzte Frage zu »G3«: Die Bilder zur Musik stammen von Robert Longo. Wie wichtig ist der visuelle Teil für Sie?
Robert hatte unglaublich großen Einfluss auf dieses Stück und meine Musik. Als visueller und in Ästhetik geschulter Künstler hatte er mir als Komponist voraus, dass er über diese Dinge sprechen konnte, und so kommen viele meiner theoretischen Fundamente von seiner Arbeit. Als er in meiner Band spielte, fragte ich ihn, ob er nicht zur Musik Visuals machen wolle. Robert ist bei einem der Auftritte im Max’s dazugestoßen, nachdem Glenn die Band verlassen hatte. Er präsentierte daraufhin sechs Dias, die mit ganz, ganz langsamen Ûberblendungen gezeigt wurden, alles zusammen dauerte fast eine halbe Stunde. In diesen Bildern, die wie Found Images wirken, ist die Ästhetik Robert Longos unverkennbar. Sie erinnern an seine Serie »Men in the Cities«, jene No-Wave-infizierten Schwarzweißfotos. Longos wunderschöne Dias von damals laufen jetzt immer als Film zu »G3«. Wir spielen das Stück zuerst in der Originalversion, also ca. 20 Minuten nur mit Hi-Hat, Bass und Gitarren, dann spielen wir das Ganz nochmals, allerdings mit dem kompletten Schlagzeug und den Bildern, und der Effekt ist, dass die Musik völlig anders klingt. Man glaubt, dass es zwei verschiedene Stücke sind. Wir haben das in Moskau gemacht, und ein paar Leute aus dem Publikum sagten mir danach: Das eine Stück war für uns so, und das andere Stück war für uns so. Sie haben völlig verschiedene Stücke gehört. Und sie waren auch verschieden!