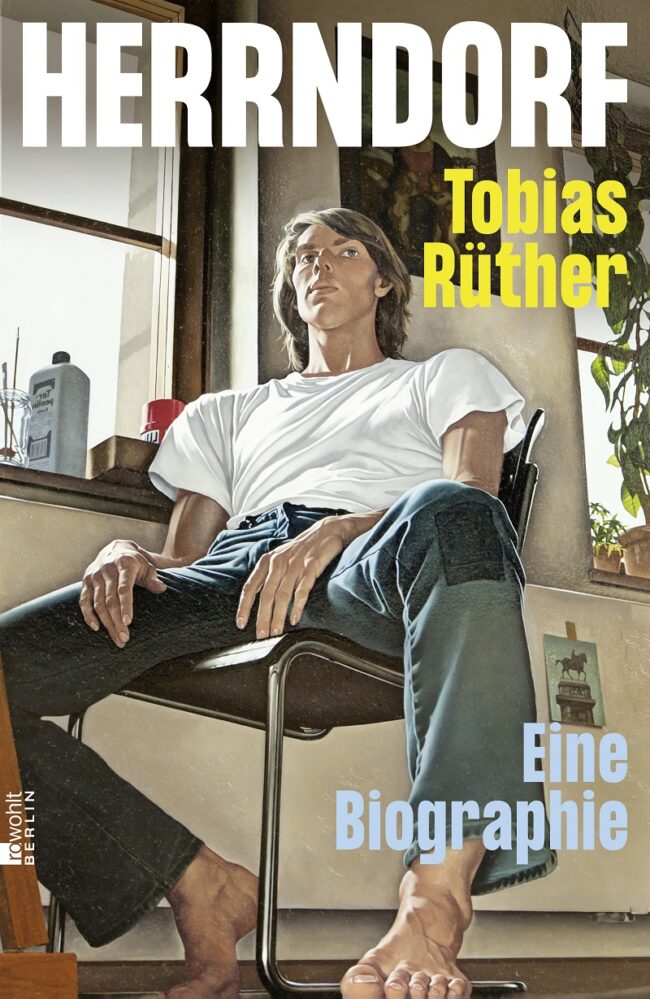»Herrndorf. Eine Biographie« kommt ohne große Thesen aus, doch Wolfgang Rüther zeigt gleich zu Beginn, dass Herrndorfs Malerblick, der für die weiten, hellen Landschaften mit den tiefblauen Himmeln verantwortlich ist, bis zum Ende seines Lebens und seiner schriftstellerischen Tätigkeit präsent war. Sein Blick sei der eines Kindes geblieben, lebenslang, so Rüther. Und wer Herrndorfs Bücher gelesen hat, weiß das nur zu gut. Als Erstes wäre da »Tschick« (2010), sein (objektiv) perfekter Jugendroman, bekannteste seiner Veröffentlichungen. Wenigere wissen von seiner Karriere als Maler und Zeichner, die er mehr oder weniger abrupt beendete und gegen die des Schriftstellers eintauschte. Rüther zeichnet das Bild eines schon immer sehnsuchtstrunkenen Menschen, der von Perfektion und dem richtigen Ausdruck besessen ist, dessen Kunst eine No-bullshit-Kunst ist, bei allem Sinn für das Komische, Absurde und Bizarre.
Jugendjahre
Die eine Hälfte der Geschichte Herrndorfs ist die des Malers, die andere die des Schriftstellers und die »dritte Hälfte« die des sterbenden, gegen die Zeit anschreibenden, die Verzweiflung betäubenden, genialen Künstlers. Seine Kindheit, so zeichnet sie Rüther, ist eine objektiv kinderbuchhafte. Und doch ist er ein wenig off. Zugleich erfolgreich im Sport und eben auch neugierig, leselustig, fantasievoll. Herrndorf macht Dinge ohne praktischen Mehrwert. Innen gibt es Zweifel, außen herrscht Perfektion. Meist schließt sich so etwas, vor allem am Land, ja irgendwie aus. Herrndorf wird dennoch nicht selbstzerstörerisch. Diese zwei Pole sind nicht gegensätzlich, sondern sollen sich als zwei sich begünstigende Eigenschaften herausstellen, entgegen aller Traurigkeit, die die Mutter statuiert. Er ist introvertiert und aktiv. Sein Glück: Unterstützung und Anerkennung durch Lehrerin und Elternhaus. Man könnte meinen, Rüther romantisiere in seinen Beschreibungen, doch die Wirklichkeit stellte sich wohl einfach so dar. Man erfährt, dass sich ein Vorfahr Herrndorfs erschoss. Das klingt wie ein Menetekel, ein Klischee. Man kann es Rüther nicht vorwerfen, diese Information einzubringen. Und doch wirkt es, kommt man im Verlauf der Geschichte darauf zurück, nicht richtig. Dazu später.
Schnell merkt man, worum es geht in der Erzählung, das Rezept ist einfach und verständlich. Herrndorf war schon als Kind genial, konnte und verstand alles, gab nichts auf sein Äußeres, irgendwie slackermäßig, zu cool für die Welt. In der Geschichte bekommt das ein gewisses Pathos, das bald ermüdet, die Wirklichkeit war wohl eher profan und sein Leben im Grunde relativ ereignislos. Zumindest nach außen. Er lebte in sich gekehrt und arbeitete verbissen in seinen Jahren an der Kunstakademie in Nürnberg. Dort scheitert man an ihm bzw. er scheitert an der Akademie, so richtig klar wird nicht, was der Grund ist, dass er etwa zehn Jahre in dieser Stadt bleibt, bis er endgültig nach Berlin zieht. Eine steile These von Seiten des Autors wäre spannend gewesen. Es wird über Malerei (alt), Film (Coming-of-age) und Literatur (Proust, Stendhal) gesprochen, aber so gut wie kaum über Musik. Er kocht nicht. Er lehnt das Konzept der Psychologie ab. Das ist seltsam, aber irgendwie passt es zum Bild dieses Mannes, das dieses Buch vermittelt. Warum hat er so lange an seiner Malerei festgehalten, die für fast alle anderen (zumindest der damaligen Kunstszene) so aus der Zeit gefallen war, dass er so »leidend-märtyrerhaft« in der Situation verharrt. Es bleibt das Bild des rollschuhfahrenden Malers, das über weitere Strecken einfach nicht spannend anzuschauen ist.
Berliner Jahre
Es ist wie gesagt der Stoff, der deprimiert. Der Künstler, der barfuß läuft, diesen Außenseiterkünstler kultiviert, nervt auf Dauer ein wenig. Seine Abneigung gegenüber modernen Dingen, die »ihre Desorientierung unter dem Deckmantel des Fortschritts tarnen«, ist nie von ungefähr. Aber doch auch etwas altbacken und in dieser Form etwas fadisierend. Erst in Berlin soll es interessanter werden. Herrndorf findet gleichgesinnte Außenseiter. Vielleicht hat das einfach allzu lange gefehlt. Er beginnt zu illustrieren, malt Comics, trifft Menschen, erhält wieder Anerkennung und seine humoristische Seite, sein Witz, kommen für die Lesenden endlich richtig zum Vorschein. Stichwort »Titanic«-Magazin und Haffmans-Verlag. Er veröffentlicht allerlei beknackten Klamauk, bekommt Aufträge, geht auf in Kreisen von Künstler*innen und Denker*innen, die sich gegenseitig befruchten und die saufen. Heilig und profan kollidiert und aus dem Splash folgt nicht selten Grandioses. Es wird spannend! Und es zeigt sich, dass seine Briefe schon immer auch literarische Versuche waren und er immer mehr zu seiner Form findet – mit und in seiner kreativen und äußerst produktiven Bubble, allen voran dem Forum der höflichen Paparazzi, die Identifikation stiftet, beeinflusst vom »Sound« Berlins der Nullerjahre und drumherum.
Rüther schreibt mit Begeisterung über eine Künstlergemeinde, der man zu gerne angehören würde. Einige seiner Beobachtungen und Bemerkungen sind großartig und von äußerster Sensibilität, etwa wenn er sagt: »Er ist zwar ein Euphoriker, aber ihm fehlt das Aufgeregte.« Das ist Herrndorf in seiner Distanz zur Welt. Seine Biographie ist so wenig lesenswert, weil sich das eigentlich Lebendige seines Lebens doch in seinem Kopf und schlussendlich in seinen Texten abspielt. Manche Kleinigkeiten in der Biographie sind zwangsweise also Nebensächlichkeiten, etwa dass er nur eine Hose hat. Oder welche Jacke er trägt (grün). Herrndorf blieb lieber zu Hause, als einen ereignislosen Abend außerhalb zu verbringen, und so sind es oft bloß abgefuckte, lustige Begebenheiten, die nacherzählt nicht halb so lustig sind, wie wenn man selbst dabei gewesen wäre. Die Insider-Witze der »Pappen«, so nennen sich die Mitglieder des Forums, sind, na ja, Insider. Spannend wird es jedoch, wenn quasi von innen miterlebbar wird, wie Auftritte beim Bachmann-Preis geplant und durchgeführt wurden, wie das Forum quasi als eine Art Houston fungierte, während die Herrndorf-Rakete Richtung Mond steuerte. Man wusste um sein Talent, und als Gruppe von talentierten Außenseiter*innen war man sich auch bewusst um die Chancen, diesen wichtigen aber auch komischen Wettbewerb zu unterlaufen, seiner Komik preiszugeben. Es liest sich wie ein Schüler*innenstreich von Erwachsenen in einer bierernsten Lehrer*innenwelt. Endgeil.
Letzte Jahre
Herzzerreißend ist seine Nacherzählung der Ereignisse der letzten Jahre, den wohl intensivsten, getriebensten seines Lebens. Und diese sind wirklich nicht vornehmlich die Jahre des Krebses, sondern diejenigen des Schreibens. Herrndorf beginnt aktiv seine errechnete verbleibende Lebenszeit zu planen, zu schreiben wie ein Berserker, und glücklicherweise ist er immer ein wenig stärker als der Krebs, addieren sich immer wieder ein paar Monate dazu, und er schreibt weiter, in der Hoffnung, seine geplanten Projekte noch zu beenden. Das ist wie ein Thriller. »Tschick« erscheint in Windeseile und wird ihm bald den Erfolg bringen, der lange ausblieb. Und er freut sich, doch schreibt ohne Pause weiter, soweit es sein körperlicher Zustand ihm erlaubt. Das ist so oder ähnlich auch in seinem als Buch veröffentlichten Blog »Arbeit und Struktur« nachlesbar, wo er weitestgehend unverändert die Ereignisse nach der Krebsdiagnose bis zum Tod schildert. In der Biographie erfährt man eben noch Hintergrundinformationen zum vom Schreiben völlig eingenommenen Leistungssportler im Endspurt.
»Herrndorf. Eine Biographie« ist ein Beispiel dafür, dass Leben und Schreiben eines Autors eben nicht zwingend miteinander zu tun haben müssen, das Buch Rüthers ist nur so gut wie es sein kann. Herrndorf ist ein aus der Zeit gefallener Autor, dessen Bücher oftmals im besten Sinne aus der Zeit gefallen, zeitlos sind. Die insinuierte Verbindung zwischen Herrndorfs Suizid und dem eines seiner Vorfahren dürfte insofern wenig treffend sein, als sich Herrndorf mit aller Macht am Leben hielt, während sein Vorfahr aus Lebensüberdruss aus diesem schied.
Link: https://www.rowohlt.de/buch/tobias-ruether-herrndorf-9783737100823