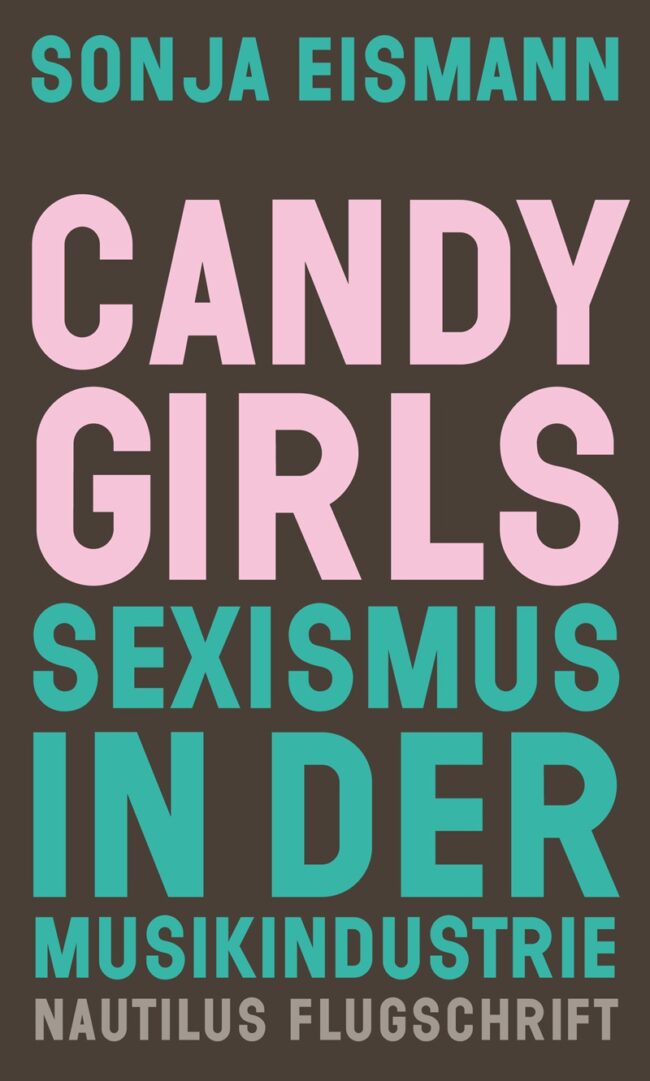Sonja Eismann schreibt seit über 25 Jahren über Popkultur und Feminismus. Als Mitgründerin und Redakteurin des »Missy Magazine« hat sie dazu beigetragen, FLINTA-Artists sichtbarer zu machen, die vom »Mainstream des Malestream« in der Musikindustrie marginalisiert und ignoriert worden sind. Viel hat sich in den letzten Jahren getan. Ein paar Klicks, ein flüchtiger Blick auf die kommerziellen Erfolge von Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish und zuletzt Chappell Roan, und es mag der Eindruck entstehen, »dass die Zeit des goldenen Popmatriarchats angebrochen wäre, der Feminismus sich im Pop flächendeckend durchgesetzt hätte.« Veränderungen verdeutlichen allerdings auch das, was gleichgeblieben ist: »Aber spätestens der #MeToo-Skandal um Rammstein hat mir in drastischer Weise vor Augen geführt, dass sexistische Strukturen nicht einfach verschwinden, nur weil es mehr und mehr fantastische Musikerinnen, engagierte Organisationen und feministischen Pop-Aktivismus gibt.«
»Candy-O, I need you so« (The Cars)
Eismanns Buch ist ein pointiertes Ausbuchstabieren der ineinandergreifenden sexistischen Aspekte einer von Männern dominierten Musikkultur. Darüber zu schreiben, war für sie eine »mitunter anstrengende, zermürbende und wütend machende« Arbeit. Ihre beim Lesen sehr gut nachvollziehbare Wut setzt sie allerdings stilistisch fokussiert ein. Im Vordergrund stehen klare Analysen: »In Kapiteln über (niemals) zu junge und (immer) zu alte weibliche Identitäten im Pop, über Frauenkörper, die eigentlich immer falsch sind, über vermeintlich dumme Fans und willige Groupies, über misogyne Songtexte und problematischen Journalismus, über erdrückend patriarchale Strukturen und die Frage, was wir dem entgegensetzen könnten.«
Eismann zeigt sexistische Kontinuitäten auf, indem sie pophistorische und aktuelle Fälle in Beziehung setzt: von Serge Gainsbourg bis Kanye West. So werden Muster deutlich, die sich über Jahrzehnte hinweg reproduzieren konnten. Dabei geht es ihr nicht um eine Chronologie skandalöser »Einzelfälle«. Diese sind in der Pop-Literatur ja zur Genüge aus der Perspektive des Male Gaze voyeuristisch kolportiert worden. Eismann geht es um die Strukturen, die »sexualisierten Macht- und Abhängigkeitssysteme«, die Abwertung und Ausbeutung von Frauen bis hin zu Missbrauch von Minderjährigen ermöglichen. Die titelgebenden Candy Girls sind quasi der Zucker, mit dem die Musikindustrie dealt: »Candy Girls haben keine Handlungsmacht. Sie sind dafür da, besungen, beglotzt, fetischisiert, exotisiert, aufgerissen und verschlungen zu werden (…) Das ist, so traurig und banal es klingt, die Grundvoraussetzung von Pop: Frauen(körper), zwangsläufig jugendlich und sexy aussehend, sind das Rohmaterial, aus dem alles entsteht.« Und sind sie einmal nicht mehr jung, werden Alter und Aussehen erst recht zum Problem. Weibliche Attraktivität wird auf dem Markt stets mit einem Ablaufdatum markiert: »Frauen, die in der Öffentlichkeit vorkommen wollen, dürfen heute zwar alt sein, aber sie dürfen nicht so aussehen.«
Eismanns pointierte Darstellungen widersprechen jeglichen »Schlussstrich«-Strategien, die auf das Silencing kritischer Stimmen zugunsten ungebrochener Heldenverehrung abzielen. Das wären doch andere Zeiten gewesen – jetzt, wo man die Vorfälle und Vorwürfe kenne, solle man die »verjährten« Fälle gefälligst auch wieder auf sich beruhen lassen. So tönt es verlässlich von jenen, die sich nach Pop-Retrotopia sehnen. Immer dann, wenn sich Wissen und Unrechtsbewusstsein gerade erst zu verbreiten beginnen. Und egal, ob es sich um Michael Jackson, David Bowie, Led Zeppelin oder die Rolling Stones handelt; gespielt und gestreamt werden sie ja trotzdem. »Too big to fail«, das gilt mit Eismanns Verweis auf Spotify-Statistiken bedauerlicherweise auch für verurteilte Sexualstraftäter wie R. Kelly und P. Diddy sowie für Marilyn Manson und Till Lindemann, deren Verfahren eingestellt wurden.

»Ja, wo is’n da das Problem?« (Udo Lindenberg)
Freilich unterscheidet Eismann zwischen realen Tätern und Maulhelden, die sich textlich austoben. Sie benennt aber auch diejenigen, die offenbar autobiografisch ihre »Abenteuer« anekdotisch bagatellisierend in Songtexte gepackt haben; z. B. Iggy Pop (»Look Away«) oder Udo Lindenberg (»Lolita«): »Ich war so um die 40 / Und sie war 15 / Wir wollten uns zusammentun / Ja, wo is’n da das Problem?« Das mangelnde Problembewusstsein vom Ausnutzen der Machtdiskrepanz zwischen erwachsenem Mann und minderjähriger Frau – nochmals verstärkt durch die Hierarchie von Star und Fan –, das artikuliert sich hier mit größter Selbstverständlichkeit. Und Eismann problematisiert zurecht die tief habitualisierten misogynen Selbstverständlichkeiten aller Art, die sich sowohl im realen Verhalten als auch in den textlichen Ergüssen Bahn brechen.
Musiker jeder Generation hatten und haben jede Menge Vorbilder. Sie können sich nach Belieben in männlich legitimierte und kanonisierte Traditionslinien einschreiben. Hey, Joe, machen wir eine Mörderballade wie Nick Cave! Beispielhaft gehört das Romantisieren des Femizids – der als solcher nie so benannt wird, wie Eismann bemerkt – zur Popkultur. Diskurs-Rock oder -Rap, der Frauen ernst nimmt? Verhältnismäßigkeit? Nicht der Rede wert in männlich bevorzugten Textsorten; weder für Johnny Cash mit seiner Version von »Delia’s Gone«, noch für Rachefantasien bei Cro (»Easy«) und Eminems Alter Ego Slim Shady. Ob durch Betrug oder auf andere Weise gekränkte Eitelkeit, das finale weibliche Opfer muss als initiale Täterin inszeniert werden. Und sei es bloß als »Gold Digger« (Kanye West), als hinterlistige Frau, die nur hinter seinem Geld her ist. Jedenfalls ist sie schuld, wenn er sich im »Beziehungsdrama« nicht mehr zu helfen weiß. Ob geplant oder im Affekt, sie muss sterben, damit er seinen gefühlten Kontrollverlust wieder auf die Reihe bekommt. »You made me do it!«
Eismanns Kurzinterpretationen diverser Texte bringen interessante Aspekte zum Vorschein. Ausgehend von »Delia’s Gone« und Guns’n’Roses’ »Used To Love Her« folgert sie, »dass die ›hauntings‹, die in den folkigen Murder Ballads nach der Tat oft als Produkt des schlechten Gewissens der Täter beschrieben werden, eigentlich eher die Verzweiflung darüber sind, dass die Stimmen, die Präsenzen der Frauen in unserer Gesellschaft nicht komplett stummgeschaltet werden können.« Nur selten wird es etwas spekulativ. Konkurriert in »I’m On Fire« Bruce Springsteens lyrisches Ich mit seinem »bad desire« tatsächlich mit einem inzestuösen Vater des begehrten »little girl«? Wie dem auch sei; Eismann leistet auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag zur Analyse von Genderstereotypen in Poptexten, wie sie u. a. Joy Press und Simon Reynolds in »Sex Revolts« 1995 begonnen haben.
»Cause I don’t fit in your box« (Tribe 8)
Als langjähriger Musikjournalistin sind Eismann sämtliche Genderstereotype nicht nur in Songtexten, sondern auch im Schreiben über Frauen im Pop untergekommen. Aus ihrer einschlägigen Sammlung zitiert sie einige signifikante Stilblüten. Ob von Männern oder Frauen verfasst, ob diffamierend oder gut gemeint; vielen fehlen offensichtlich die richtigen Worte, wenn sie über Musikerinnen schreiben. Dabei geht’s um deren Musik auch nur am Rande: wenn sich frontales Fatshaming gegen Beth Ditto richtet, PJ Harvey zur ebenso irrationalen wie faszinierenden Masochistin erklärt oder Anja Plaschg aka Soap&Skin als »düsteres Wunderkind« verklärt wird. Eismann verweist auf die gerade auch in subkulturellen Kontexten gepflegten Abwertungen von Acts als »Musik für Sekretärinnen und kleine Mädchen«. Und sie verteidigt weibliche Fans gegen traditionsreiches Lächerlichmachen à la »jung, hysterisch, keine Ahnung von Musik«. Wie kreativ und selbstbestimmt (auch an alten DIY-Standards gemessen) weibliche Fankultur sein kann, scheint manchen erst aufgrund der Aktivitäten der Swifties zu dämmern: »Auch wer die Musik von Taylor Swift nicht mag und ihrer Akkumulation von Reichtum kritisch gegenübersteht, muss zugestehen, dass durch ihre Karriere Frauen, auch als Fans, eine nie dagewesene, nicht wegzulachende Präsenz in der Popkultur erleben.«
Strukturwandel in der Musikindustrie vollzieht sich nur zäh, wie Eismann im »Strukturen«-Kapitel mit Blick auf männlich geprägte »Buddy-Netzwerke« und Festival-Bookings faktenreich belegt. Aber es gibt eben auch »die andere Seite«. Gezielt ist Eismann immer wieder auf empowernde Musikerinnen zu sprechen gekommen, die es nicht nur individualistisch geschafft haben, dem Musikbusiness die Stirn zu bieten, sondern auch als Role Models taugen, u. a. Kathleen Hanna, Peaches, Beth Gibbons oder Christiane Rösinger. Im letzten Kapitel gibt Eismann einen rasanten, Playlist-tauglichen Überblick zu weiblicher Pop-Geschichte als Alternative zu Pop-hegemonialer Männlichkeit – und landet wieder in der Gegenwart. Sie berichtet davon, enthusiastisch neue queere Artists zu entdecken. Auch kann sie dem (selbst-)sexualisierten Hyperpop-Rap von Ikkimel was abgewinnen; verweist auf Analogien zum offensiven Queercore der in den 1990er-Jahren legendären Tribe 8. All das sollte auch Leser*innen Lust auf mehr machen, auf dass sie Eismanns Aufruf folgen: »den FLINTA-Pop-Kanon (…) gemeinsam weiter aufschreiben, in die Archive, Playlists und Workshops bringen, ihn mit anderen teilen und verteidigen, ihn immer weiter mit Vergangenem und Gegenwärtigem befüllen«.