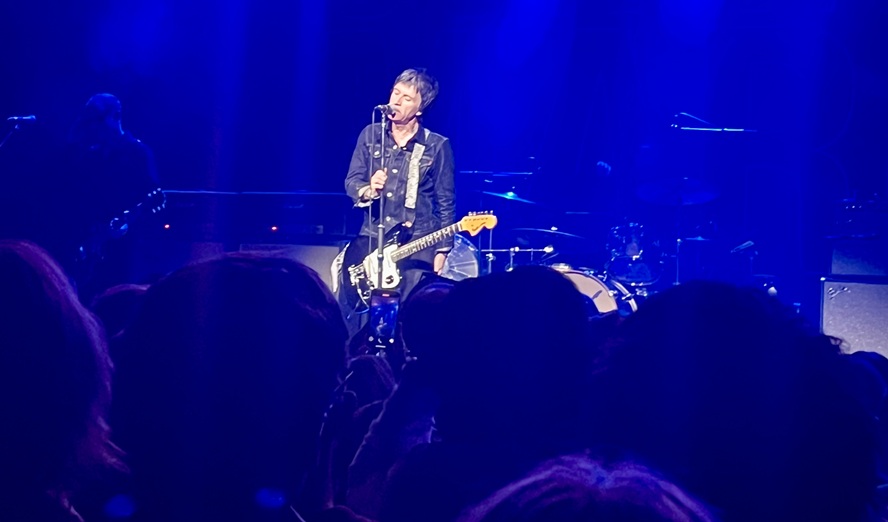Dass Souad Massi als 17-jährige in einer Flamenco-Gruppe spielte lässt sich heute noch leicht imaginieren, dass sie aber später Mitglied der algerischen Hardrockband Akator war schon weniger. Knapp 20 Jahre und einige Weltmusik-Megaseller später betritt sie die Bühne des ausverkauften Konzerthauses zu Wien als gereifte Singer/Songwriterin. In einem aufs wesentliche reduzierten Bondkorsett gelingt es der sympathischen Algerierin mit der ausdrucksstarken Stimme von Anbeginn, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Etwa erkundigt sie sich danach, wer von den Besuchern des Französischen mächtig sei, und war überhaupt darum bemüht einen Draht zum Publikum herzustellen. Vor schlichtem, in dunklen Farben gehaltenem wechselndem Bühnenhintergrund gab die Enddreißigerin mal die beschwingt tanzende Sängerin ohne »Instrumentballast«, mal die nachdenkliche Soloperformerin, meistens die souveräne Frontfrau.
Stilistische Vielfalt und Repression
Auf ihren Studioalben singt die vor allem wegen des Bürgerkriegs 1999 aus Algier nach Paris Geflüchtete inzwischen neben der arabischen auch in französischer und englischer Sprache. Die live gespielten Stücke waren bis auf zwei französische Ausnahmen (»Le Bien Et Le Mal« und »Tout Reste A Faire«) in ihrer Muttersprache, was dem Textverständnis nicht gerade förderlich war. Nachdem die Lyrics aber auch in englischer ?bersetzung zugänglich sind, stellt das für den Massi-Connaisseur kein Problem dar. Inhaltlich bezieht sich die respektable Gitarristin zumeist auf wahre Geschichten, die in poetischer Sprache um – wenig verwunderlich – die Themen Freiheit, Liebe und Politik (besonders Korruption in Algerien) kreisen. Auch die erlebte massive Unterdrückung der Frauen (Abhängigkeit von den Ehemännern etc.) und Künstler in ihrem Herkunftsland wird verhandelt. In Massis auf den ersten Blick simpel gestrickten Songs findet sich bei genauerer Betrachtung eine reichhaltige kompositorische Gemengelage, die auf die Kollision von westlicher und arabischer Kultur in Algier (wo Massi als gelernte Stadtplanerin bis Ende der 1990er-Jahre in einem Architekturbüro arbeitete) zurückzuführen ist. In einem von Folkrock und Country geprägten Rahmen finden sich arabischer Chaabi-Pop, Flamenco, Afro-Beats, französisches Chanson, indische Filmmusik, kabylische Rhythmen, kapverdische Musik, Berber-Gesang, Raï-Klänge, Tuareg-Grooves, maghrebinische Einflüsse und noch einiges mehr. Selbst für Musikethnologen kann es da unübersichtlich werden.
Begeisterung und Mitklatschpflicht
Solch theoretische Spitzfindigkeiten spielten im Wien-Konzert kaum eine Rolle. Mit großer Spielfreude – manchmal richtig funky – und scheinbar gar nicht routiniert (ein Stück wurde sogar ein zweites Mal begonnen) präsentierten sich besonders der ausgezeichnete E-Gitarrist Jean François Kellner (der nur in Spurenelementen das Gitarristen anscheinend eingepflanzte Poser-Gen durchbrechen ließ) und der viel Raum genießende Rabah Kalfah an Daburka und anderen Perkussionsteilen. Kalfah brachte – mit seiner an den großen Salif Keita erinnernden Stimme – mit Fortdauer der Show beeindruckende gesangliche Unterstützung ein. Wären da nicht die immer wieder kommenden Aufforderungen zum rhythmischen Mitklatschen gewesen (eine Unart, der man bei kaum einem Konzert ab einer gewissen Größenordnung entkommen kann), wäre der Abend noch gelungener gewesen. Dem Publikum hat es jedenfalls sehr getaugt, wie spontane Ausdruckstanzeinlagen zwischen Stühlen belegten. Anhaltenden Standing Ovations gelang es letztlich, die Musiker zu einem zuerst bewegenden, dann pulsierenden Zugabenblock auf die Bühne zu holen.