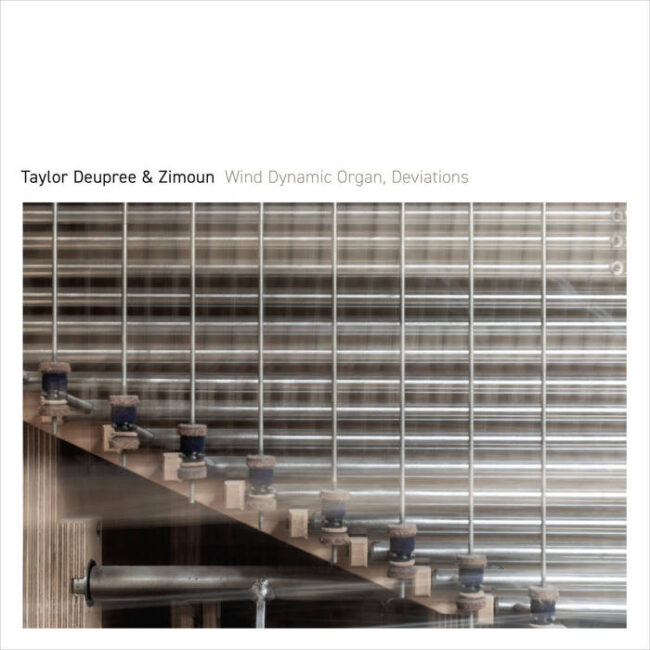1997 veröffentlichte Knarf Rellöm, damals schon nicht mehr Sänger von Huah!, auf seinem Soloalbum »Bitte vor R.E.M. einordnen« die »Autobiographie einer Heizung«, eines der aussagekräftigsten Lieder über das Aufwachsen in der Provinz, Herauswachsen aus vorgezeichneten Lebenswegen und Hineinwachsen in eine Existenz jenseits der bescheidenen Verheißungen eines Bausparvertrags. Und warum? Wegen der Musik. Das Lied schildert Eindrücke, Eklats und Erweckungserlebnisse einer Fluchtbewegung vom Eltern- ins besetzte Haus und zitiert auf dem Weg dahin und darüber hinaus Bands und Songtextfragmente, die Durchhalteparolen für die Reise ins Ungewisse. »How does it feel to be on your own with no direction home?« Dylan aus Dithmarschen, quasi. Das Identifikationspotenzial dieses Songs ist kaum zu überschätzen, zumindest wenn man, so wie Frank Möller (so hieß er, bevor er sich auf links zog), ebenfalls einmal unter ähnlichen Sozialisationsbedingungen und dem Eindruck der Verlockungen von Popkultur den Ehrgeiz entwickelt hat, sich – den Versuch schien es wert – der sicheren (und sicherlich öden) Kleinbürgerlichkeit zu entschlagen: »Ich erinnere mich an Fahrten nach Hamburg. Zum Konzert von Gun Club, Fall und Killing Joke. Ich war nicht begeistert, ich war verwirrt.« Ich auch. Andere Städte und andere Bands zwar, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die Offenbarung, das Wort, das Fleisch ward, auf Brettern, die die Welt bedeuten. Mich zog es allerdings nie auf ebensolche (zu wenig Talent und zu viel Schiss, begnüge mich mit der Rolle des Hobby-Chronisten). Ganz anders Knarf Rellöm, der fuhr irgendwann wieder nach Hamburg und blieb dort und gründete mit Gleichgesinnten die Band Huah! zur Verwirklichung des eigenen romantischen Traums vom Nicht-so-normal-sein-Wollen. Alles, was sie bis dahin aufgesogen und zur Kenntnis genommen hatten, warfen sie in die Waagschale, um es der Welt oder zumindest der Hamburger Szene voller Elan zu zeigen. Von den B-52’s hatten sie sich den Boy-Girl-Wechselgesang und die bunte, quicklebendige Ästhetik abgeguckt und ihr Klassenbewusstsein an den Gang of Four geschärft. Wie die Buzzcocks konnten sie über (enttäuschte) Liebe singen oder Alltagsbeobachtungen surreal überhöht und pointiert zum Ausdruck bringen wie Mark E. Smith oder Ray Davis. Den überdreht albernen Humor liehen sie sich von S.Y.P.H., die lässig-wegwerfenden Gesten von Style Council bzw. den Mods generell – irgendwie so. Das Spiel um das Erkennen und Benennen von Referenzen und Bezugspunkten könnte an dieser Stelle ins Uferlose ausarten (inklusive Can-Zitat am Ende von »Bauer auf dem Parkdeck«) – aber entscheidend ist in diesem Zusammenhang bzw. der nachträglichen Thematisierung, dass nicht das Missverständnis entsteht, man hätte es damals mit ein paar neunmalklugen, arroganten und rückwärtsgewandten Hipstern zu tun gehabt. Falsch. Diese verkürzte Rezeption drängt sich 2025 nur deshalb auf, weil in der gegenwärtigen Lage kulturelles Kapital weder was wert noch überhaupt von Bedeutung, sondern einfach nur egal bzw. Futter für den Algorithmus ist. Aber 1990 war die Welt noch eine andere. Es war nicht egal, ob man »Die Außenseiterbande« von Godard gesehen hatte – man entschied nach solchen Kriterien über Freundschaften und verliebte sich sowieso umgehend in jedes Mädchen, das auch nur entfernt Anna Karina ähnelte. 1992 hätte man es idealerweise auf einem der Reunion-Konzerte von The Velvet Underground kennengelernt. Hätte genauso passieren können, ist bestimmt auch genauso passiert! Hielt vielleicht nicht lange – nicht so schlimm! Die hier skizzierten Abgrenzungs- und Selbststilisierungsgesten hatten sicherlich auch ihre Nebenwirkungen. Die Dosis macht immer das Gift, keine große Erkenntnis. So war das eben und so ist das im Grunde auch heute immer noch überall dort, wo das emanzipatorische Potenzial und der verheißungsvolle Appeal von Popkultur noch bzw. nach wie vor dazu anregt, sich nicht nach dem Vorbild der Elterngeneration geistig früh zu verrenten, sondern im Geiste von etwas anderem auszuprobieren und bis zu einem gewissen Grad selbst zu erschaffen. Möglicherweise ist heute dann auch wichtig, was man isst oder so, ich weiß es nicht. Sollen die jungen Leute machen. Und daher bzw. um jetzt den Weg zurück zu Huah! zu finden: Ich frage mich, ob und, wenn ja, wie man heute die Musik dieser übermütigen jungen Menschen hört, die sich vor über 30 Jahren ausgetobt haben? »Ich möchte auf deinem Plattenteller liegen (1988–1992)« – an wen richtet sich dieser (beinahe verzweifelt anmutende) Wunsch, Gehör zu finden? Noch dazu trifft dieser wunderbar widersprüchliche Appell ins Zentrum der spannenden Frage nach dem Verhältnis vom Generationenkonflikt in der Popkultur und der gleichzeitig erfolgenden traditionsbewussten Weitergabe und Aneignung von Geheimwissen. Was geht nicht mehr und was geht wieder? Man muss und sollte es ja nicht so machen wie die Alten, aber man muss was machen! Und idealerweise macht man es nicht scheiße. Wie man das macht, dazu kann man sich bei Huah! inspirieren lassen.

Huah!
»Ich möchte auf deinem Plattenteller liegen (1988–1992)«
Tapete Records

Unterstütze uns mit deiner Spende
skug ist ein unabhängiges Non-Profit-Magazin. Unterstütze unsere journalistische Arbeit mit einer Spende an den Empfänger: Verein zur Förderung von Subkultur, Verwendungszweck: skug Spende, IBAN: AT80 1100 0034 8351 7300, BIC: BKAUATWW, Bank Austria. Vielen Dank!