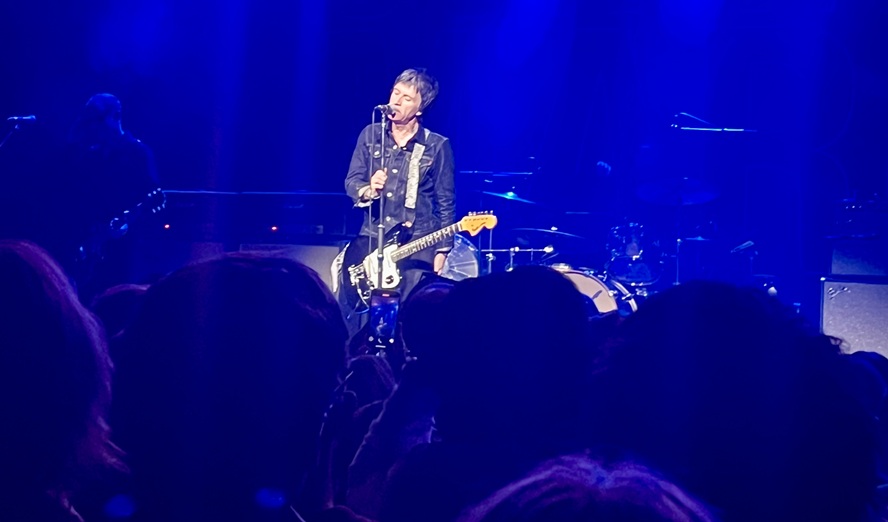»Megacities«. Eine Doku von Michael Glawogger über das Leben und Leiden von Menschen unter den Bedingungen einer Riesenstadt. Als wäre dieser Film nicht an sich schon interessant, kam es zu Beginn des letzten Donaufestivalwochenendes zur Uraufführung eines besonderen Projekts: Der Musikfilmemacher TIMO NOVOTNY vollbrachte zusammen mit der musikalischen Untermalung von Sofa Surfer MARKUS KIENZL (die beiden durften im Verlauf des Abends auch ein zweites Mal audiovisuelle Kostproben ihrer Experimentierfreude preisgeben) einen Live-Remix von »Megacities«, was sowohl visuell als auch auditiv ungemein erfrischend und anregend war. »Life in Loops« heißt das Projekt, das als Kinofassung im Herbst anlaufen soll, und auf jeden Fall einen Besuch wert ist.
Die weiteren Höhepunkte des ersten Abends bestritten einerseits Wolfgang Schlögl alias I-WOLF mitsamt seiner Band, und einer elektronischen Rhythm-and-Soul-Performance, die stellenweise aber etwas zu dünn ausfiel. Und andererseits die schon in Krems für Aufsehen sorgenden DÄLEK.
Als wahrer Hauptact des Abends bewiesen sie, was HipHop heutzutage leisten und bewegen kann. Ein progressives akustisches Krachverständnis und eine wahnwitzige Experimentierlaune können hier sogar dazu führen, dass in die Plattennadel geschrieen wird, was für einen Luftzug im Publikum sorgte, der einem Gespenst aus Chaos und Ordnung entsprach. Dälek sind tonnenschwere, industrielle Monotonie, deren Flow Breitwand proklamiert, wo eigentlich nur Schmalspur Platz hat. Dälek sind laut »Spex« die »Public Enemy fürs dritte Jahrtausend« und verweisen selbige aber mitunter locker auf die Plätze, wenn es darum geht, avantgardistische Versperrtheit mit Spannung, Kompaktheit und Eleganz zu verbinden. Alles zusammen klingt dann so gut, wie es HipHop vermutlich seit besagten Public Enemy nicht mehr war. Nämlich existenzbedrohend gut.
Der nächste Tag begann zuallererst mit WOLFGANG MITTERER und seinem Sextett. Drei akustische Jazzer loten zusammen mit drei elektronischen Tüftlern unter Mitterers kompositorischer Leitung die Brücken zwischen Improvisation und Komposition, Elektronik und Akustik aus. Neben Pulsinger, Tunakan und Dieb13 fand sich auch ein beeindruckend frivoler Reinhardt Winkler am Schlagzeug, was der Sache den absolut nötigen Pepp brachte. Nach etwa zweieinhalb Stunden war aber der Höhepunkt längst überschritten. Mit der Hälfte davon wäre nichts verloren gewesen.
Eher begeistern konnte da schon die Klagenfurter Indie-Rock-Legende (oder Newcomer, wie man’s nimmt) NAKED LUNCH, die zusammen mit ihrem Video-Regisseur THOMAS WOSCHITZ ein beeindruckendes audiovisuelles Ansinnen zeigten. Hinter einer Plane versteckt, spielten Naked Lunch neue Songs, die auf der Leinwand selbst mit dem Film »Sperrstunde« überdeckt wurden. Bedrückende Geschichten aus der Klagenfurter Allnacht, bei denen Menschen wegen der Sperrstunde auf der Straße bleiben müssen. Trotz der düsteren, fast bedrohlichen Atmosphäre, die durch das Heraufbeschwören von Kriminalität, Einsamkeit, Selbstmord und Müdigkeit abgerundet wird, war der Film ein Erlebnis und bot vor allem auch durch die neuen, wunderschönen Naked Lunch-Songs doch das Gefühl, dass hinter jeder Sperrstunde ein Wiederbeginn steht. Und wenn dann beim letzten Song und dem angesprochenen Selbstmord die Plane nach oben geht, und Naked Lunch noch einmal bei einem grandiosen Song-Finale zu sehen sind, dann schimmert auch das Wissen durch, dass die Herzen die einzigen Orte sind, wo niemals Sperrstunde herrschen sollte.
Der Freitag stand unter dem Zeichen experimenteller, elektronischer Musik, wobei diese Subsummierung gerade beim ersten Act, RADIAN, scheitert. Die Österreicher leben seit 1998 in Radianien, irgendwo zwischen Pop, Rock, Dub, U und E, Jazz, Noise, Elektronik und Improvisation und verarbeiten diese ganzen Ecken zu einer postrockig angehauchten, exprimentell-leichtfüßigen Illusion der Tanzbarkeit. Martin Brandlmayers minimalistisches Schlagzeugspiel wirkt derartig aggressiv, dass das »Boygrouphafte« immer weniger zur Parodie wird, auf dem Weg zum Soundforschungshimmelreich. Vertrackt-verschobene Klangschichten treffen auf Popsongs, wo eigentlich nur Luftleere Platz hat. Ganz großartig.
RICHARD DEVINE brachte im Anschluss ein etwas schlaffes Distortion-Set, das sich zu wenig zum Breakcore, und zu weit zum HipHop hinlehnte. Auch war der Ausnahmeelektroniker von Warp Records mit der Uhrzeit sicher nicht glücklich bedient, steigt doch die bpm-Resistenz erst ab Mitternacht auf die von ihm geforderten Höhen an. Im Anschluss daran erforschten die Finnen PAN SONIC, was zwischen Himmel, Hölle, Hier und Jetzt an Klangforschung und experimentellem Noise möglich ist. Die Pioniere der experimentellen Elektronik besuchten damit zum zweiten Mal binnen einem Jahr Österreich und hinterließen, wie immer, einen soliden, klugen Eindruck, der aber immer weniger das Mäntelchen des Alt-Eingesessenseins loswird. Pan Sonic sind nun mal keine Underground-Punks mehr.
Grandios zu Ende ging dieser Abend dann doch mit dem Herrn JAMIE LIDELL. Wie ein verrückt gewordener Marvin Gaye auf Kollisionskurs mit Techno, so wirkte der mit Stacheln versehene Jamie Lidell (die eine Hälfte von Super_Collider) auf der Bühne. Seine Stimme vermochte wahrlich zu berauschen, und der Soul darin war charismatisch, verspielt und vor allem eingängig. Seine elektronischen Klangexperimente und Rhythmusbrüche fügten sich in dieses Bild ohne Probleme ein, und lieferten den sympathischsten, souligsten Elektro-Pop seit langem. Da heißt es Ausschau halten nach der Tour im September!
Der nächste Abend stand dann ganz im Zeichen aktueller experimenteller Elektronik ohne Wenn und Aber. CHRIS CLARK, Warp-Tüftler und Beat-Umherjager, eröffnete den einzig ausverkauften Abend mit leider belanglosen Rhythmuswelten, die vielleicht auf Platte große Geschichten erzählen können, aber live eher mager, weil unausgegoren und eine Spur zu überdreht rüberkamen. Da sind die nahen Verwandten Autechre und Aphex Twin dann doch die vielleicht besseren Live-Acts. Den Übergang zu besonders intensivem Breakcore besorgte dann C64, der quasi als Vorbote einer Sensation das Publikum aufheizte: Nach ihm stand der erste Österreich-Gig der Noise-Legende VENETIAN SNARES auf dem Programm. Und der zeigte, wie schön es doch mitunter sein kann, wenn das Hirn zur glatten, konturlosen Scheibe mutiert.
Diejenigen jedenfalls, die sein neues exzellentes Album, das sich vorzugsweise klassischer Samples bedient, um aus der Verbindung zwischen orchestralen Arrangements und elektronischer Härte eine Art melancholischen Big Beat zu entwerfen, als zu soft empfanden und eher das crosse, dem schnörkellosen break-core verpflichtete Frühwerk bevorzugen, kamen in Korneuburg voll auf ihre Kosten. Alle anderen suchten vergebens nach epischer Breite und subtilem Charme düsterer Streicher. Einzig das Intro und ein kurzes Zitat gegen Ende eines Tracks ließen kurz erahnen, wie abwechlungsreich der Abend hätte werden können.
Sonst wurde dem Publikum mit ohrenbetäubendem Break-Beat unbarmherzig der Scheitel gezogen. Dass selbiges Publikum mehrmals größere Lautstärke einforderte, mag angesichts der Tatsache, dass mancher mit Fortdauer des Konzerts auf die Tribüne geflüchteter Besucher sogar dort dem Gehörsturz nahe war, verwundern, war aber schon in den 80ern bei Slayer nicht anders. Wie dem auch sei: Einen Moment lang wurde die Erde zur Scheibe und mit ihr auch das gequälte Hirn.
Nach diesem für einige Anwesende überstrapazierten Breakbeat-Overkill (manche vermissten die symphonische Opulenz seines aktuellen Albums, die nur anfangs aufblitzte) machte also der Star des Abends seine Aufwartung. AMON TOBIN bediente wohl die Erwartungshaltungen der Audienz am schlüssigsten und war wohl der Grund, warum diese Partynacht ausverkauft war. Zunächst also ging es in abstraktere Gefilde, schien der Meister St
immung aufbauen zu wollen, und nutzte die Werft als mild-brachialer Soundarchitekt. Dann aber, nachdem instrumentaler HipHop gestreift wurde, geriet Tobin freiwillig in eine Breakbeat-Phase, die wohl jeder bessere Drum’n’Bass-DJ drauf hat. Mächtige, verzerrte Bässe schichten Viele, doch genau so unspektakulär, wie diese Tobin setzt, wollen es die in vorderen Reihen enthusiasmiert tanzenden jungen Scharen. Das da Capo umfasst dann noch ein Velvet Underground-Sample (meiner Erinnerung nach »All Tomorrows Parties«) und ein final gesampletes Rockgitarrenriff, ohne das heutzutage kein DJ mehr auskommen mag.
Insgesamt war die Mischung aus Konzert und Party eine sehr gelungene – wurde weit mehr geschraubt, als auf Turntables hantiert – und CHRISTIAN VOGEL durfte den recht eigenartigen Schlusspunkt setzen. Zu einem recht urban-banalen s/w-(Straßenverkehrs)Visual kredenzte Jamie Lidells Partner eher verlangsamtem Chill Out verpflichtete Sounds, die so etwas wie fragile Funkyness versprühen wollten, aber eher im Nichts versackten.
Der große Abschlussabend am Sonntag bot zwei ganz besondere Bands. Den Beginn machten die den weiten Weg aus Japan angereisten MONO, was soviel wie »Sache« heißt, wie uns Kante-Sänger Peter Thiessen später versicherte. Breitwand-Klangformat mit betörend energetischem Geschrammel verbindet elegante Schönheit und pathetisch-elegisches Melodieverständnis. (Guter) Postrock in Reinkultur also, was leider aufgrund des etwas fehlenden Bombasts mau rüberkam. Mono sind dann doch nicht sehr weit weg von der ganzen Postrock-Revolution, und das machte es leider nur zu einem mittelmäßigen Konzert.
Was aber als Abschluss geplant war, war mehr als sensationell. KANTE, Diskurs-Popper aus Hamburg, sind mittlerweile bei ihrem dritten Album angelangt, welches den Namen »Zombi« trägt und seit einem Jahr die deutsche Indie-Rock-Landschaft aufwühlt. Bei einem gut gefüllten Konzert im WUK letztes Jahr haben sie in Wien schon präsentiert, was das Neue, Spannende an der Platte ist. Warum zwei Schlagzeuge, zwei Bläser und jede Menge sonstiger Schnickschnack es schafft, eine so komplexe, tiefgründige Platte wie »Zombi« auf die Bühne zu bringen.
Wie es gelingen kann, dann nach zwei Stunden den Bogen zurückzuspannen und mit »Die Summe der einzelnen Teile«, ihrem Indie-Hit von 2000, die leider zu dem Zeitpunkt vermutlich wegen Müdigkeit schon ausgedünnte Masse noch zum Tanzen zu bringen, ist eine andere Frage. Im Gegensatz zum WUK-Gig dauerte das Abschlusskonzert des Donaufestivals zweieinhalb Stunden. Wer fleißig Kante-Videos schaut, kennt auch ihre Visual-Performer SHOWCASE BEAT LE MOT, die das Donaufestival mit einer Theaterproduktion beglücken konnten. Für den Kante-Gig gab es quasi eine Inszenierung, eine Show in Sonderformat. Das Kante-Konzert war unterlegt von Overhead-Projektionen der Showcase-Leute. In der zweiten Hälfte wurde mit Percussions und Drachen gar recht deutlich eine wegweisende Richtung für den spannenden Begriff »Musiktheater« gegeben. Die Kante-Songs standen dabei als Klammer außen rum und als Herzstück der Performance mitten drin in der eigenartigen Wahrnehmung, die dieses Konzerterlebnis bescherte. »Zombi« handelt von Krisen und Zuständen der Schwebe, sagen Kante. Es ist beängstigend, wie gut es diese jungen Menschen schaffen, den Ballast des Genres »Hamburger Schule« abzuwerfen und diese Zustände der Schwebe so gekonnt auf der Bühne greifbar zu machen. Einen würdigeren Höhepunkt als Abschluss des Donaufestivals hätte es wohl nicht geben können.