»Es gibt das Sprichwort: Mach‘ es auf »Russisch««, grinst Elena Tikhonova. Sie und Dominik Spritzendorfer haben vor kurzem den Dokumentarfilm »Elektro Moskva« herausgebracht, der die Geschichte russischer Experimentalelektronik des 20. Jahrhunderts Revue passieren lässt. Wobei, die eigentlichen Protagonisten dieser Dokumentation sind sowjetische Synthesizer.
»Elektro Moskva« erzählt als »elektromagnetisches Märchen« von Zuständen des Nicht-Vorhandenseins, davon, aus Nichts ein Etwas zu machen und vom problematischen Nebeneinander forscherischer Leidenschaft und ihrer militärischen Usurpation. Kreativität hat unter derartigen Verhältnissen ganz besondere Bedingungen: klassisches, sozusagen staatsverordnetes DIY; nicht bohemistische Kunstpraxis, sondern existentieller Lebensentwurf.
Der widerspenstigen Zähmung des Stroms, so ließe sich »Elektro Moskva« zusammenfassen. »Mich hat fasziniert, wie die Menschen es dort gewohnt sind, Krisen zu handhaben, damit umzugehen, dass es nichts gibt und dass man sich alles in irgendeiner Weise beschaffen muss«, umreißt Spritzendorfer die Arbeitsintentionen. »Diese gesättigte Form des »Wenn ich etwas brauche, kaufe ich es mir« gab es dort nicht. Ûber Kontakte zur Moskauer Filmhochschule, der dortigen Universität MGU und zu Musikern wie Alexey Borisov oder Richardas Norvila tat sich die Möglichkeit auf, Musiker zu portraitieren, die genau unter diese Vorzeichen versucht haben, kreativ zu sein«.
Mit reichhaltigem Archivmaterial und On-Site-Drehs wird von der in Synthesizer und Rhythmusmaschinen verlegten Bändigung des Stroms seit dem sowjetischen Aufbruch berichtet. Ausgehend von Lenins Doktrin von 1920, wonach Kommunismus die Sowjetmacht und die Elektrifizierung des Landes bedeutete, vollzog sich unter dem Eindruck der Oktoberrevolution ein Furor, der einerseits die unendlichen Weiten der Sowjetunion maschinell und agrarisch nutzbar machte und andererseits maßgebliche Impulse in Kunst und Wissenschaft setzte (Konstruktivismus, Suprematismus, russischer Avantgardefilm etc. Schon in den mittleren 1910er Jahren beschäftigte sich etwa Dziga Vertov mit elektrischen Klangstudien.)
Tikhonova schildert die Bildrecherche als regelrechte Suche nach der Nadel im Heuhaufen: »Das Thema war selbst für russische Verhältnisse »exotisch«, die Katalogisierungen waren oft schwer zugänglich oder falsch, nur etwa zwanzig Prozent des sowjetisch-russischen Filmmaterials sind digitalisiert und der Gosfilmofond – das Staatliche Filmarchiv Russlands im Moskauer Vorort Belye Stolby – hat fast die Größe des 1. Wiener Bezirks. Dazu kamen noch aus KGB-Zeiten stammende und weiterhin recht wirksame Auflagen.«
Multiple Entfremdungen![]()
Gleich zu Beginn sehen wir das letzte, 1993 geführte Interview mit Lev Termen (1896-1993), dem Konstrukteur des Theremins. Ein Zufallsfund, wie Tikhonova feststellt: »Ich hatte auf einer Party in Moskau dem befreundeten Filmemacher Sergey Zezjulkov von unserem Projekt erzählt und er hatte gemeint: »Unter meinem Bett habe ich das letzte Interview mit Termen«. Dieses wichtige Dokument war bislang nirgends gezeigt worden. Derartige Versäumnisse sind symptomatisch und machen deutlich, dass weiterhin große Lücken in der historischen Aufarbeitung klaffen. Termen war immerhin ein russischer Edison. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte er ein Physikstudium und das Musikkonservatorium als Cellist absolviert. Er war an der Entwicklung der Technologie der ersten Fernseher beteiligt und hat Flugdrohnen und Abhörgeräte konstruiert. Er fand Cellospielen mühsam und kam so auf die Idee, dass man das Cello wie ein Dirigent, mit den Händen in der Luft, spielen könnte. Nachdem er 1919 das Theremin fertiggestellt hatte, präsentierte er es wenig später Lenin. Dieser fand es interessant und versuchte sich selbst daran. Gleichzeitig stellte Lenin fest, dass diese Technologie auch für Alarmanlagen verwendbar wäre, weshalb Gelder in beide Richtungen freigemacht wurden. An Termen wird deutlich, dass die Geschichte sowjetischer Elektronikmusik immer schon auch eine Geschichte militärtechnologischer Nutzbarkeit war«.
Yevgeny Murzin (1914-1970) teilte dieses Schicksal. In den späten 1930ern konstruierte er den nach dem Komponisten Aleksander N. Skrjabin benannten ANS-Synthesizer, parallel dazu war Murzin beim Militär beschäftigt und entwickelte Steuerungssysteme für Raketen- und Bombengeschütze. Erst in den 1960ern konnte er ein Labor für experimentelle Musik eröffnen. Der auf der Technik von geschwärzten Glasplatten basierende optische ANS liefert kosmisch anmutende Töne und wurde beispielsweise von Edward Artemiev im Filmsoundtrack zu Andrey Tarkovskis »Solaris« (1972) prominent eingesetzt. 
Indem sie den »Riecher« hatte, Musikkunst für technologisch-militärische Forschung auszunutzen, erwies sich die sowjetische Führung als sozusagen avantgardistisch. Denn vergleicht man die Situation der 1920er und 1930er Jahre zwischen der UdSSR und dem Deutschen Reich, fällt auf, dass das NS-Regime Instrumenten wie dem Trautonium in bestimmter Weise zwar zugetan war, von einer staatlichen Interdependenz kann indes nicht gesprochen werden. In der UdSSR waren elektrische und elektronische Musik als technologischer Signifikant ein Abfallprodukt der Militärindustrie; dort hatten sich in den sphärischen Klangwelten der Synthesizer seit jeher Zukunftsmusiken avant la lettre abgebildet. Diese eigenevozierte Avantgarde wurde indes sehr schnell von der bürokratischen Behäbigkeit ausgebremst. So heißt es in einem Kommentar in »Elektro Moskva«: »A synthesizer is something western and alien«, und Alexey Borisov, Mitgründer der 1980s-New-Wave-Band Notchnoi Prospekt, konstatiert: »It was considered improper to use Soviet synthesizers for stylish music«.
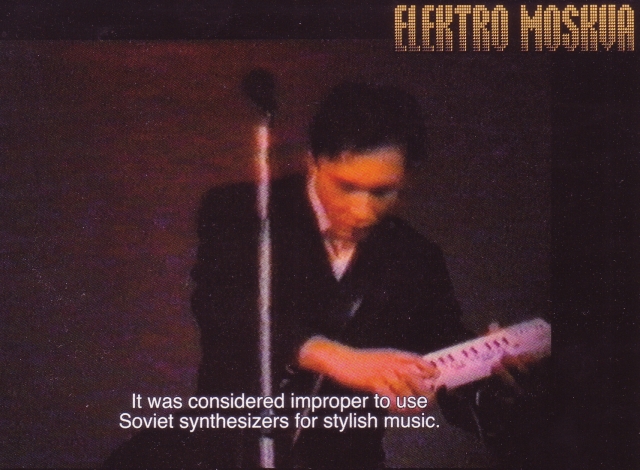
Notchnoi Prospekt live 1986
Hinzu kommt, dass aufgrund des grassierenden Materialmangels kein Synthesizer dem anderen gleicht. Für den Musiker und Psychotherapeuten Richardas Norvila aka Benzo sind diese Instrumente »lebende Organismen«, in deren Klängen Erfindungsreichtum, politische Beeinflussung und kommunistische Machbarkeitsfantasien oszillieren. Der Synthesizer wird weniger als Instrument wahrgenommen denn als ein in Sound gefasstes Fenster in Imagination, Träume, Katharsis und Bastelleidenschaft; die Musikmaschine als transzendentes Werkzeug.

Benzo mit »Klienten«: Norvila zuhause mit einer der größten privaten Sowjet-Synth-Sammlungen
Auch Andrey Smirnov, Leiter des Theremin Centers, war davon betroffen, wie Tikhonova erzählt: »Smirnov hatte Ende der 1970er begonnen, Vocoder zu bauen. Weil der Markt so schlecht funktionierte, konnte man die Bestandteile dazu nicht kaufen. Es gab aber zwei behilfliche Personengruppen: die, die Teile aus den Fabriken entwendeten und Konstrukteure, die sie unter der Hand verkauften. Smirnov wollte sich einen Korpus für seinen Vocoder beschaffen und einige geneigte Menschen stimmten zu. Dafür musste er um drei Uhr Nachts vor das KGB-Gebäude am Lubjanka-Platz kommen. Dort wurde ihm dann von vermeintlichen KGB-Leuten das in ein Laken gehüllte Bauteil übergeben.«
»Jedes Teil, das nicht in eine »ernsthafte« Industrie wie Flugzeug- und Panzerbau oder Raumfahrt gegangen ist, aber zu schade war, um weggeworfen zu werden, ist für den Synthesizerbau verwendet worden. Obwohl von derselben Firma von denselben Leuten am gleichen Tag hergestellt, ist jeder Synthesizer ein Unikat und klingt anders. Man kann mit ihnen nicht »richtig« spielen, weil sie stets etwas außerhalb der Spur sind. Man muss für sie quasi ein Psychotherapeut sein: Erwarte nichts, sondern akzeptiere, was sie von sich aus hergeben. In »Elektro Moskva« war das eine Allegorie dafür, wie man überleben kann. Es ist eine Geschichte über das Verschwinden, eine Geschichte, die auch in Russland kaum bekannt ist und die in der kapitalistischen Vereinheitlichung der Welt immer weiter zurückgedrängt wird. Man kann heute zwar alles kaufen, aber glücklicherweise gibt es immer noch ein paar dieser speziellen Leute, die wissen, was man braucht und wo man es sich organisieren kann.«
Diesen vielschichtigen Entfremdungen gehen Tikhonova und Spritzendorfer auf den Grund.

Ausgelöschte Beatles-Stimmen
Dabei ist »Elektro Moskva« gerade keine der üblichen Musikdokumentationen, sondern behandelt die Verortung (post-)sowjetischer Alltagskultur qua Synthesizer und steht noch am ehesten Florian Henckel von Donnersmarcks »Das Leben der anderen« (2006) nahe. »Es war uns sehr wichtig, nicht einen Film für Fans elektronischer Musik zu machen, sondern mit Musik als Vehikel Geschichten über Russland zu erzählen«, stellt Spritzendorfer fest. »Wir wollten um das Thema Musik einen Resonanzkörper bauen, in dem das soziale Umfeld mitschwingt: die Antriebe, die zu diesen Erfindungen führten, die Bedingungen, unter denen Musik abseits der offiziellen Strömungen gemacht wurde. So gab es zu Sowjet-Zeiten nur das Label Melodiya, und alles, was der kommunistischen Einheitslinie hinsichtlich Musik nicht entsprach, war per Definition und per Material Underground.«
Tikhonova ergänzt: »Bei Melodiya gab es vier oder fünf bezifferte Zuständigkeitsbereiche: »1« war Klassik, »2« war mit Schlager vergleichbare »Estrade«, »3« waren Parteiinhalte. Es wurde zwar auch elektroakustische Musik veröffentlicht, aber die kam von nicht einmal einem halben Dutzend »Staatskünstlern«.«
Dieser real existierende Underground – »ob Roxy Music, Kraftwerk oder Rolling Stones: das war alles verboten, Underground im westlichen Popkultursinn sowieso« (Tikhonova) – provozierte einen florierenden Schwarzmarkthandel. Wegen des Verbots waren die Scheiben sauteuer, so kostete z. B. eine Zappa-Platte einen sowjetischen Mindestlohn. Notgedrungen wurden Vinylplatten endlos auf Kassetten überspielt. Engagierte Personen wie der Musikjournalist Artemy Troitzky machten viel Material verfügbar, verbreiteten das nötige Know-how und lieferten Kontext. Die »New York Times« beschrieb Troitzky 1988 zu Recht als »führenden sowjetischen Rockkritiker«. Das gemeinsame Plattenhören hatte unter diesen Vorraussetzungen also einen sozialen, verruchten und volksbildnerischen Charakter.
»Dazu gibt es einen Witz«, erzählt Tikhonova, die aus Obninsk nahe Moskau stammt (wo 1954 das weltweit erste Atomkraftwerk gebaut wurde) und die viele Jahre in der sowjetisch-russischen Tape-Trading-Szene aktiv war. »Zwei »Beatlomanen« – so wurden in Sowjet-Zeiten Beatles-Fans genannt – treffen sich. Der eine lädt den anderen zu sich nach Hause ein, um gemeinsam eine neue Beatles-Platte zu hören. Beide sind ganz aufgeregt, schenken sich Wodka ein und die Plattennadel kratzt die ersten Rillen entlang. Dann setzt Musik ein, schließlich Gesang. Worauf der, der die Beatles bisher nur von Kassettenkopien kannte, ganz verdutzt feststellt: »Ich wusste gar nicht, dass die auch singen …««.
Wohl aus Pragmatismus sah die Regierung darüber hinweg, dass sich seit den späteren 1980ern vor dem Kaufhaus Gorbushka nahe dem Gorbunov-Kulturplatz eine Bootlegging-Szene etabliert hatte. Dort konnte man so ziemlich jede CD und jeden Film bekommen. »Im Gorbushka gab es Alben von The Residents, Skinny Puppy, Einstürzende Neubauten, Falco, Osho- und Punk-Musik etc.«, erinnert sich Tikhonova. »Ein anderer sehr aktiver Ideenumschlagplatz war die Moskauer Universität. Sie war einer der wenigen Orte, an den nicht-kommunistische Austauschstudenten kamen. Man kann sagen, dass allein aus dem Verbot und dem Mangel heraus Westplatten umso spannender waren.«
Spritzendorfer dazu: »Während man in der Sowjetunion trotz aller Repressionen schon in den 1960ern halbwegs gut über Westmusik Bescheid wusste, hat der Westen bis heute kaum eine Ahnung von sowjetisch-russischer Musik. Was auch damit zu tun hat, dass es in der UdSSR praktisch keine Presswerke und Vertriebe für Undergroundmusik gab. Man kann also durchaus eine Parallelentwicklung zwischen westlicher und sowjetischer Klangkunst konstatieren.«
»Der technologische Fortschritt ging Hand in Hand mit der politischen Öffnung. Damals wurde auf Tapes oder CDs kopiert, heutzutage ist praktisch alles über Torrent und Internet verfügbar. Eine Bootlegging-Szene gibt es im Gorbushka nach wie vor. Das nicht bis wenig vorhandene Urheberrechtsempfinden muss man aus sozialhistorischer Perspektive betrachten: Bootlegging hat in Russland eine quasi jahrzehntelange Kultur und Tradition. Vor diesem Hintergrund haben es russische Kreative zusätzlich schwer, zu überleben. Der kommerzielle Sektor und die Werbung funktionieren mittlerweile recht gut, der Kultursektor ist weiterhin schwerst unterfinanziert.«
Einen ganz anderen, daran aber gut anschließbaren Zugang verfolgt Dmitriy Morozov aka Vtol. Seine Spezialität ist das »Cracken« von billigem asiatischem Plastikspielzeug, das Russland überschwemmt. Er baut aus Laserpistolen, Minirobotern oder Sprechpuppen die Schaltungen und Chips aus und macht damit Circuit Bending. Wie bei Benzo und Borisov stehen Vtols Soundgenerierungen nicht für Musik per se, sondern für Informationsvermittlung. Waren die Vorgängergenerationen noch geprägt von Ernst und Schwere, wird mit dem jungen Morozov der spielerische Zugang in der rhizomatischen Virtualität postmoderner Prägung deutlich. Während früher die Kreativität aus dem Mangel geschöpft wurde, passiert diese nun in der sich verweigernden Reduktion.

Gestrandet an den Hinterhöfen der Geschichte
Einer, der den Plot von »Elektro Moskva« zusammenhält, ist Aleksey Iljinikh. Von der Statur her ein Bär, bleibt ungewiss, ob man es mit einem »netten Onkel« zu tun hat oder doch eher mit einem Ex-KGB-Agenten. Auf jeden Fall ist der ehemalige Restaurantmusiker eine wichtige Schnittstelle zwischen dem Gestern und dem Heute: Er ist der »Dealer«, der Benzo, einige andere russische Musiker und Sammler weltweit mit sowjetischen Synthesizern versorgt, die seit Ende des Kommunismus nicht mehr produziert werden. Die Kamera begleitet ihn – einem Setting interaktiver Geschichtsforschung gleich – in abgelegene Gegenden, dorthin, wo in Theaterkellern, Requisitenmagazinen, Dachböden oder auf Flohmärkten die historischen Artefakte einer vergessenen Zukunft verstauben. Iljinikhs Jagden haben so gar nichts Glamouröses an sich, vielmehr wird die x-te Aktualisierung von Junk betrieben. In diesen Bildern kommt der Poptraum von Weite nicht in einem »Larger-than-life« daher sondern als surreale Traumschlieren, die den Zuschauer sowohl mit der knallharten Alltagsrealität konfrontieren als auch mit poetischen Zwischenmenschlichkeiten, deren Enthusiasmus für seltsame Maschinen sie miteinander verbindet.

Spritzendorfer macht klar: »Eines der Spannungsfelder von »Elektro Moskva« lässt sich im Verhältnis zwischen kollektivem Regime und Individuum abstecken. Das kreative Potential des Einzelnen ist selbst unter den Bedingungen eines totalitären Systems nicht umzubringen. Auf einer symbolischen Ebene gibt das Hoffnung für prekäre Situationen aller Art. In diesen Synthesizer-Jagden schwingt das Freiheitsgefühl mit, das Musik allgemein vermittelt. Elektronische Musik hat damals den Sound der Freiheit bedeutet, eine Musik, die, weil sie nicht verfügbar war, zum Träumen angeregt hat.«
Wer dabei an N-/Ostalgie denkt, liegt falsch. Auch wenn diese Instrumente kommunistische Machbarkeitsutopien repräsentieren und gleichzeitig mit einer individuellen Historie aufgeladen sind: »Irgendwann kam der Entschluss, einen Erzähler einzuführen, der mit Augenzwinkern die Geschehnisse kommentiert. Der russische Zynismus speist sich aus dem Wissen, keinen Einfluss auf sein Schicksal zu haben«, meint Spritzendorfer. Die Off-Screen-Stimme Andrey Adrianovs illustriert süffisant diese in die Metastruktur eines Märchens verpackte Meditation über die russische »Volksseele« und lokalisiert »Elektro Moskva« irgendwo zwischen Ringmodulatoren, kollektivem Unbewusstem und dem weißen Rauschen des Alltags.
Eines der Verdienste von »Elektro Moskva« ist, Klangmaschinen als Quasi-Fabelwesen zu lesen, als allegorische Zufluchtsorte der Sehnsucht. »Wie im Märchen hat auch die Geschichte der sowjetischen Synthesizer einen mythischen Gründungsort: nämlich die Oktoberrevolution«, so Tikhonova. Der Streifen ebnet ebenso informativ wie kurzweilig weiße Flecken in den Kartografien historischer Musikproduktion ein, gibt ein gutes Antidot zu gegenwärtigen musikalisch-technischen Ûberforderungen ab und spricht ein leidenschaftliches Plädoyer für autodidaktische Kreativität aus: Utopien als Klang. »Elektro Moskva« ist einer der wichtigsten Musikgeschichtsfilme zurzeit.
Nach der Premiere beim Festival Diagonale, eröffnet »Elektro Moskva« das Filmfestival frame[o]ut, das von 12. Juli bis 31. August im Museumsquartier/MQ Wien stattfindet. Beginn: 21h. Vor dem Film findet eine Diskussion statt mit den Regisseuren und frame[o]ut-Leiterin Martina Theininger. Gezeigt wurde »Elektro Moskva« bisher u. a. bei: Vision du Reel, Sheffield Doc/Fest, FID Marseille und New Horizons.
Elena Tikhonova/Dominik Spritzendorfer: »Elektro Moskva«. A 2013, 89 Min., Rotor Film/sixpackfilm. Sprachfassungen: Russisch (Orig.), Englisch meU.



















