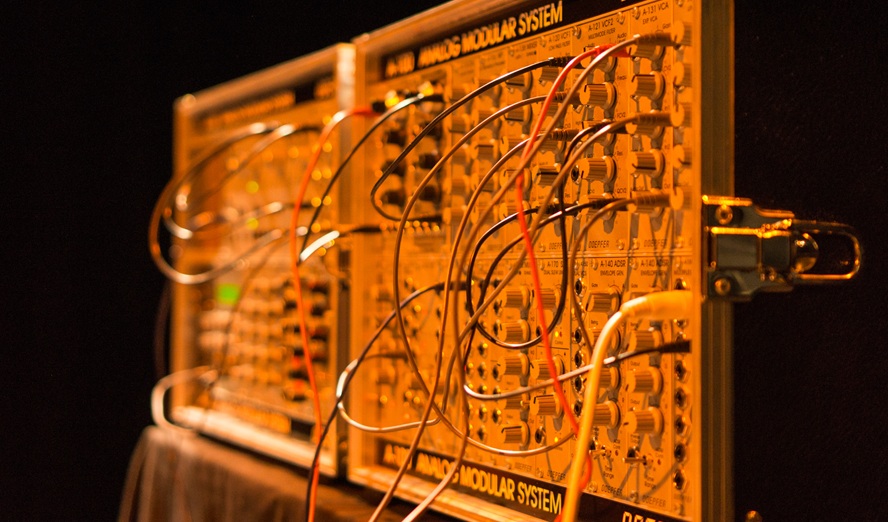David Keenan ist nicht irgendwer. Als Chronist des britischen Post-Industrial um Nurse With Wound, Current 93 und Coil hat er »England’s Hidden Reverse« beleuchtet und als Autor für das britische Magazin »Wire« international diskursmächtige Begriffe wie »New Weird America« und »Hypnagogic Pop« geprägt. Bis Anfang 2015 betrieb er zehn Jahre lang zusammen mit seiner Frau, der Musikerin Heather Leigh Murray, in Glasgow den Plattenladen und Mailorder Volcanic Tongue. Dessen Webseite konnte auch als Online-Fanzine gelesen werden, da zu jeder angebotenen Veröffentlichung eine eigene Kritik verfasst wurde und nicht auf die Waschzetteltexte der Labels zurückgegriffen wurde. Kurz gesagt, Keenan ist eine wortmächtige Stimme innerhalb einer international vernetzten Szene. Zu Beginn des Jahres 2015 schloss Volcanic Tongue seine Pforten. Ein Ereignis, das in den interessierten Kreisen weltweit Reaktionen hervorrief und durch Keenan selbst nicht unkommentiert blieb: »Es scheint uns, als schließe sich 2014 für Undergroundmusik ein Kreis, und wir sind gespannt zu sehen, wie sich diese Kultur ohne uns weiterentwickeln wird«, hieß es in der Ankündigung.
Etwa vier Wochen zuvor hatte Keenan bereits drastischere Worte gefunden, und in der Jahresrückblickausgabe von »Wire« (Jänner 2015) gezürnt: »Es ist 2014 und der Underground ist endgültig tot. Ein Leichnam, den jede x-beliebige Generation nach Belieben fleddert. Jeder Künstler ist seine eigene PR-Maschine und Kritiker sind nicht mehr als hemmungslose Marktschreier für ihre Lieblingsmusiker, deren Talente sie via Twitter im Tausch für Gefälligkeiten in den höchsten Tönen preisen.« Rückwirkend schien das, als habe Keenan mit diesen Worten schon die Erklärung dafür vorausgeschickt, warum Volcanic Tongue im Monat darauf schließen würde. Hat da bloß jemand die eigene ökonomische Misere zur ästhetischen Gegenwartsdiagnose aufgeblasen oder steckt doch mehr hinter der genervten Haltung des gelangweilten Veteranen: »Heutzutage spinnen sich neue Bands mit Bezug auf vorhergehende Underground-Acts ein sinnloses Netz aus Referenzen zusammen. Keine Ahnung, wie viele Kassetten, SoundCloud-Links, CD-Rs und Downloads ich in den letzten zwölf Monaten erhalten habe, alle mit derselben ominösen Behauptung, ich werde dieses und jenes lieben, denn es klinge genau wie Harry Pussy. – Tat es natürlich nie.« Und weiter: »Wir haben derzeit Underground-Künstler, deren Performance darin besteht, auf der Bühne hinter einem Tisch sitzend Aufnahmen von Kassetten abzuspielen – legitimiert durch den Hinweis, ihre eigene Arbeitsweise und Aufführungspraxis stehe irgendwie im Zusammenhang mit der Tradition elektroakustischer Komposition des 20. Jahrhunderts!« Blasphemie, gewissermaßen.
Alles gesehen, gegessen, getrunken?
Ohne Zweifel ermöglicht heute die digitale Verfügbarkeit ehemals schwer zugänglicher Musik, sich selbst im eigenen Keller in deren Geist zu erfinden und entsprechend mit dem Namen einer heiligen Kuh (hier: Harry Pussy) im eigenen Interesse (und vielleicht vergebens) hausieren zu gehen. Aber Keenan an dieser Stelle nur einen retromanischen Koller zu unterstellen, das griffe schlicht zu kurz. Und sicherlich liegt Keenan auch nicht daneben, wenn er auf einem Unterschied zwischen Stockhausen oder Schaeffer gegenüber einem (wahrscheinlich eher jüngeren) Menschen besteht, der Tape-Loops mit Hilfe von handelsüblichen Leerkassetten erstellt, abspielt und ineinandermischt. Aber wer hat gesagt, dass Underground gleich Avantgarde gleich Kunst ist? Diese Gleichung geht schon länger nicht mehr auf. Das setzt die jungen Menschen an den Kassetten nicht ins Unrecht – und es macht sie auch nicht zu Künstler*innen im Sinne der elektroakustischen Altvorderen.
Daraus folgt aber nicht, dass nicht auch die selbstgebastelten Tape-Loops erstaunliche Klangerlebnisse mit sich bringen können. »Klingt fast wie Stockhausen« ist Keenan jedoch zu wenig, denn was er von Klangkünstler*innen erwartet, ist Genie, die erzeugende Kraft und das Vermögen, das radikal Neue in die Welt zu bringen. Er referiert in diesem Zusammenhang nicht nur auf Schaeffer, sondern auch auf (vermeintlich) einsame Wölfe wie Jandek, Peter Brötzmann oder Loren Connors. Keenans romantische Vorstellung von Künstler*innen, auch oder gerade im Underground, als freie, gesellschaftlich marginalisierte, verkannte (und daher auch wahrscheinlich arme) Schöpfergeister stößt sich am allgegenwärtigen Heimwerker-Modell von Nach-Feierabend-Künstler*innen, die er im Modus des Recyclings operieren sieht. Und dann, als könne es nicht schlimmer kommen, twittern, liken und bloggen auch noch alle wohlwollend übereinander!
Kein Schulterklopfen
Angesichts solch inzestuöser Verhältnisse die Motten zu kriegen, das ist legitim – daraus abzuleiten, es könne innerhalb solcher Verhältnisse nichts mehr von Interesse und Dauer entstehen, das ist – bei aller Liebe zur Polemik – doch zu viel des Guten. Und dass eine ästhetische Praxis, ihrer Form und ihrem Inhalt nach, im Zuge des historischen und technischen Fortschritts ihre Aura einbüßen kann, weil sie nachgeahmt wird, das ist eigentlich ein alter Hut und wohl auch nur halb richtig. Eine elektroakustische Komposition von Delia Derbyshire bleibt eine beeindruckende – und in gewisser Hinsicht unnachahmliche – Erfahrung, auch wegen des damals notwendigen Aufwands, sie zu erstellen, und weil sie noch immer originell klingt und solange nicht altert, wie es Ohren gibt, die zu hören verstehen.
Wenn in der Folge durch die Hände angeregter Hörer*innen ähnliche Klangerzeugnisse unter Zuhilfenahme von Magnetband, Skalpell und Kleber entstehen – warum nicht!? Solche Aufnahmen mögen in Kleinstauflagen als CD-Rs oder auf Bandcamp erscheinen, getwittert und gelikt werden, und David Keenan mag angesichts dessen gähnen. Das sagt aber noch nicht viel darüber aus, ob der Underground (deshalb?) tot ist. Falls doch, so ist Keenan als Totengräber selbst dafür mitverantwortlich. Er hat als Autor für »Wire« viel dazu beigetragen, dass unzählige Labels und Künstler*innen, die lange Zeit eher unbeachtet operierten, einen (teilweise retrospektiven) Hype erfuhren, und auf diese Weise jeweils spezifische oder einzigartige Ästhetiken einem potenziell größeren Publikum zugeführt (und einzelne bzw. viele darunter zur Nachahmung angeregt) und so auch geholfen, all dies – den ganzen sogenannten Underground – zu Grabe zu tragen. (An dieser Stelle sei nachholend angemerkt, dass es – falls es noch nicht aufgefallen ist – den Underground nicht gibt, dass aber der Underground, über den nicht nur Keenan schreibt, sich historisch vage von »Dada bis Punk« (Greil Marcus) und darüber hinaus durch die Lektüre von »Wire« nicht unzutreffend nachvollziehen lässt.)
Beharren und weitermachen
Demgegenüber und schon bevor Keenan seine Grabrede hielt, hat der in Leeds ansässige Aktivist (Blog, Label, Konzertveranstalter, eigene Musikprojekte) Rob Hayler eine nüchternere Perspektive auf den Umstand eingenommen, dass Leute, unter Zuhilfenahme welcher technischen Mittel auch immer und jenseits von Trends und Moden, Klänge jeder Art erzeugen. Und das unterhalb der Aufmerksamkeitsgrenze derer, die nur einmal im Jahr das Glastonbury Festival besuchen. In diesem Kontext ist nicht jede/r gleich ein »Artist«, nur weil er mit »Sound« hantiert, aber mit gefälliger Kleinkunst hat die Produktivität auch nichts gemein, denn sie entzieht sich in aller Regel noch immer absichtsvoll und erfolgreich dem wohlklingenden musikalischen Biedermeier.
Vorrangig gegenüber der sicher nicht unwichtigen Frage nach der Materialästhetik und der Bewertung der »Sounds« ist für Rob Hayler, dass den von ihm so genannten »No-Audience Underground« kein Publikum im allgemeinen Verständnis des Wortes auszeichnet, »weil fast jeder, der ein Interesse an der Szene hat, selbst in die Szene involviert ist. Die Übergänge – ob Musiker, Promoter, Label-Macher, Händler, Autor, Kritiker, zahlender Kunde usw. – sind fließend und nicht hierarchisch, die Rollen können jederzeit und je nach Gelegenheit oder Notwendigkeit wechseln. Und ich möchte hervorheben, dass es sich hierbei nicht um eine versnobte Clique von Insidern handelt, die sich einfach nur völlig besessen um jeden Aspekt ihres Hobbys (nennen wir es ruhig so, wer kann heutzutage von experimenteller Musik schon seinen Lebensunterhalt bestreiten?) kümmert, sondern um freundliche und offene Leute die realisiert haben, dass sie Dinge, die sie sehen und hören wollen, schon selbst organisieren müssen, weil es sonst niemand für sie tun wird.«
Long live the underground
Haylers Beschreibung von Underground trifft sich nicht nur mit der Erfahrung aller, die in DIY-Szenen aktiv waren und sind, sondern auch mit den Erfahrungen Keenans. Derer scheint er aber überdrüssig, weil er sie durch massenhafte Imitation entwertet glaubt. Die Dialektik des Dabeiseins schlägt den frühen Szenevogel mit gereizter Müdigkeit, so scheint es, wenn am Abend die Langschläfer mit einem Wurm im Schnabel daherkommen, von dessen Sorte Keenan längst und in allen Geschmacksrichtungen gekostet hat. Er reagiert darauf mit teilweisem Rückzug und der programmatischen Forderung nach Isolation für ästhetische Praxis: »Wir brauchen eine neue Art von Kunst, die aufgrund ihrer Zurückgezogenheit beinahe soziopathische Züge trägt.« Er artikuliert so zugleich seine Sehnsucht nach einem Künstlergenie, das im Verborgenen vor sich hin brütet und wütet und seiner Entdeckung (und kongenialen Interpretation) durch den Kritikerfürsten (Keenan natürlich, wer sonst!) harrt.
Haylers Vorstellung ist demgegenüber profan. Die Forderung Beuys’, dass jeder Mensch ein Künstler sei, findet hier ein zeitgenössisches Echo – und darin auch das Herabsinken des Künstlers in die Niederungen der Existenz von jedermann. Hayler legt – in deutlichem Widerspruch zu Keenans Forderung – sein Augenmerk auf die soziale Seite dessen, was Underground genannt werden kann und worin Keenan sich seit Langem höchst aktiv bewegt und weiterhin bewegen wird. Haylers nüchterne, ebenfalls über die Jahrzehnte des Dabeiseins gereiften Überlegungen reflektieren die Notwendigkeit der alltäglichen Erfahrung von Solidarität, Dickköpfigkeit und Ausdauervermögen als Voraussetzung für jede (auch die des Genies) widerständige ästhetische Praxis jenseits dessen, was einem nicht nur an akustischem Müll tagein, tagaus zugemutet wird.
Dass es diesen ganzen Müll gibt, darüber sind sich Keenan und Hayler einig, dass es weiterhin Orte gibt, geben wird und geben muss, an denen etwas anderes und Besseres entsteht und gepflegt wird, auch darüber herrscht – wie könnte es anders sein? – Konsens. Mit Hang zur dramatischen Pose und so vorhersehbar wie unabwendbar deklamiert Keenan zum Ende seiner Grabrede: »Lang lebe der Underground«, und man fragt sich mit Hayler, weshalb Keenan zunächst das Kind mit dem Bade ausschütten musste? Die Antwort liegt allerdings auf der Hand und fällt zugunsten von Keenan aus: Es ist seinem feinen Sinn für den richtigen Moment geschuldet, solche Fragen aufzuwerfen, und seiner Position, dass anschließend auch darüber geredet wird, was denn mit »Underground« 2015 gemeint sein kann.
Quellen:
Joeri Bruyninckx: »Volcanic Tongue Interview With David Keenan«, It’s Psychedelic Baby, 15. August 2015 (online)
Rob Hayler: »What I Mean By The Term ‘No-Audience Underground’, 2015 Remix«, Radio Free Midwich, 14. Juni 2015 (online)
David Keenan: »Subterranean Homesick Blues«, »The Wire«, Jänner 2015 (No. 371), S. 47
Dieser Artikel erschien zuerst in skug #104, 10–12/2015. skug Backissues sind weiterhin auf Anfrage erhältlich unter www.skug.at/magazin.