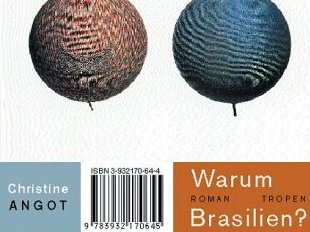Christine Angot hat sich in ihrem dritten, nun auf Deutsch erschienenen Roman, in diesen Raum gestürzt, ist in ihn gefallen. Nach dem Skandal und großen Erfolg von »Inzest« hat sie versucht ihr inneres und äußeres Leben neu zu ordnen und dies in »Die Stadt verlassen« dokumentiert – einer Nachgeburt des Erfolges, der gezeigt hat wie hoch der Preis innerer Bloßlegung ist, wie schmerzhaft die Nachwirkungen voyeuristischer Blicke sein können. Sie ist ausgebrannt. Sie ist müde. Sie kann nicht mehr. Lapidar stellt sie das bereits in den ersten Sätzen des Buches fest.
»Die Stadt verlassen« ist zu dieser Zeit in Frankreich bereits erschienen. Lesungen laufen an, Fernsehsendungen und Interviews werden von ihr unter hohem Einsatz absolviert. In dieser Situation beschließt den Aufenthalt ihrer Tochter Léonore in den Staaten zu nutzen, um in Paris einen neuen Lebensort für sich zu finden. In der Suche nach einem neuen Wohnort, in der Konfrontation mit der Stadt Paris wird ihr ihre innere Bewegungslosigkeit bewußt. »Nichts interessierte mich, nichts zog mich an, alles entsprach der gleichen Logik. Aber ich konnte nicht mehr. Ja, wenn man nicht mehr kann, kann man eben nicht mehr, und ich konnte nicht mehr.« Der Versuch in Paris «Fuß-zu-fassen« verdeutlicht diese innere Haltlosigkeit. Als ob sie alles neu erlernen möchte, ja von neuem beginnen muß, zeigen ihre affirmativ bleibenden Reflexionsversuche: »Ich war die Königin der Ambivalenz«. An ihrer Widersprüchlichkeit krallt sie sich fest. Sie wird zum naturgemäßen Programm des Buches zum Spielraum, die auch die Intensität ausmacht. »Ich habe nichts zu sagen, nichts, nichts zu erleben, zu erhoffen, zu erwarten, anzubieten, nichts wahrlich nichts. Angot läßt sich gedanklich gehen, negiert alle ihre Beziehungen und verherrlicht ihre Tochter. Dabei wälzt sie sich in Wiederholungen, die die Unmöglichkeit die Ereignisse auf Distanz zu bringen, zeigen. Die philosophischen Exkurse, die sie dabei unternimmt, sind wie ihre ständigen körperlichen Beschwerden wohl die notwendigen Begleiterscheinungen, die in der Haltlosigkeit das einzige Handfeste, Vorhandene, Greifbare zu sein scheinen. Ob angebracht oder nicht, muss hier nicht gefragt werden, dafür ist das mangelnde Zutrauen der Autorin zu sich selbst bereits nach dem ersten Drittel des Buches ersichtlich.
Angot geht noch einen Schritt weiter. Sie unternimmt in dieser Lebenssituation einen Beziehungsversuch mit Pierre-Louis Rozynès, dem damaligen Redakteur von »Livres Hebdo«, dem Börsenblatt des französischen Buchhandels. Zwei Einzelgänger mit neurotischer Ausprägung treffen aufeinander. Erklärungsversuche wären andernfalls überflüssig. Doch die Frage nach der Liebe wird hier erneut gestellt, weil man sich Wahrheit immer noch wünscht und Enttäuschungen braucht. »… ich sehe die Dinge, wie sie sind. Das heißt kontrastreich, kompliziert, nuanciert und widersprüchlich, und widersinnig.« Darauf legen es beide an, Rozynès, der einen schlechten Ruf in der verdorbenen Pariser Kulturszene zu wahren hat und ein Jude ist, »der sich in Friedenszeiten versteckt« und Angot, die die Öffentlichkeit so braucht wie sie sie verachtet. (Deplaziert wirkt die bereits im Klappentext angekündigte Auseinandersetzung mit ihrem »jüdischen Erbe«, die bei der Erwähnung der jüdischen Herkunft der Mutter beginnt und bei der Begegnung mit Rozynès in anmaßenden Denkansätzen über Pornographie und Judenverfolgung, Erotik und Judentum verendet.)
Distanz und Nähe werden in der Beziehung zum quälenden Spiel, um die eigene Unzulänglichkeit auf die Spitze zu treiben. Angot scheut auch dieses Mal nicht davor zurück, das Unaussprechliches zu sagen. Ob die Verzweiflung, die Leere, die Energielosigkeit ihr das recht dazu gibt, ist dem Leser überlassen. Als ihr Vater stirbt und sie beginnt, diesen Beziehungsversuch, diese Liebe, zu verbalisieren und sie sich nicht im erklärungslosen Handeln zeigt, hat sie genau die künstlichen Komplikationen und kann ihr somit keinen freien Lauf mehr lassen kann. Bei einem gemeinsamen Kanada-Aufenthalt reist sie nach einem Streit vorzeitig ab. »Und dann habe ich mich darangemacht zu schreiben, das war die einzige Lösung. Wie immer. Ich habe noch immer keine andere gefunden, was für eine Feststellung.« Und so ist auch dieses Schreibunternehmen zu verstehen und zu verteidigen. Respekt vor diesem Mut, doch zeigen muß er sich in zukünftigen Buchprojekten und Gültigkeit wird er haben, wenn die Verzweiflung am Leben begriffen wird und das Schreiben nicht mehr Erlösung sein kann.
Nachsatz:
Der Roman endet in der Wohnung von Frédéric Beigbeder, der sie und noch andere derzeit namhafte, französische Kultur-Prominenz zum Abendessen geladen hat. Geredet wird, worüber auch sonst als über Sex, Drogen, Kino, Musik: »Es herrscht eine enorme Sehnsucht nach den Achtziger Jahren, wir werden noch einiges davon abkriegen.« Damit trifft sie den offen gelegten und überreizten Nerv der sich im Kreise drehenden, französischen Gegenwartsliteratur: Wenn alles gesagt ist und man trotzdem nicht schweigen kann.
Christine Angot: Warum Brasilien? Roman. A.d.Franz.v. Christian Ruzicska. Köln: Tropen Verlag 2003. 208 S., € 17.80