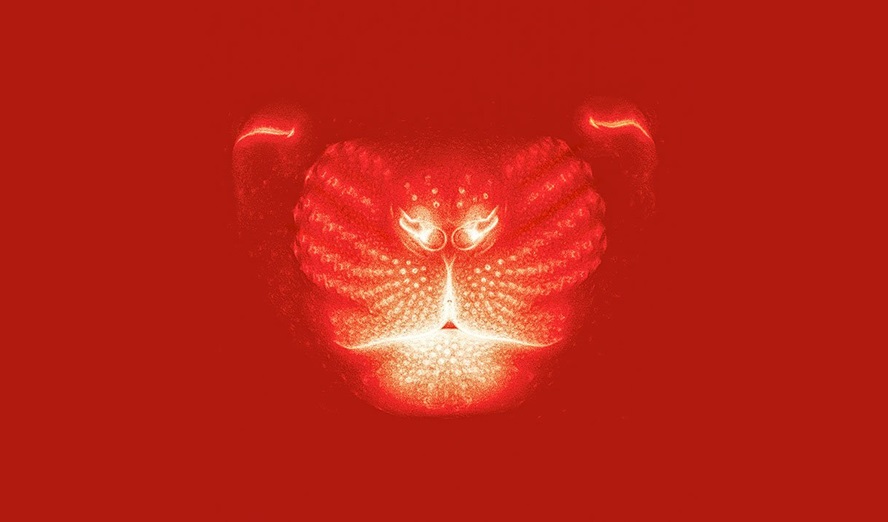Der vom russischen Regime im Jahr 2014 entfachte Bürgerkrieg im Osten der Ukraine war in den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher Filme. Jetzt, vor dem Hintergrund von Putins Angriffskrieg und der gegenwärtigen Flut von Schreckensmeldungen und -bildern, lohnt ein erneuter Blick auf zwei herausragende Werke, die die Erkenntniskraft des Mediums Film gegen den Irrsinn des Krieges auf unterschiedliche und ungebrochen aktuelle Weise mobilisieren.
Farce, Fragment und Racket: Sergei Loznitsas »Donbass« (2018)
2014. Wir befinden uns in der Bürgerkriegsregion Donbass, im von russischen Separatisten kontrollierten Osten der Ukraine. In einem Trailer zanken sich Schauspieler*innen, während ihnen das Make-up aufgetragen wird. Wir wissen nicht, ob es ernst oder witzig ist, bis eine klarstellt, sie übe nur ihre Rolle. Eine Assistentin kommt in den Trailer und fordert alle auf, mitzukommen. Wir folgen den laufenden Menschen bis hinter eine Mauer, wo sie die nahen Granateneinschläge abwarten. Anschließend, vor dem Hintergrund eines zerschossenen Busses und Toten am Asphalt, sagt dieselbe Frau, der eben noch Make-up aufgetragen wurde, direkt in eine Kamera, sie arbeite in einem nahen Shop und sei zur Unglücksstelle gelaufen, als sie die Explosion gehört habe …
Bereits dieser Anfang von Sergei Loznitsas viertem Spielfilm »Donbass« wirft uns in eine Konstellation, in der kriegerisches Ereignis und filmische Repräsentation eng miteinander verzahnt sind: Ist die Frau Schauspielerin oder Betroffene? Wird hier ein Film über Krieg während eines echten Krieges gedreht? Was ist echt, was Filmset? Und ist das Aufklärung oder Propaganda?
Auch alle weiteren der dreizehn lose verbundenen Episoden des Films befragen unterschiedliche Aspekte einer Eskalation des Verhältnisses von Wahrheit und Bild bzw. Sprache. Krieg und Alltag blenden dabei ebenso ineinander, wie die realen Ereignisse und ihre mediale oder propagandistische Repräsentation. So kippt eine Politikerin einem Redakteur medienwirksam einen Kübel Fäkalien über den Kopf, weil er angeblich Lügen über sie geschrieben hat; ein deutscher Journalist gerät an Soldaten, die zwar gerne für Fotos posieren, aber keine Antwort auf die Frage geben, wer hier der Kommandant sei; der Akt der Trauung eines Paares fungiert gleichermaßen als Inszenierung von staatlich-bürokratischer Legitimität (Stichwort »Föderativer Staat Neurussland«), wie auch als Party-Exzesse für brutalisierte Freischärler. Stets geht es um Deutungen und Umdeutungen im symbolischen Register von Macht.
Reflexionen über den Krieg mit filmischen Mitteln
Die Kinematografie – wie bei allen vorangehenden Langfilmen von Loznitsa auch diesmal brillant realisiert von Kameramann Oleg Mutu – ist dokumentarisch und bewegt, meist nah am Geschehen, aber auch immer wieder um eine Distanz bemüht, die das Theaterhafte der jeweiligen Situation hervortreten lässt. Irgendwo zwischen Kriegsreportage und Performance. Als Inspiration dienten Loznitsa Amateurvideos auf YouTube. Diese verweisen laut Regisseur besonders prägnant auf den Doppelcharakter von Farce und Tragödie, der die Situation im Donbass prägt.
Eben diese rabenschwarze Spannung erfüllt Loznitsas Vignetten, deren narrative und ästhetische Zerrissenheit die gesellschaftliche auslotet. Stets, aber insbesondere in der ersten und letzten Sequenz, reflektiert er dabei auch die eigene Position als Filmemacher in einem Krieg der Bilder. Jede Episode beginnt bei Null, bleibt Fragment und verweigert damit der Sinnlosigkeit des Ganzen ein sinnvolles ästhetisches Korrelat. Nichts läuft hier zu einem »Deshalb« zusammen. Jede Szene hinterlässt ein beklemmendes Gefühl dafür, dass das alles nicht so ein müsste, dass die Eskalation vielmehr ständig aufs Neue hergestellt werden muss. Allein dadurch widerspricht die narrative Konstellation vehement den gezeigten propagandistischen Behauptungen.
Apropos propagandistische Behauptung: Putins Wahnidee einer notwendigen »Entnazifizierung« der Ukraine wird in den separatistischen Regionen seit Jahren – und nicht erst seit seiner wirren Rede kurz vor dem Einmarsch am 24. Februar 2022 – als alles rechtfertigende Propagandaformel eingeübt. »Donbass« zeigt schonungslos, wie eben diese Lüge als Kitt zur gemeinschaftsstiftenden Verrohung fungiert, als eine nur halb bemühte Bemäntelung der Tatsache, dass die Herrschaft der paramilitärischen Pro-Putin-Rackets auf Gewalt und identitärem Wahn fußt. Die Form des Films enttarnt den Inhalt der einheitsstiftenden Lüge und stellt damit ihre Beliebigkeit und ihre theaterhafte Performativität effektiver zur Schau, als eine begriffliche Korrektur es könnte. Darin besteht die große Leistung von Loznitsa: Er denkt präzise mit filmischen Mitteln über die Gedankenlosigkeit organisierter Gewalt nach.

Endpunkt soldatischer Männlichkeit: Valentyn Vasyanovychs »Atlantis« (2019)
Regisseur Valentyn Vasyanovych entwirft in seinem vierten Spielfilm »Atlantis« ein Danach von Krieg und Propaganda in einem fiktionalen Jahr 2025. Völlig anders als in »Donbass« handelt es sich hier um einen weitgehend sprachlosen Film. Wir folgen dem Ex-Soldaten Sergiy (Andriy Rymaryk) durch einen von Trauma, Langeweile und Arbeit bestimmten Alltag im ukrainischen Osten. Vom Kriegsheroismus sind lediglich ritualisierte Schießübungen übriggeblieben, die Sergiy mit seinem Kameraden Ivan durchführt. Beide arbeiten in einer Schmelzerei. Ein Ort, der wie die produktive Rückseite der destruktiven Kriegslogik anmutet: Gefangene im Stahlkäfig einer bizarren Männerwelt. Nachdem sich Ivan das Leben nimmt, indem er sich in das Flüssigmetall stürzt, gerät eine langsame Handlung in Gang. Oder besser: eine Loslösung. Denn nachdem das Stahlwerk schließt, trifft Sergiy auf Katya (Liudmyla Bileka), die für eine NGO arbeitet, die getötete Soldaten aus der Erde der ehemaligen Schlachtfelder gräbt und deren Identität und Todesursache rekonstruiert.
»Atlantis« analysiert post-soldatische Männlichkeit nach Heroismus und Pathos. Wir sehen eine apokalyptische Nachkriegswelt, eingefangen in stillen Weitwinkeln. Hier sind die Innenleben der Figuren so zerstört, wie die Landschaft; alles liegt offen zutage, ausgeleuchtet und sprachlos, völlig resonanzlos. Vasyanovych, auch für Kamera und Schnitt verantwortlich, entfaltet von dieser Situation ausgehend die Ablöse einer spezifischen ökonomischen Logik durch eine andere: Sergiy verlässt die Ordnung von Produktion und Destruktion, die der Film in einer Art dystopisch reduzierter Nutshell zeigt – Männer zwischen Stahl und Stählung quasi –, zugunsten einer aufklärerischen Care- und Forschungsarbeit.
Der Unsinn der soldatisch-maskulinen Lebensweise, ihre Rituale und ihr Hang zu (Auto-)Aggression, werden in »Atlantis« mit Geduld befragt und teilweise überwunden. Wunderschön etwa, wenn sich der Protagonist ein heißes Bad macht, indem er eine riesige Baggerschaufel, die sinnlos in der Landschaft steht, mit Wasser füllt und darunter ein Feuer entfacht. Genuss und Selbstsorge widersprechen dem dumpf-asketischen Härtegebot des kriegerischen Pathos schon durch die bloße Anerkennung des eigenen Selbst als verletzlichem, vereinzeltem Körper. Nichts anderes als diese*r Einzelne ist das Substrat von einer Emanzipation, die diesen Namen verdient hat. Die Möglichkeiten eines solchen emanzipatorischen Handelns und Fühlens befragt »Atlantis« aus den Niederungen einer höllischen Situation heraus. Dabei entsteht kein Optimismus; aber die langsame Negation des Schlechten erweist sich doch als Keimform eines möglichen Besseren.
Film gegen Kriegspathos und Stumpfsinn
Auch wenn dieser gegenwärtige Krieg noch so eindeutig ist hinsichtlich der Alleinschuld des massenmörderischen russischen Regimes, birgt die daraus resultierende »Einigkeit im Angesicht des Feindes« (Isolde Charim) doch Fallstricke. Insbesondere dann, wenn ein diffus positives Gefühl von »gerechtem Verteidigungskrieg« sich mit einem diffus negativen Gefühl bezüglich der eigenen »postheroischen Gesellschaft« (Herfried Münkler) mischt. So hat etwa die Wochenzeitung »Die Zeit« in einem später gelöschten Tweet folgende Frage in den Äther geblasen: »Während Putin in den letzten Jahren aufrüstete, kümmerten wir uns in Deutschland um den Ausbau von Kindertagesstätten und um mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung. Waren wir naiv?« Die Frage enttarnt sehr präzise, was sofort auf der Strecke bleibt, wenn heroischer Schwachsinn, zur geopolitischen Notwendigkeit umgefärbt, plötzlich das Sagen hat: Kindeswohl, Tierwohl und implizit freilich auch emanzipatorische Fortschritte wider das heteronormative Familienmodell – alles eben, was der soldatischen Männlichkeit als schwächer gilt und im Ernstfall dann im Weg herumsteht.
Diese Stimmung fasst der Autor Franzobel in einem »Standard«-Kommentar als plötzliche Abwesenheit von Errungenem: »Als hätte es eine Friedensbewegung, Antikriegsfilme und die Einsicht, dass Krieg der Vater aller Undinge ist, nie gegeben.« Das stimmt. Aber die konsternierte Formulierung verwechselt Ursache und Wirkung: Krieg ist nicht der Vater aller Undinge, sondern eher der durchgeknallte Sohnemann. Der Vater des modernen Krieges ist immer noch das bürgerliche Patriarchat, also die kapitalistisch-nationalstaatliche Gesellschaft mitsamt ihren reaktionären Basisideologien. Letzteren – insbesondere völkischem Nationalismus und Autoritarismus – kommt es zu, jene gemeinschaftsstiftende Wärme zu garantieren, die die systematische Ersetzbarkeit und die Vereinzelung am Arbeitsmarkt kategorisch verwehrt. In dieser Austauschbarkeit des*der Einzelnen sind sich Putins Mafia-Kapitalismus und der westliche Neoliberalismus strukturell einig. Und die identitätspolitische Bewältigungsfigur dieser Einigkeit ist der kämpferische Mann als Beschützer und Ernährer.
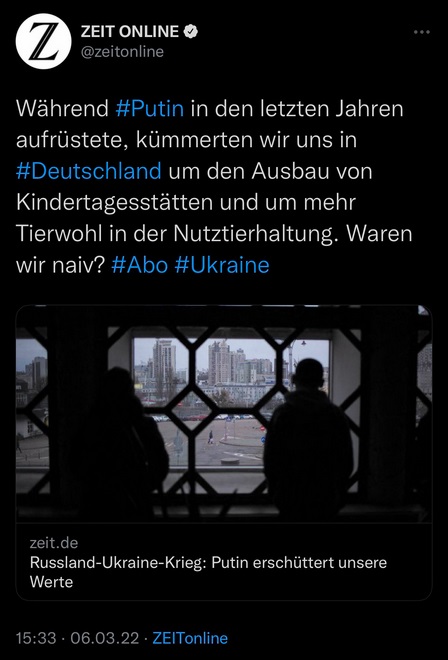
Postheroische Solidarität
Wie leicht diese ideologische Keimzelle auch in der rechts- und sozialstaatlich mehr oder weniger gehegten EU aktivierbar ist, wissen wir nicht zuletzt seit Jahren von den Erfolgen der extremen Rechten, deren Akteur*innen sich oft als die größten Putin-Fans gerieren. Gegenwärtig feiert der soldatische Mann allerdings ein milieusprengendes Comeback in den vermeintlich postheroischen Gesellschaften. Wenn etwa Selenskyj in der westlichen Medien- und Twitter-Sphäre als mutig abgefeiert und Putin als aufgequollener Feigling geschmäht wird, dann schafft das zwar Erleichterung, beantwortet aber letztlich Putins peinliche Harte-Mann-Pose mit exakt derselben Formel – ein Macker gegen den anderen.
Diese Einsicht ändert nichts daran, dass es keine Alternative zur aktiven Solidarität mit der Ukraine gibt. Aber eine solche sollte sich von allen ideologischen Implikationen des rechtsextremen Putinismus absetzen und eben keinesfalls dessen autoritäre Bildsprache oder das heroische Männlichkeitsideal übernehmen. Es bedarf also einer postheroischen Solidarität, wenn man so will – mit den Verteidiger*innen, mit den Geflohenen und freilich auch mit allen Kriegsdienstverweigerern. Die Ambivalenz zwischen der Solidarität mit einem angegriffenen Staat und der Ablehnung von reaktionärem Heroismus muss insbesondere linke Kritik und Analyse ertragen und stets neu befragen.
Filme wie »Donbass« und »Atlantis« bieten die Möglichkeit, sich gegen dräuendes Kriegspathos zu sensibilisieren. Ersterer, indem er die falsche Eindeutigkeit und Performativität von Propaganda und Identität entlarvt; Letzterer durch die präzise Darstellung eines post-propagandistischen Endstadiums soldatischer Männlichkeit.