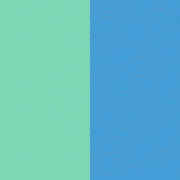skug: Da das Multiverse Studio für eure Arbeit eine sehr wichtige Rolle spielt, würde ich zunächst einmal gerne mehr darüber erfahren – wie und von wem wird es betrieben, wie arbeitet ihr dort, wo stoßt ihr dabei an Grenzen, und welche Strategien verfolgt ihr, um diese zu überwinden?
James Ginzburg: Multiverse wird nicht als kommerzieller Ort betrieben, es ist vielmehr ein gemeinsames Studio für Projekte auf unseren Labels: Tectonic, das von Pinch betrieben wird; Joker’s Kapsize; und Subtext, wo einige Sachen von uns sowie von Roly Porter und Paul Jebanasam erschienen sind. Außerdem sind noch einige KomponistInnen Teil des Multiverse-Kollektivs, die an verschiedenen Projekten arbeiten, wie beispielsweise an Filmtrailern. Letztes Jahr entstand dort zum Teil auch unser erster Spielfilm. Paul und ich schreiben im Studio ansonsten aber nur unsere Musik als Emptyset. Was die Einschränkungen des Studios betrifft, so besteht unsere Musik vorwiegend aus analogen Prozessen, die sich meist direkt aus dem Studioequipment ableiten lassen. Nach zwei Alben und mehreren Singles versuchen wir langsam, die eingeschränkte Soundpalette des Studios zu verlassen, und machen vermehrt auch Experimente außerhalb unseres Studios. Das kann sowohl in anderen Studios sein als auch in Räumen, wie etwa einem aufgelassenen Atomkraftwerk im Norden von Wales oder letztes Jahr eine Mine. An einem bestimmten Punkt begannen wir uns zu überlegen, wie es möglich wäre, den Charakter von Räumen, Gebäuden – oder ganz allgemein, von Architektur – in unsere Sounds einfließen zu lassen und damit eine Art räumliches signal processing zu praktizieren.
Paul Purgas: Manchmal kommt mir vor, dass aus rein technischer Sicht wesentlich mehr im Rahmen des Studios möglich wäre. Es ist aber, als ob wir uns insgeheim dazu entschlossen hätten, dies nicht zu tun, da es nicht unserer Arbeitsweise entspricht.
J. G.: Man unterliegt auch leicht der Versuchung etwas »Neues« mit einer alten Sache »in einem neuen Gewand« gleichzusetzen. Gut, wir haben jetzt diesen Sound ein Jahr lang durch diese Box geleitet. Haben wir eine andere Box, durch die wir die Sache schicken könnten, um ihr einen anderen flavour zu verleihen? Wir bemühen uns nicht um eine Veränderung der Sounds bloß um der Veränderung willen. Es geht uns auch nicht darum, Dinge zu erschaffen, die es zuvor in dieser Form noch nicht gab. Wir wollen vielmehr Unbekanntes erforschen und erleben. Etwa durchs Unterholz zu laufen und plötzlich … bist du im Wald … diese Bäume, du siehst sie zum ersten Mal … die Sonnenstrahlen, wie sie durch die Blätter scheinen … Es kann sehr aufregend sein, sich an einem Ort wiederzufinden, an dem man noch nie zuvor gewesen ist. In gewissem Sinne ist das auch vergleichbar mit der Begeisterung, die entsteht, wenn man ein Kabel in eine Buchse steckt und plötzlich etwas passiert, das man so zuvor nicht erwartet hatte. Wenn wir nun in diese großen Räume gehen, machen wir letztenendes nichts anderes, als solche Unfälle zu produzieren.
Könntet ihr bitte beschreiben, was ihr konkret an diesen Orten macht? Wenn ich das richtig verstehe, stellt ihr ein großes Soundsystem in diese Räume, spielt eure Sounds ab und nehmt sie dann wieder auf …
J. G.: Man nennt diese Technik »Reamplifikation«. Dabei verwendet man den Raum als eine Art Reverb, um seinen Klang einzufangen und positioniert dazu mehrere Mikrofone an verschiedenen Orten im Raum, stellt Verbindungen her und erzeugt Rückkopplungen. Das Soundsystem verstärkt und erweitert diesen Prozess. Die speziellen Eigenschaften verschiedener Räume führen oft zu spontanen Ergebnissen, die wir dann aufnehmen – anstatt jedem Raum eine bestimmte Note zuzuordnen. Im Fall der Mine klang das zwar in der Theorie gut, allerdings gab es einen derart dominanten Subbass- Drone in einer ganz bestimmten Tonhöhe – einem G – so dass unser Plan auch deshalb nicht aufging. Ganz gleich welchen Sound wir auch in die Tunnel hineinschickten, nach wenigen Sekunden verschmolzen die anfangs oft interessanten Reflexionen zu einem riesigen »boooooaaammmmm…«. Ich denke, so wäre das Album wohl ziemlich dumpf geworden. [lacht] Naja, für einen Track wäre es wohl okay gewesen.
Ich finde es interessant, wie schwierig es sein kann, Räume zu »kontrollieren« …
J. G.: Ich glaube, dass wir zum ersten Mal während einer Orchesteraufführung in der Kathedrale von Bristol darauf zu sprechen gekommen sind, wie es wäre, spezielle Räume für unser Projekt zu nutzen. Ich fragte mich damals, ob manche KomponistInnen ihre Werke eigens für oder sogar direkt in bestimmten Kathedralen geschrieben haben. Speziell die Dynamik ist ja sehr von den Eigenschaften des jeweiligen Raumes abhängig. Daher wäre es durchaus sinnvoll zu wissen, wie lange die Pausen zwischen den einzelnen Phrasen sein müssen, um dem spezifischen Hall des Raumes den entsprechenden Platz zu geben. Im Kontext von Clubmusik würde man ja auch meist den Hall an den Abstand zwischen Bassdrum und Snare anpassen, damit das Stück »zu atmen« beginnt.
Auch bei unserer Arbeit geht die Beziehung zwischen Klang und Raum über ein bloßes Beschallen und Wiederaufnehmen des Halls hinaus. Es kommt unter anderem darauf an, das richtige Verhältnis herzustellen, herauszufinden, welche Note einem bestimmten Raum entspricht oder das Verhältnis eines Raumes zu unterschiedlichen Noten und Notenlängen. Es gibt jedenfalls wesentlich mehr Möglichkeiten als die bloße Verstärkung eines Klangs in einem Raum.
Ihr arbeitet auch mit der Architecture Foundation in London zusammen?
P. P.: Ja, wir haben vergangenen Dezember eine Soundinstallation im Rahmen der Programmschiene »Sounding Space« realisiert. Die Installation selbst befand sich an einem Ort namens »Ambika«, einer unterirdischen Halle direkt unter der Baker Street in London, in dem ursprünglich Betonelemente [für den Ärmelkanaltunnel, Anm. d. Red.] getestet wurden. Wir wollten unser Album »Medium« in Form einer öffentlich zugänglichen Soundinstallation erweitern.
Wenn ich mich nicht täusche, dann hast du, Paul, ja eher einen Architekturhintergrund, während du, James, eher von der Musik kommst – bewegt ihr euch gerne in diesem Raum zwischen Kunst und Club?
J. G.: Wir haben uns über die Musik kennengelernt. Seltsamerweise fanden aber erst über das gemeinsame Musikmachen dann auch nach und nach mehr musikalische Themen Eingang in unsere Gespräche. Ich komme ja ursprünglich von der Literatur. Ich lese gerne [beide lachen] Obwohl mein beruflicher Hintergrund schon auch die Musikproduktion ist. Früher war ich viel mehr involviert, tourte als DJ und war an einigen Projekten beteiligt. Es scheint fast so, als hätte sich Emptyset umgekehrt proportional zu meinem Interesse an Clubkultur entwickelt. Im selben Ausmaß, wie dieses Interesse zurückgegangen ist, scheint sich unsere Fähigkeit entwickelt zu haben, uns als Emptyset auch in anderen Zusammenhängen zu bewegen. Aber Paul hat da wohl ein anderes Verhältnis dazu.
P. P.: Auf jeden Fall. Seit den 1920er Jahren gibt es zwischen sound und Kunst eine Auseinandersetzung. Dabei fand der überwiegende Teil der Klangforschung im Bereich der elektronischen Musik in Nachtclubs statt. Heute sucht Kunst wieder vermehrt nach Anknüpfungspunkten zu dieser Geschichte, insbesondere was die Zeit ab Disco betrifft. Daher gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, zwischen diesen beiden Kontexten zu differenzieren. Die Entwicklungen in Kunst und Kultur haben in diesem Bereich zur Herausbildung einer bestimmten Infrastruktur geführt, auf die aber die KünstlerInnen selbst relativ wenig Einfluss haben. In einem Rahmen wie diesem hier [dem Donaufestival in Krems, Anm. d. Red.] produzieren wir einen gewissen Output, und die Frage ist nun, unter welchen Umständen das Publikum diesen Output rezipiert. Die Bedingungen dafür werden aber nicht von uns definiert.
Auch klassische Musik hat mittlerweile Aspekte elektronischer Computermusik absorbiert, speziell wenn man an die Geschichte der elektronischen Produktionsstudios der 1960er und 1970er Jahre denkt. Die bauten ihrerseits wieder auf den Ursprüngen klassischer Musik auf, den Akademien und dem Konservatoriummodell. Aber diese Linie hatte sich weder für Bass-Produktion interessiert, noch die Mittel dafür gehabt, irgendetwas in dieser Richtung voranzubringen – im Unterschied zu den Nachtclubs.
J. G.: Der Clubkontext unterliegt allerdings auch einigen Einschränkungen. Es scheint, als würde sich immerzu der gleiche Moment wiederholen, wie in einer Basketballhalle. Zwar ist die Erfahrung bei dem Besuch eines Basketballspiels jedes Mal eine andere, aber im Prinzip wird derselbe Moment jedes Mal aufs Neue wiederholt. Das betrifft ebenso die Kommunikation zwischen dem Publikum und den Athleten. All das ließe sich ebenso gut auf andere Räume, Situationen oder auch Ideologien übertragen.
Auch Emptyset hat seine Ursprünge in einem wesentlich traditionelleren Rahmen von Techno. Mittlerweile hat sich das Projekt in eine andere Richtung entwickelt. Es trägt dabei aber immer noch die Merkmale von Techno in sich, während die ursprüngliche Funktion weggefallen ist und sich der Kontext verändert hat.
Welche Rolle spielt eurer Meinung nach euer Wohn- und Arbeitsort Bristol für eure Musik? Oder, um die Frage anders zu stellen, würde Emptyset anders klingen, wenn ihr hier in Krems leben würdet?
P. P.: Ich denke schon, dass wir in Bristol eine bestimmte Musiktradition mitbekommen haben – auch wenn das möglicherweise unbewusst passierte. Allerdings ist das nichts, worüber wir uns normalerweise unterhalten würden.
J. G.: Irgendwann sind wir mit unserem Projekt an einem Punkt angelangt, an dem wir begonnen haben, jegliche Referenzpunkte abzulehnen. Wir wollten etwas machen, das möglichst keinerlei kulturelle Assoziationen provoziert, sondern stattdessen die grundlegende Struktur von projectness oder genreness offenlegt. Das wollten wir zu unserem Ausgangspunkt machen.
P. P.: Wenn man mit einer derart universellen Palette arbeitet, ermöglicht man dem Publikum, seine eigenen Assoziationen, Gedanken und Erfahrungen mit der Musik zu verbinden. Man nimmt sich also ganz bewusst zurück und gibt dem Zuhörer oder der Zuhörerin die Gelegenheit, sich eine eigene world out of music zu erschaffen, statt Ästhetik, Werte und Inhalte vorab zu definieren. Natürlich ist das auch immer eine Gratwanderung, aber wir wollen dem Publikum diese Möglichkeit ganz bewusst bieten.
Ich frage das, weil Franz Pomassl aus der Gegend um Krems stammt, und er genau wie ihr auch kürzlich eine Platte auf Raster- Noton veröffentlicht hat…
J. G.: Also für mich ist das ein wenig seltsam, denn ich lebe zwar in Bristol, bin aber in den USA aufgewachsen. Ich kam mit siebzehn nach Großbritanien und habe die letzten vierzehn oder fünfzehn Jahre hier verbracht. Allerdings habe ich mir während all der Jahre nie gedacht: »Oh, jetzt bin ich british«. Wenn ich in die USA komme, fühle ich mich aber auch nicht wirklich als Amerikaner. Ich definiere mich mehr über die Dinge, die ich mache, und die Menschen, die mich umgeben. Ich weiß nicht, was Paul darüber denkt, der eine wesentlich größere Verbindung zu Bristol hat als ich; ich glaube aber, dass Musik niemals eine Verbundenheit zu einem bestimmten Ort ausdrückt. Vielleicht ist das auch nur deshalb so, weil ich selber zu keinem Ort eine besonders starke emotionale Bindung habe.
P. P.: Ich bin in den 1990er Jahren in Bristol aufgewachsen, zu einer Zeit, als die Musik dort passierte, für die die Stadt heute bekannt ist. Bristol hatte seine eigene Musikbewegung – eine Welt, die vor allem von HipHop und Hardcore geprägt war. Musik aus Detroit oder Chicago gab es zwar im Radio, sie fand aber keinen Weg in die lokale Szene, da sie einfach nicht zur Kultur der Stadt passte. Eine Verbundenheit zu House und Techno hat sich in Bristol erst sehr spät entwickelt. Umso faszinierender ist es derzeit zu beobachten, wie sehr diese Musik von der Stadt aufgesogen wird. Das Problem mit dem Erbe von Bristol ist, dass es sehr viel andere Musik verhindert hat, die sonst hier hätte entstehen können.
J. G.: Als ich 1998 nach Bristol gezogen bin, gab es einen regelrechten Stolz auf die musikalische Gemeinschaft in der Stadt. Mittlerweile scheint sich das aber zu einer Fessel entwickelt zu haben und ist zudem sehr reduziert: »Bristol, was ist das?« Wir haben die Brücke, es gab Massive Attack und jetzt gibt’s Banksy. Am Ende bleibt die Karikatur einer Kultur, die im besten Fall irrelevant ist, und im schlechtesten Fall stagniert. Aus meiner Erfahrung weiß ich aber, dass hier die unterschiedlichsten und spannendsten Dinge passieren. Viele der Musikerinnen und Musiker in meiner Umgebung kommen aus Bristol, aber die Stadt hat sich auch zu einem Anziehungspunkt für kreative Leute aus ganz Europa entwickelt.Und doch würde in Bristol niemand, der bei klarem Verstand ist, je das Wort TripHop aussprechen.
P. P.: Neiiin! [lacht]